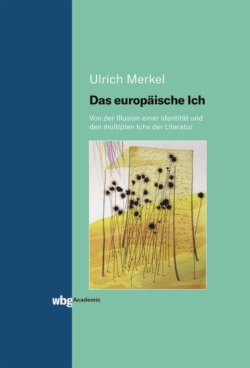Читать книгу Das europäische Ich - Ulrich Merkel - Страница 11
2.3. Name und Haus – die Bedingungen des Ichs in der Ich- und Wir-Kultur
ОглавлениеNiemand ist mein Name.
Homer: Odyssee. 6. Gesang
Es sind die so genannten Eigenschaften, die uns von anderen und von anderem abgrenzen und dadurch erst zum Ich machen. Was sind Eigenschaften? Man kann sie definieren als Attribute, die unsere persönliche Identität, unser Ich, formen und bedingen und die uns zum überwiegenden Teil durch die Zufälle des Geschlechts, der Hautfarbe, der Religion, der Nationalität, der sozialen Schicht, und sonstiger Koordinaten von Ort und Zeit, in die wir ohne unser Zutun hineingeboren werden, zugewiesen sind. Verändern und der prägenden Kraft des Wir entziehen kann man sie nur sehr begrenzt: durch Selbsterziehung, Mobilität, Phantasie, Zivilcourage, Querdenken, Narrheiten und intellektuelle Respektlosigkeit. Allzuviel Freiheit macht jedoch schwindlig und macht Angst, da man sich damit dem Schutz der „Menschenherde“, dem Wir, entzieht.
Eigenschaften determinieren also und schränken individuelle Freiheiten und Möglichkeiten ein, mit der Gefahr, daß der Möglichkeitssinn verkümmert. Im Normalfall plant heute dann der Mensch, vor allem in Mitteleuropa, sein Leben als Funktionär seiner gesellschaftlichen Bedingtheiten, staatlich reglementiert und geschützt durch allerlei Haftpflicht-, Kranken-, Unfall- und Sozialversicherungen, die ihn vor den Unberechenbarkeiten des Schicksals bewahren – ein Leben gleichsam auf Schienen von der Schule über den Beruf zur Rente36, bis er vielleicht in einem Senioren-Wohnheim versorgt und entsorgt wird.
Zu den wichtigsten Eigenschaften, welche die Identität eines europäischen Ichs bedingen, gehört neben dem Namen auch ein fester Wohnsitz. Auch der europäische Gott braucht ja anscheinend ein Haus, um „Ich“ sagen zu können; denn es ist u.a. das Haus, das seine Unendlichkeit in der Begrenzung durch Wände und Dach an diesem Ort als endlich bestimmt und ihn somit für die Menschen faßbar und ansprechbar macht. Es ist das Gotteshaus, zur römischen Zeit die Katakombe unter der Stadt, welches der Gemeinde Schutz bietet und wo sie sich in gemeinsamen Ritualen und wiederholbaren Gebetsformeln als christlich definiert. Fast zwei Jahrtausende nach Christi Geburt schreibt Robert Musil seinen Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“, seine Hauptfigur heißt zunächst „Anders“. Der Name als eine der wichtigsten Eigenschaften zur Identifizierung eines Ichs hebt sich hier selbst auf: wenn immer man ihn als Person zu fassen meint, ist er anders. In der Endfassung des Romans heißt er Ulrich, wobei man dann analog zu einem Romantitel von Max Frisch37 auch an einen Irrealis, an eine Fiktion durch den Autor denken darf – „Mein Name sei Ulrich“.
Im 34. Kapitel von Musils Roman – es hat die Überschrift „Ein heißer Strahl und erkaltete Wände“ – empfindet Ulrich einerseits Glückgefühle der Anpassung an gesellschaftliche Gewohnheiten: „Er floß wie eine Welle durch die Wellenbrüder, wenn man so sagen darf; und warum sollte man es nicht dürfen, wenn ein Mensch, der sich einsam abgearbeitet hat, in die Gemeinschaft zurückkehrt und das Glück empfindet, in die gleiche Richtung zu fließen wie sie.“38 Auf der anderen Seite bleibt jedoch das Mißtrauen gegenüber dem schon Vorgebildeten. „Es sind die fertigen Einteilungen und Formen des Lebens, was sich dem Mißtrauen so spürbar macht, daß Seinesgleichen, dieses von Geschlechtern schon Vorgebildete, die fertige Sprache nicht nur der Zunge, sondern auch der Empfindungen und der Gefühle. Ulrich war vor einer Kirche stehen geblieben. (…) Es waren nur Sekunden, die Ulrich vor dieser Kirche stand, aber sie wuchsen in die Tiefe und preßten sein Herz mit dem ganzen Urwiderstand, den man ursprünglich gegen diese zu Millionen Zentnern Stein verhärtete Welt, gegen diese erstarrte Mondlandschaft des Gefühls hat, in die man willenlos hineingesetzt wurde. (…) In diesem Augenblick wünschte er sich, ein Mann ohne Eigenschaften zu sein.“39
„Es sind die fertigen Einteilungen und Formen des Lebens“, Sprache und andere Traditionen, welche die Eigenschaften seines Ichs begrenzend bedingen, die Ulrich als Ich im Wir lebensnotwendig braucht und die ihm zugleich Angst machen. Nicht nur das Wagnis der Freiheit des sich selbst beobachtenden Ichs kann Angst einflößen – Dichter und Philosophen der Moderne sprechen dann von einem „Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens“40 oder einer „Geworfenheit ins Sein“41. Auch das Gegenüber des Gotteshauses, dieser Masse von Stein, welche die Allgegenwart Gottes ins Traditionell-Dogmatische formt und begrenzt, löst im Betrachter Angstgefühle aus: Gefühle der restlosen Bestimmung einer Ich-Illusion durch Tradition, Gewohnheiten, seit Jahrhunderten gebahnten Hohlwegen des Denkens und Verhaltens. „Ein feste Burg ist unser Gott“ heißt es in Luthers Kirchenlied; hier aber wird aus der schützenden Burg möglicherweise ein Gefängnis, von dem freilich die meisten der Insassen kaum ahnen, daß es eines ist, da sie ein sich eventuell distanzierendes Ich restlos an das „Wir“ abgegeben haben.42
Ein jedes Haus, in dem Menschen wohnen, trägt dazu bei, ihren Bewegungsraum zu begrenzen; zugleich aber ist es ein „schützendes“ Zuhause, das gleichsam auch das Ich der Bewohner definiert. Denn nicht nur für staatliche Behörden ist ein „fester Wohnsitz“ die unerläßliche Bedingung dafür, daß ein „Personalausweis“ (französisch „carte d’identité“) mit Hilfe „besonderer Kennzeichen“ dem Menschen eine Identität verschaffen kann. Wäre es eine Kirche, gleichsam als „fester Wohnsitz Gottes“, dann gälte für Gott das Gleiche. Und diejenigen, die sich dort einfinden, definiert das Gotteshaus als Christen; sie fühlen sich geschützt in diesem Haus, geschützt auch im „Wir“ mit den anderen, als Gemeinde; wie seinerzeit im Clan und seinen Gewohnheiten, seiner Sprache. Auch deswegen zitiert und wiederholt man dort gemeinsam bestimmte sprachliche Formeln, die seit Generationen sprachliche Gewohnheiten zu einem undurchdringlichen Netz verspinnen, das Schutz und Sicherheit verspricht. Denn man weiß auch, wenn man etwas ausreichend oft wiederholt, wird es zur Wahrheit. Und diese Gemeinde, im Islam die „Umma“ als Gemeinschaft der Gläubigen, dieses sich wöchentlich wiederholende Wir-Erleben im gemeinsamen Gottesdienst war auch einer der wesentlichen Gründe für die Missionserfolge im frühen Christentum und im frühen Islam. Die heidnischen Götter blieben vor allem unter sich, in ihrer eigenen Welt; der Gottmensch Christus hingegen hatte sich für die Menschen geopfert43 – das genügte, um ihm in einem sich gegenseitig stützenden „Wir“ zu folgen.
Der Gott, vor dessen Haus Robert Musils Ulrich einen Augenblick stehen blieb, ist ein christlicher Gott, also ein Europäer – Europäer sicherlich nicht nur im geographischen Sinne, denn Europäer haben schließlich „ad majorem gloriam“ ihres Gottes Regionen auch in anderen Erdteilen, wie vor allem Amerika und Australien, aber auch Afrika und Asien besiedelt, ihrem Gott dort Häuser gebaut und die Ureinwohner, die sich der augenscheinlichen Macht der Siedler und ihres Gottes nicht fügen wollten, meistens umgebracht. Viele Eingeborene verstanden wahrscheinlich auch nicht, warum man zu einem Gott nicht mehr außerhalb des Hauses beten durfte, in der Natur und im alltäglichen Leben. Besonders unverständlich aber war auch, daß die Priester dieser Religion fast alles, was im Leben Spaß machte, wie z.B. Sex und gutes Essen, unter dem bösen Wort „Sünde“ subsummierten und dafür ein gutes Leben nach dem Tode versprachen, wenn man sich nur vorher anständig, d.h. nach ihren Regeln verhielt. Diese Regeln sollten zur Gewohnheit aller Gläubigen werden, und zum Glauben an den einen und richtigen Gott war man verpflichtet; Abweichler nannte man Ketzer; sehr viel später, als neben der christlichen Religion weltliche Religionen, so genannte Ideologien, entstanden waren, nannte man sie Dissidenten. Beides war gefährlich, unter Umständen sogar lebensgefährlich.
Ungeachtet eines ursprünglichen und in der Glaubensgemeinschaft alles beherrschenden und fordernden Wir sagte der jüdische und christliche Gott jedoch schon zu Beginn Ich; und im Alten Testament der Bibel verlangte er sogar, daß es neben ihm keine anderen Götter geben dürfe. Dies mußte er freilich durch den Mund eines Stellvertreters auf Erden tun, denn in seiner Unendlichkeit war er zu einer geformten und ihn definierenden Mitteilung, eben jenem sprachlichen Ich, kaum in der Lage. Dieses von einem Gottkönig oder Propheten im Namen Gottes formulierte Ich bedeutete dann auch einen sehr konkreten weltlichen Machtanspruch, den man durchzusetzen hatte, denn Gott hatte es schließlich so verlangt.44
Moses, der im Auftrag Gottes dem auserwählten Volk die Tafeln mit seinen Gesetzen überreicht hatte, tat dies nach dem Vorbild seines ägyptischen Lehrers, dem Pharao Amenophis IV., genannt Echnaton; auch dieser war autoritärer Herrscher im Namen und Auftrag des einen Gottes. Viele Jahrhunderte später, als die Personalunion von Stellvertreter Gottes und weltlichem Herrscher längst zerbrochen war, man nannte das „Schisma“, und in Rom (und bis 1453 auch in Konstantinopel) ein Papst allein die Stellvertreterrolle zu spielen hatte, nannten sich einige Könige wenigstens noch „von Gottes Gnaden König“.
Die Regeln, nach denen Christen ihr Leben auszurichten hatten, galten dann also nicht nur im geographischen Europa, sondern auch in den Regionen anderer Erdteile, soweit man sie erobert, missioniert und von Heiden gesäubert hatte. Und in der unvermeidlichen Auseinandersetzung und Mischung mit den jeweils örtlichen Lebensformen eines vorchristlichen „Wir“ und des Polytheismus wurden diese Regeln zu Gewohnheiten. Schließlich war auch der Monotheismus anpassungsfähig; es gab die Möglichkeit, innerhalb der Dreieinigkeit des Göttlichen Maria, die Mutter Gottes, als vorstellbare Person anzubeten, oder Jesus, als eine sogar Sohn gewordene Form Gottes. Außerdem gab es die Heiligen, irgendwann einmal von uneinsichtigen Heiden totgeschlagene Märtyrer, die dafür von der Kirche belohnt worden waren und nun angebetet werden konnten; sie waren, wie vordem die vorchristlichen Götter, in der Regel für unterschiedliche Bereiche des Zusammenlebens und der Natur zuständig.45
Indessen hatte laut Altem Testament das machtvolle und stellvertretend für Gott geäußerte Ich zunächst einmal Bedeutung für die Autorität von Moses, in der Aufgabe, die ihm anvertraute Menschenherde zusammenzuhalten und auf den richtigen Weg zu führen – in das Land Kanaan, von dem es hieß, daß dort Milch und Honig fließe. Für die Christen war dieses paradiesische Land, in welches sie sich vertrauensvoll von ihren Priestern führen lassen wollten, nach dem großen Schisma des Mittelalters freilich etwas weiter entfernt – im Jenseits. Und um dorthin zu gelangen, mußte man sich, wie gesagt, zunächst lebenslänglich an die Regeln halten und der priesterlichen und weltlichen Macht gehorchen.
Eine der wichtigsten ein Ich definierenden Eigenschaften ist der Name. Wenn jedoch im sechsten Gesang von Homers Odyssee der betrunkene Polyphem den listenreichen Odysseus nach dem Namen fragt und dieser mit „Niemand“ antwortet, ist es ein Name, der sich selbst aufhebt: Denn als der geblendete Polyphem seine Kollegen um Hilfe ruft und dies begründet: „Niemand hat …“, verhallt sein Ruf im Leeren. Der Name als „Nichtname“ steht damit z.B. auch im Gegensatz zur Mitleidsfrage von Wolframs Parzival, die nur dadurch wirken kann, daß sie empathisch ein Du beim Namen nennt und damit identifiziert: „Oeheim, waz wirret dir“? Der Name ist hierbei eine Verwandtschaftsbezeichnung, der auch die beginnende Zugehörigkeit Parzivals zur Gralsgemeinschaft ausdrückt.
Namen einer dem europäischen Ich vorhergehenden oder einer außereuropäischen Wir-Kultur definieren nicht notwendig schon ein Individuum. Oftmals weist der Name seinem Träger eine gesellschaftliche Rolle zu, bzw. ist er aus der Rolle entstanden, die sein Träger oder einer seiner Vorfahren spielte. Evident ist dies bei Familiennamen, die ein Handwerk bezeichnen, wie Bäcker, Schneider, Schuster, Schreiner, Schmied, Metzger usw. Möglich waren auch Namen, welche einen Ort bezeichneten, wo der betreffende zu finden war, und der ihn dadurch ansprechbar machte: Bergsträßer, Talheimer, Seehofer usw. Andere Namen verweisen nur auf die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht wie Ritter, Bürger oder Bauer, oder auch einem Clan, einer Familie so z.B. Johannsen oder Albertsen. Dies hieß dann: Das ist der Sohn von Johann, bzw. von Albert, und jeder wußte also, mit wem er sprach, und Johann und Albert wußten, wohin sie gehörten.
Einen Namen zu nennen bedeutet, über dessen Träger zu verfügen, Macht auszuüben. Den Teufel – er ist ja des „Chaos wunderlicher Sohn“46 – beim Namen nennen, heißt ihn identifizieren, definieren, personalisieren, dann muß er kommen, erst dann ist er der „Leibhaftige“. Im Märchen vom Rumpelstilzchen kann das Kind den bösen Geist besiegen, nachdem es ihn belauscht hat und nun seinen Namen nennen kann. Um die latente „Aggressivität“, den Machtanspruch namentlicher Anrede aufzuheben, reicht man sich in europäischen Ich-Kulturen zur Begrüßung die rechte Hand: Es ist die Schwerthand, d.h. man hat die Waffe vorher abgelegt. In asiatischen Kulturen ist es die Verbeugung, mit der man sich begrüßt, oft (wie in Indien) mit gefalteten Händen47.
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts ist Wolframs Parzival in der ersten Phase seiner Gralssuche noch kein selbstverantwortliches Individuum; er ist Ritter der Artusrunde und folgerichtig zur namentlichen Anrede, z.B. einer „Mitleidsfrage“, noch nicht in der Lage; Wolfram kennzeichnet damit auch den gleichsam zu seiner Zeit schon als „vormodern“ empfundenen Zustand einer Kollektivgesellschaft. Von einer anderen Kollektivgesellschaft, den PirahâIndianern am Amazonas, wird zirka 800 Jahre später berichtet, daß sie in der Wahrnehmung ihrer Umwelt in einer konsequenten Gegenwart leben. „Was die PirahâIndianer interessierte, war nicht die Identität der ankommenden oder abfahrenden Person, sondern das Verschwinden und Auftauchen.“48 „Für die Pirahâ ist ein Mensch nicht in allen Phasen des Lebens derselbe. (…) ‚Meinst du mich? Mein Name ist Tiápahai. Einen Kóhoi gibt es hier nicht: Früher hieß ich Kóhoi, aber der ist jetzt weg, und dafür ist Tiápahai da.‘“49 Entsprechend der augenblicksgebundenen Variabilität der Namen werden in ihrer Sprache auch Verallgemeinerungen und Abstraktionen wie z.B. Zahlen und Farben vermieden. Vorgänge in einer nicht selbst erlebten Vergangenheit interessieren nicht – ihre Sprache kennt kein Perfekt und folgerichtig auch kein Futur, das nicht direkt auf die Gegenwart bezogen ist: „Ich habe von den Pirahâ kein einziges Mal gehört, sie würden sich Sorgen machen. Soweit mir bekannt ist, gibt es für „Sorge“ in ihrer Sprache überhaupt kein Wort.“50 Christlich eschatologisches Denken, das mit der Gotik gegenwärtiges Erdenleben zunehmend als „Jammertal“ empfindet und sich um eine Erlösung in einer (niemals Gegenwart werdenden) Zukunft sorgt, ist ihnen völlig fremd. Wer will auch wissen, wie man morgen „heißt“?
Vergleichbares hören wir von den Yamomani-Indianern im nordbrasilianischen Regenwald: Wenn man dort einmal den Namen Lukas hört, haben sie ihn sich für die Weißen ausgedacht. Untereinander nennen sie sich nur Bruder, Mutter, Tochter und sind sich darüber hinaus namenlos nahe. Eine Privatheit im europäischen Sinne, welche z.B. in einem „Einzelzimmer“ (eine europäische Erfindung) ein Individuum und damit einen Namensträger definieren könnte, kennen sie nicht. „Bei den Yanomami lebt das ganze Dorf unter einem Dach. In Watoriki sind es 165 Männer, Frauen und Kinder. Das traditionelle Rundhaus, Maloka genannt, ist ein überdachter Reif, der einen freien Platz aus gestampfter Erde einfaßt. (…) es gibt keine Hauswände. Jede Familie hat eine offene Feuerstelle, um die sie herum ihre Hängematten spannt.“51 In den Runddörfern der Hakka in Chinas südöstlichen Provinzen Fujian, Guangdong und Jiangxi leben die Menschen in jeweils bis zu vierhundert Räumen, Familien jeweils in Zimmern übereinander, die durch eine von jedem einsehbare Außentreppe verbunden sind. Im Parterre des Rundbaus liegen die über vierzig Koch- und Backstuben des Clans; sie sind zugleich die Wohnzimmer, in denen sich gemeinsam der Alltag abspielt.52
All dieses sind Beispiele außereuropäischer Kollektivgesellschaften, die sich auch in Afrika53 und Asien nachweisen lassen und in denen der Eigenname kaum eine individualisierende Rolle zu spielen hat: „Der Mensch lebt nahe seiner sozialen Umgebung und ist in die Gruppe integriert. (…) Dies verhindert die Entwicklung eines klaren Ich-Standpunktes.“54 Interessant ist in diesem Zusammenhang der quasi europäische Stoßseufzer eines französischen Autors libanesischer Herkunft: „Ein jeder von uns sollte ermutigt werden, seine eigene Verschiedenartigkeit zu akzeptieren und seine Identität als die Summe unterschiedlicher Zugehörigkeiten zu begreifen, anstatt sie mit einer einzigen zu verwechseln, die als höchstmögliche Zugehörigkeit und als Mittel der Ausschließung zum Mittel des Krieges werden kann.“55
Im Islam hat Allah einhundert Namen, davon kennen die Menschen aber nur neunundneunzig56, denn Gott als der Unendliche ist schließlich nicht restlos zu identifizieren. Wenn nach der Aussage des Sufismus nur Allah das Recht hat, „Ich“ zu sagen, weist auch dies sicherlich auf kollektive soziale Verhältnisse hin, die dieser Aussage zu Grunde liegen.57 Im Unterschied zur europäischen Ich-Kultur, die sich seit der Gotik aus den kommunitaristischen Formen des frühen Christentums entwickelt hat58, sind die Kulturen des Islam im Großen und Ganzen bis heute Wir-Kulturen geblieben.
Im christlichen Sakrament der Taufe wird der Täufling mit einem Namen für Gott und die Menschen identifizierbar und wird zugleich erkennbar als Mitglied der Gemeinde. Sicherlich ist die Taufe bereits in den ersten christlichen Jahrhunderten auch ein allererster Beginn europäischer Ich-Werdung, wenn auch in der Kirche dieser Zeit, bedingt durch den Kontext der römischen Kollektivgesellschaft, kommunitaristische Elemente noch deutlich waren, wenn z.B. alle Mitbewohner des Hauses, einschließlich der Sklaven, anläßlich der Taufe des Hausherrn gleich mitgetauft wurden.59 Im Gegensatz dazu kennt der Islam keine Taufe; nach Allahs Gesetz wird jeder Mensch mit der Anlage zum Islam geboren, wichtig ist dann allein, daß er sich der Gemeinschaft der Gläubigen einfügt – durch Beachtung ihrer Gesetze.
Der Name also, sowohl in der christlichen als auch in der muslimischen Gesellschaft, bedeutet zunächst Integration in das dementsprechende Rechtssystem und die Moralgesetze; der Vermerk im Namensregister auch der säkularen Gesellschaft ist somit auch ein wesentlicher Schutz vor dem Selbstverlust und einem ungewissen Anderen. In Verbindung mit der nachweisbaren „stabilitas loci“, dem „festen Wohnsitz“, garantiert er dem Ich „Identität“, d.h. Einordnung in ein Wir. Eine der härtesten Strafen in den vergangenen Jahrhunderten war darum die Verbannung aus diesem gewohnten und Schutz gewährenden gesellschaftlichen Kontext, vom Exil des römischen Dichters Publius Ovidius Naso in Constanta (heute Tomis) am Schwarzen Meer, über Acht und Bann zahlloser Ritter des Mittelalters bis zum Exil französischer Sträflinge im tropischen Guyana, zu Stalins Lagern in Sibirien und dem Schicksal europäischer Juden in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts in den Konzentrationslagern der Nazis.
Sind zahlreiche Pogrome oder sogar Genozide in den vergangenen Jahrhunderten, unabhängig vom kulturellen Ambiente einer außereuropäischen Wir- oder einer europäischen Ich-Kultur, einem Phänomen geschuldet, bei dem sich eine Gruppe oder sogar größere Zahl von Menschen plötzlich in einen blutgierigen aggressiven Mob verwandelt60, so bringen moderne Technologie und effizientes Verwaltungshandeln im 20. Jahrhundert deutliche „Fortschritte“. Schon die „Säuberungen“ Stalins sind verbunden mit organisiertem Verwaltungshandeln. Hat die so genannte Kristallnacht 1938 noch den Charakter eines, wenn auch staatlich geplanten und ermöglichten zerstörerischen und menschenfeindlichen Rauschs durch einen fanatisierten Mob, der zum Teil auch aus am Vorabend noch unbescholtenen und liebenswürdigen Bürgern bestand, so war die Shoah Musterbeispiel langfristiger, differenzierter und effizienter Planung, eine formale Begabung, für welche die Deutschen im Ausland ja heute noch oft bewundert werden. Und wie steht es um die Moral – immerhin in einer zivilisierten Gesellschaft, die man gerne auch als Kulturnation bezeichnet?
Unabhängig von einer Wir- oder Ich-Kultur gilt dabei, daß Moral keine primär individuelle Kategorie ist, sondern aus gesellschaftlicher Gewohnheit entsteht.61 Wenn der Priester oder die Inquisition sie individuell vom Beichtkind einfordert und ihre Beachtung kontrolliert, sehen sie sich als Funktionäre eines globalen kirchlichen Man. Wenn in der Moderne Staat und Kirche sich getrennt haben, kann Moral immer noch von einem säkularen Man bestimmt werden, z.B. durch eine national-sozialistische „Volksgemeinschaft“; die Offiziere des NKWD, der Gestapo, der Stasi etc. agieren dann quasi als Beichtväter einer säkularen Gemeinschaft, in welcher die Partei, d.h. die von der Obrigkeit verwaltete Ideologie, immer recht hat. Was „alle“ für richtig halten, z.B. die Vernichtung „lebensunwerten Lebens“, kann dann doch nicht falsch oder gar unmoralisch sein?
Schon bald nach der Machtübernahme durch die Nazis begann die gesellschaftliche Desintegration jüdischer Mitbürger durch Kündigung aus dem bisherigen Beruf.62 Der später folgende Zwang, im Paß einen jüdischen Vornamen eintragen zu lassen und einen aufgenähten Stern zu tragen, entsprach einer zwangsweisen und öffentlich sichtbaren Zuordnung zu einer Gruppe von Menschen, die von der staatlichen Propaganda systematisch als minderwertig gekennzeichnet wurde. Die nächste Stufe war der Verlust der Wohnung und der persönlichen Habe, Trennung der Familie und Deportation in ein KZ. Im KZ verlor man auch noch den Namen: Man war nur noch die eintätowierte Nummer; auch die KZ-Wächter durften nicht mit Personennamen angeredet werden, sondern nur mit ihrem militärischen Rang. Am Ende ging es dann folgerichtig nicht mehr um „Mord“ und um „Mörder“, sondern nur noch um einen von staatlichen Funktionären im Namen der „Volksgemeinschaft“ und des Führers befehlsgemäß ausgeführten Verwaltungsakt, bei dem Nummern ausgelöscht wurden.
Dem physischen Tod war ein systematisch geplanter, stufenweiser Entzug aller Faktoren vorausgegangen, die ein durch Namen, Familie, Beruf und Wohnung gesellschaftlich geformtes „Individuum“ bedingen.