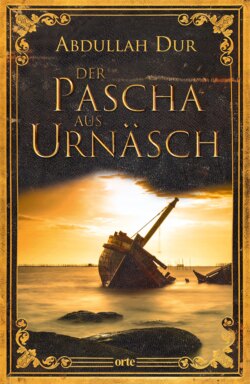Читать книгу Der Pascha aus Urnäsch - Abdullah Dur - Страница 5
ОглавлениеUeli Kurt aus Urnäsch
In den Wintermonaten lag in Urnäsch, einem kleinen Dorf in der Ostschweiz am Fuss des Säntis, alles unter einer dicken Schneedecke begraben. Mitte des 19. Jahrhunderts floss das Leben ohnehin etwas gemächlicher dahin als heute, doch in der kalten Jahreszeit versank das Dorf noch mehr in Ruhe und Verschlafenheit. Die Frauen widmeten sich der Handarbeit, strickten und spannen Wolle, die sie im Sommer gewaschen und gekämmt hatten, und wenn den Männern neben ihren ausgiebigen Plaudereien im Wirtshaus noch unausgefüllte Stunden blieben, gingen sie auf die Jagd oder tauschten an Haus und Stallungen Bretter aus, die es nötig hatten. Endlich hatte man die Musse, durchgesessene Polster und abgewetzte Kissen auszubessern und zerrissene Kleidung zu flicken, damit man sie zukünftig wieder tragen konnte. Die Tiere im Stall wurden mit dem in den Scheuern aufgetürmten Heu gefüttert und warteten geduldig auf die Schneeschmelze.
Es war auch die Jahreszeit, in der die Männer ihre Kostüme und Masken für das Silvesterklausen richteten, ein traditionelles Fest, das man jeweils am 13. Januar beging. Diese Kostüme und Masken wurden hauptsächlich aus Dingen gefertigt, die man im Wald fand, von Baumrinde über Tannenzapfen bis hin zu dürren Halmen, Moos und Flechten. Man wetteiferte darum, das beste, das prächtigste Kostüm herzustellen und liess dabei seiner Fantasie freien Lauf. Mit den Masken verjagte man die bösen Geister – so erklärten es die Alten – oder man nutzte die Gunst der Stunde, um jemandem unerkannt seine Liebe zu gestehen oder umgekehrt seine Abneigung ins Gesicht zu schleudern oder Dinge zu sagen, die einem sonst die Schamröte ins Gesicht getrieben hätten.
Ein guter Teil der Männer versammelte sich regelmässig um den Ofen der Dorfwirtschaft, um über alles und jeden zu reden. In ihren Gesichtern las man die Zufriedenheit mit ihrem Leben. Ein freundlicher Zug lag ihnen um den Mund, mochte es in manchen Haushalten auch am Mehl für die Suppe fehlen. Die meisten hatten kein Geld in der Tasche, um ihre Zeche zu bezahlen, doch der Wirt Jörg Müller zog einfach sein dickes, zerknittertes Heft hervor und notierte die Schuld. Während er das tat, pflegte er dem Gast tief in die Augen zu blicken und zu murmeln: «Oh du lieber Jesus, warum kommen Leute ohne Grips und Geld ausgerechnet in mein Gasthaus!» Man wusste nicht recht, ob er sich mit diesem Spruch über seine Gäste lustig machen oder zu Gott klagen wollte. Hatte einer seinen Kreditrahmen wirklich überschritten, ermahnte er denjenigen höflich und riet ihm, gegen den Durst besser Schnee zu schlecken. In solchen Momenten wandte sich einer der Dorfbewohner an den zahlungsunfähigen Gast und meinte, wenn er keinen Geschmack an Schnee fände, solle er eben Jörg Müller den Hintern ablecken, was regelmässig lautes Lachen und Grölen hervorrief. Trotz alledem fand sich immer jemand, der dem Betroffenen ein Gläschen spendierte.
Am stillsten war es in der Wirtschaft, wenn einer, der lesen und schreiben konnte, den anderen die Appenzeller Zeitung vom Anfang bis zum Ende laut vorlas. Der Vorleser trug den gesamten Inhalt der Zeitung vor, ohne dessen müde zu werden, und die übrigen Gäste lauschten ihm aufmerksam wie dem Pfarrer.
In den Wintermonaten rauchten alle Schornsteine, und der Geruch nach Holzfeuer erfüllte das ganze Dorf. Die Kinder versammelten sich um die knisternden Tannenscheite, um den Geschichten der Ältesten zu lauschen und auf eine lange, geheimnisvolle Reise zu gehen. Diese Geschichten begleiteten sie ein Leben lang, und wenn sie selbst alt wurden, gaben sie die Erzählungen an die nächste junge Generation weiter.
Ueli Kurt hatte diese Nacht sehr schlecht geschlafen. Im Traum hatte er sogar gemerkt, dass er schlief. Es waren so schreckliche Träume gewesen, dass er nicht wusste, ob er besser weiterschlafen oder aufwachen solle, um sie abzuschütteln. Er wurde von Ungeheuern verfolgt, kletterte andauernd auf die höchsten Gipfel, um ihnen zu entkommen, sprang dann ins Leere und begann zu fliegen, um seine Verfolger abzuhängen. Bisweilen verlor er das Gleichgewicht und drohte abzustürzen, wedelte dann wie ein Vogel mit den Armen und flog noch höher hinauf. Wenn er sich umdrehte und seine Verfolger nicht mehr sah, erfüllte ihn grosse Erleichterung und Stolz. Aber plötzlich tauchten die Ungeheuer wieder auf und zwangen Ueli, in noch grössere Höhen aufzusteigen und schneller zu fliegen. Diese Verfolgungsjagd ging immer so weiter.
Diese Alpträume hatte er seit seiner Hochzeit im Jahr 1842. Hätte er diese Träume schon früher gehabt, hätte er ganz sicher in seinem Tagebuch davon erzählt, das er seit seinem zwölften Lebensjahr führte. In dem Tagebuch ging nichts verloren, im Gegenteil, manches wurde mit der Zeit mehr, erlangte tiefere Bedeutung und nahm eine Gestalt an, die Ueli selbst kaum noch begriff. Sein Tagebuch war sein engster Freund und Gefährte. Die darin festgehaltenen Erinnerungen waren wie ein Lebewesen, das zu ihm sprach und ihm sein Herz ausschüttete.
Als Ueli seiner Frau Rösli von den schrecklichen Alpträumen erzählte, interessierte sie sich vor allem für die Ungeheuer: Wer waren sie, wem glichen sie? Ueli konnte sich nicht entscheiden, ob er die Ungeheuer mit Mensch oder Tier vergleichen oder wie er sie bezeichnen sollte. Ihm kam es so vor, als müsste er sonst lügen.
Als Rösli seine Unentschlossenheit merkte, fing sie sofort an, den Traum zu deuten: «Gott erhöht den Menschen, den er liebt. Dass du in die Höhe fliegst, ist ein Zeichen für den Wert, den Gott dir beimisst. Die dreckigen Ungeheuer, die dich verfolgen, sind deine Sünden. Aber sie erwischen dich nicht, denn du stehst unter Gottes Schutz und bist sein geliebter Knecht. Du musst öfter zu Pfarrer Johannes in die Kirche gehen.»
Die Kommentare des Pfarrers deckten sich praktisch mit denen seiner Frau. War das nicht der Beweis für die Richtigkeit dieser Deutung? Ueli versuchte herauszufinden, welche schmutzigen Sünden ihn in Gestalt von Ungeheuern verfolgten, und überlegte, ob es die Flüche sein konnten, die er ausstiess, wenn Ziegen und Schafe ihm nicht gehorchen wollten.
Doch was ihn an diesem Morgen aus dem Schlaf riss, waren nicht die Alpträume, an deren Auftreten er bereits gewöhnt war, sondern das Weinen seines Töchterchens Maria im Zimmer nebenan. Es war der 13. Januar, und er musste noch im Dunkel der Nacht aufstehen, sein Groscht, den mit Tannenzweigen geschmückten Mantel, anziehen, seine Maske aufsetzen und sich die Schellen über die Schulter hängen, um sich dann mit den Kameraden zu treffen. Es war der Tag des Silvesterklausens. In den frühen Morgenstunden gingen er und seine Freunde in ihren selbstgemachten Groscht von Haus zu Haus und liessen dabei die schweren Schellen erklingen, die sie über der Schulter trugen. Seit seiner Kindheit erwartete er den 13. Januar stets mit grosser Vorfreude. Das ganze Dorf im Morgengrauen mit dem Läuten der Schellen aus den Federn zu holen und bei Geplauder und Scherzen den gereichten Schnaps zu trinken, war ein unvergleichliches Vergnügen.
Sofort sprang er auf und stürzte in Marias Zimmer. Sie sass im Bett und schluchzte mit erstickter Stimme.
«Was hast du denn, mein lieber Schatz? Warum weinst du so?»
«Ich hab versucht, keinen Lärm zu machen, aber mein Knie tut so arg weh. Ich wollte dich nicht aufwecken.»
In der Dunkelheit nahm Ueli das Gesicht des Kindes in seine Hände und küsste es auf die Stirn. Als er das nasse Gesicht spürte, krampfte sich etwas in ihm zusammen. Mit den Lippen ganz nah an ihrem Ohr flüsterte er: «Weisst du, du bist ein sehr kluges und besonnenes Kind. Weinen ist doch kein Lärm! Wenn du nicht geweint hättest, hätte ich dich nicht gehört, und dann hätte ich dir auch nicht helfen können. Warte mal, jetzt überlege ich, was ich gegen deine Schmerzen tun kann. Ausserdem ist heute das Silvesterklausen, da wollte ich sowieso früh aufstehen. Gut, dass du mich aufgeweckt hast.»
In der Dunkelheit tastete er nach der Öllampe. Erst spät fiel ihm ein, dass fast kein Öl mehr da war. Insgeheim stiess er einen derben Fluch aus. Deswegen nämlich sass die Familie seit drei Wochen abends noch eine Weile vor der leuchtenden Glut des Ofens, bevor man zeitig zu Bett ging. Noch nicht einmal Geld für Kerzen war da. Er löste den Riegel am Fenster, um die Läden zu öffnen. Draussen schneite es dicke Flocken. Ein trübes Licht, eiskalte Luft und einige Schneeflocken drangen in den Raum. Eine Weile schaute er dem Treiben der Schneeflocken zu.
«Vater, lass das Fenster auf! Die kalte Luft hat geholfen. Auf einmal tut es weniger weh!»
«Aber das geht doch nicht, mein Blüemli, im Zimmer ist es ja schon eiskalt.»
Ueli hob die Decke und machte sich daran, das Knie des Mädchens zu massieren, wie er es jeden Abend tat. Der Umschlag, den seine Frau Rösli jeden Abend mit Maismehl machte, war im Bett aufgegangen. Er versuchte, ihn wieder anzulegen, aber die Maispaste war zu trocken. Und die Beine des Kindes waren heiss wie Feuer.
«Im Zimmer ist es bitterkalt, aber deine Beine sind glühend heiss. So heiss haben sie sich noch nie angefühlt.»
Maria fragte flüsternd: «Vater, kannst du meine Beine in den Schnee stecken?»
Auf die Idee war er nicht gekommen. Er nahm das Mädchen auf den Arm und ging zur Tür. Draussen rollte er ihr das Nachthemd nach oben, um die verkrüppelten Beine in den Schnee zu stecken. Es war mitten in der Nacht. Maria hatte den Blick an den Vater geheftet. Dann steckte sie auch noch ihre keineswegs verkrüppelten Arme und die geschickten Hände in den Schnee.
«Ah, das tut gut! Wie schön wäre es, hier im Schnee zu schlafen!»
Ueli brachte sein Töchterchen wieder zurück ins Bett. Gleich weichte er die eingetrockneten Maismehlumschläge mit etwas Wasser auf, knetete sie durch und legte sie dem Kind wieder ums Knie. Ihre Beine waren nun recht kalt. Er deckte sie gut zu. Dann beobachtete er noch einmal die Schneeflocken, die vor dem Fenster munter tanzten. Draussen war im Mondlicht alles in ein russiges Weiss getaucht. Wenn im Winter das Spitzli hinter den Häusern so völlig weiss war, hatte er seit seiner Kindheit einen riesigen Schneemann in ihm gesehen. Der Berg direkt hinter den Häusern war der dicke Bauch dieses riesigen Mannes. Nun drückte er die Nase gegen die Fensterscheibe, um auf der Bergkette den Schneemann zu suchen, der lang ausgestreckt am Fuss des Säntis dalag, als sei er müde vom Laufen. Im Mondlicht konnte er den Bauch und die Arme des Schneemanns sehen, aber sein Kopf war hinter den dicken Schneeflocken verschwunden. Maria war inzwischen eingeschlafen. Ueli hörte die ruhigen Atemzüge des Mädchens. Offenbar hatte ihr die Kälte tatsächlich gut getan.
Seit Maria auf der Welt war, mochte sie den Winter sehr. Sie war ja auch in einem Februar im Wald am Kleinberg geboren. Ueli Kurt war in den Wintermonaten, wenn kaum jemand einen Zimmermann brauchte, mit Arbeiten an seinem eigenen Haus beschäftigt. Das Haus, in das er mit seiner Frau frisch eingezogen war, hatten sein Vater und sein Schwiegervater, der zugleich sein Onkel war, für das junge Paar gebaut. Es war klein, aber sehr gemütlich geworden. Zusammen mit seinem Grossvater hatte Ueli sämtliche Zimmermannsarbeiten selbst verrichtet. Und da es sein eigenes Haus war und er Schnitzwerk sehr liebte, hatte er an vielen Stellen des Hauses Verzierungen angebracht. Von den Türzargen bis hin zu den Fensterumrandungen war alles mit geschnitzten und bemalten Rosenmustern verziert. Das Holzhaus stand auf einem gemauerten Sockel von einem halben Meter Höhe, den sein Vater, ein Maurermeister, errichtet hatte. Auch die hölzerne Aussenfassade war mit Bildern von Rosen und Vögeln geschmückt.