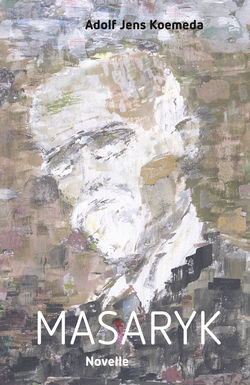Читать книгу Masaryk - Adolf Jens Koemeda - Страница 11
5 Besuch in Hoff
ОглавлениеIch bin Deutsche, eine Bayerin, und basta. In ländlicher Gegend aufgewachsen, damit habe ich keine Probleme. Wenn es bei uns ein Fest gibt und es sein muss, ziehe ich sogar ein Dirndl an, ganz frech, ohne Hemmungen. Dass ich als Kind gleich gut tschechisch gesprochen habe, weiß hier wahrscheinlich niemand.
Anders die Mama.
Die sitzt zwischen Stuhl und Bank und leidet oft: Im Winter mehr als im Sommer, wenn das Reisen einfacher ist. Der Vater versucht, sie immer wieder zu trösten, es hilft leider nicht viel. Jetzt, nach ihrer Pensionierung, zieht sie die alte böhmisch-deutsche Heimat häufiger an als vor zehn oder zwanzig Jahren. Es ist nicht nur eine Frage der größeren Zeitreserven, über die sie nun verfügt, es hängt vermutlich auch mit dem Alter zusammen, mit der Sehnsucht nach der unbeschwerten und sorgenlosen Zeit ihrer Kindheit.
Seit etwa einem Jahr reist meine Mutter einmal in zwei Monaten nach Vojtyn. Und sie liest – das ist nun völlig neu – tschechische Bücher, vor allem Klassiker der Moderne, zum Beispiel Nezval, Hrubín und Čapek … nein, noch keine brisante Gegenwartsliteratur. Historische Bücher interessieren sie ebenfalls mehr als früher, in erster Linie Werke aus der Masaryk-Zeit. Sie möchte mir oft spannende Passagen vorlesen, ab und zu bin ich dabei, häufiger suche ich allerdings eine passable Ausrede.
Ihre erwachte Tschechophilie ist, glaube ich, der wesentliche Grund, warum sie mich immer wieder wegen Pavel ausfragt, ja, mir stellenweise Druck macht. Ihr wäre wahrscheinlich am liebsten – sie sagte es noch nicht direkt, ich spüre es aber –, wenn wir uns als Paar finden würden, am besten gleich.
Telefon. Mama nahm ab:
– Ein Anruf aus Vojtyn.
– Ja? Wer hat angerufen, Mamm?
– Milena … warum?
– Nur so.
Ein wenig enttäuscht war ich schon. Ich fragte später, wie sie das sehe: Sei es ihr egal oder wäre ihr lieber, wenn ich einmal mitkäme?
– Zu zweit wäre es sicher schöner, Laura. Aber es müsste für dich stimmen, entscheide selbst.
– Milena hat diesmal angerufen, nicht Pavel. Dann ist es für mich klar.
Kurz gesagt: Mama fuhr alleine, ich verzichtete allerdings nur ungern auf diese Reise. Immerhin, Pavel habe einige Male nach mir gefragt, hörte ich später; und er lasse mich herzlich grüßen.
– Grüßen? War das alles, Mamm?
– Ja.
Aber eine interessante Nachricht brachte Mama von ihrer Tschechienreise schon: Andulka, die Ex-Partnerin von Pavel, habe einen neuen Freund.
Und: – Na ja … sie muss es nicht so eilig haben, sie ist mehr als fünfzehn Jahre jünger als Pavel.
– Was, Mamm, wieviel?!
– Fünfzehn.
– Fünfzehn!
Das war ein Schock! Fast die ganze Nacht konnte ich nach dieser Mitteilung kein Auge zudrücken.
Am nächsten Tag fragte ich Mama bereits beim Frühstück, ob sie wisse, warum sich die beiden getrennt haben? Sie wusste es nicht. Über das Thema wurde in Vojtyn nicht gesprochen, sagte sie; und sie hatte sich natürlich gehütet, in diese Richtung zu bohren.
Bitte: fünfzehn Jahre jünger!
Nein, das können Männer gar nicht verstehen. Höchstens intellektuell und rein theoretisch … nicht einmal das.
Aus! Traurig, aber wahr.
Für mich ging nun der kleine Flirt mit Pavel zu Ende, so viel Realitätssinn schrieb ich mir zu. Mama sah meine Traurigkeit – ob sie den wahren Grund erfasst hatte, wusste ich nicht –, sie fragte mich allerdings nicht aus, und ich verlor über Pavel kein Wort mehr.
Etwa eine Woche später die Überraschung: Ein Brief!
Pavel schwärmte von der Begegnung mit Mama und bedauerte sehr, dass ich diesmal nicht mitgekommen war, damit habe er doch hundertprozentig gerechnet. Er legte auch ein paar Fotos von unserem letzten Besuch bei; ich gab zu, gelungene Aufnahmen.
Meine Antwort sendete ich ihm sofort; E-Mail, natürlich. Darauf reagierte er nicht. Sein Schreiben bekam ich erst ein paar Tage später – komisch, wieder ein Brief. Ich schüttelte den Kopf und war trotzdem froh.
Er komme gerne vorbei, schrieb er. In Kossau gäbe es ein Handballmatch, ziemlich wichtig, das wolle er sich nicht entgehen lassen. Zwei Jungs aus seiner Juniorenmannschaft reisen zwar mit, wir könnten uns aber trotzdem treffen … wenn ich das einplanen wolle.
Ja, ich wollte. In meinem Brief gab ich mich eher zurückhaltend. Ich versuche es einzurichten, teilte ich ihm mit, wenn er das organisieren könne und seine Junioren nicht rund um die Uhr betreuen müsse. (Ich schrieb ihm eine E-Mail, wie in meiner ersten Mitteilung; gezielt irritieren wollte ich ihn natürlich nicht.)
Und jetzt ein bisschen ausführlicher, Herr Durbach, damit Ihr Bild von Pavel noch plastischer wird.
In seinem letzten Schreiben hatte er gestanden, dass er Mails nicht möge. In der Berufskorrespondenz könne man sie leider nicht abstellen, im privaten Bereich sei es aber bei ihm anders: Ein handgeschriebener Brief sei in seinen Augen die liebevollere und intimere Variante der Kontaktaufnahme … ganz abgesehen von der Sprache. Die sei in den Mails oft miserabel, als ob die Mail-Schreibe eine grüne Karte für die Wortgewalt von Zweitklässlern wäre. Ja, im Privaten ziehe er die schönere und vor allem höflichere Form des Briefeschreibens vor. Und die Schnürlischrift, per PC erzeugt, halte er für eine Täuschung und Frechheit.
Gut, dachte ich, das ist dein Recht. Ich möchte dir aber weiterhin meine Mitteilungen mailen, bitteschön, wie ich es gewöhnt bin, normal, modern: elektronisch. Hoffentlich habe er nichts dagegen.
In den nächsten Tagen bekam ich von ihm eine Mail, allerdings mit einem problematischen Inhalt: Er könne nicht kommen, es tue ihm sehr Leid. Grippe, hohes Fieber, er liege im Bett und schwitze.
Schade!
Ich meldete mich sofort und wünschte ihm – selbstverständlich elektronisch – eine baldige Genesung.
Die Korrespondenz kam langsam in Schwung; nichts Ernstes, oft nur Witze, kurze Kommentare und harmlose Blödeleien. Mama freute sich aber über diesen schriftlichen Austausch, sie wollte die Briefe auch lesen, die meisten bekam sie … die meisten? Nein, eigentlich fast alle, da gab es nichts Intimes, das ich vor ihr hätte verstecken müssen.
Fünfzehn Jahre Altersunterschied, fast eine Generation jünger als ich war die Gute. Nicht einfach für mich. Gar nicht!
Ich fühlte mich ziemlich verunsichert und gab mich in meinen Mails frech und kumpelhaft; das Spaßig-Lockere unseres Briefwechsels passte mir ganz gut. Meiner Mutter weniger.
– Was soll das, fragte sie mich einmal. – Dieses Blödeln dauert schon mehrere Wochen. Ihr übertreibt ein bisschen!
In einem seiner Mai-Briefe vom letzten Jahr war ausnahmsweise kein Foto beigelegt. Pavel teilte mir nur mit, dass er nach Hoff kommen wolle. Dort spielten am Wochenende in einer deutschen Mannschaft zwei tschechische Junioren, die er gerne in seine Gruppe holen würde; vorher müsse er sie natürlich in Aktion sehen. Bei dieser «Dienstreise» könnten wir uns mal treffen … wenn ich möchte.
Schön! Ich war nicht dagegen und rief ihn an.
Ich lud ihn zu uns zum Abendessen ein. Er zierte sich, er wollte uns keine Umstände machen, er habe an ein Lokal im Zentrum gedacht, ich könne wählen.
Danke! Das tue ich gerade, Pavel: bei uns. Er dürfe allerdings auch wählen; zum Beispiel, was er gerne auf dem Teller hätte, Böhmisches oder Bayerisches.
In Ordnung, meinte er, er komme gerne und wähle Böhmisches. Er müsse schauen, ob ich, als Neu-Bayerin, die gute kulinarische Basis aus Böhmen noch einwandfrei beherrsche.
Nicht schlecht! Er freute sich möglicherweise gleich wie ich, so klang es zumindest in meinen Ohren.
Zu Hause gab es einen Klassiker: Schweinebraten mit Semmelknödeln und Sauerkraut, «vepřo, knedlo, zelo», wie er das nannte.
Es war ein gemütlicher Abend zu fünft, Mutter, Vater, Marcelka, Pavel und ich. Er musste der Mutter versprechen, dass er wiederkommen werde, bald, am besten in diesem Sommer. Er versprach es. Mein Vater, der sonst eher schweigsam ist, redete diesmal wie ein Jahrmarktschwätzer vor seiner Bude.
Es habe hervorragend geschmeckt, es sei aber auch eine sehr kalorienreiche Mahlzeit gewesen, sagte Pavel später unter vier Augen. So könne er nicht ins Bett gehen. – Wollen wir, fragte er – noch für eine Weile hinaus, die Beine vertreten?
Dieser Gedanke lag hundertprozentig auf meiner Linie. Um etwa halb elf brachen wir auf.
Wir redeten kaum, vielleicht ich ein wenig, er fast gar nicht. Plötzlich nahm er mich an der Hand, okay, ich wehrte mich nicht. Nach einer Weile musste ich allerdings fragen, wie es jetzt zu Hause sei, ob er sich mit Andulka versöhnt habe?
Er guckte mich entgeistert an und ließ meine Hand los. – Wie kommst du darauf, um Gottes Willen? Die Sache ist längst abgeschlossen, schon seit einem guten halben Jahr.
Ich nickte. – Schön! Habe ich nicht gewusst.
Und dann weiter, bis zum Fluss. Am Ufer küssten wir uns. Ich war eher der Bremsfaktor, vor allem zu Beginn.
Wir waren nicht lange weg. Als wir wieder vor unserem Haus standen, fragte er mich, wie es jetzt sei, wo ich mein Zimmer habe … ob er zu einem «Gute-Nacht-Kuss» vorbeischauen dürfe.
Ich sah ihn überrascht an: – Wie meinst du das, Pavel? Hier, im Elternhaus? Wo die Tochter im Nebenzimmer schläft, oft zu mir kommt und unter meine Decke schlüpft? Das ist nicht dein Ernst!
Er zuckte mit den Schultern. – Ich denke, sagte er, – fragen, nur fragen darf man doch?
Ich gab ihm einen Kuss auf die Wange. – Das stimmt, fragen kann man schon, da hast du Recht.
Und jetzt mache ich, einen mittelgroßen Sprung, Herr Durbach. Etwa zwei Monate. Der Grund: keine besonderen Ereignisse.
Unsere vielen Briefe und E-Mails gingen munter hin und her; keiner gab nach, wir blieben also bei unserem bevorzugten Stil.
Mit der Zeit fand ich es aber gut so. Pavel legte seiner Briefpost nach wie vor ein paar Fotos bei, damit machte er in erster Linie der Mama eine große Freude. Er schrieb zum Beispiel, was er im Kino gesehen hatte und uns empfehlen könnte, und was er gerade lese.
Das nächste Treffen, Anfang Sommer. Mama plante ohnehin eine Reise nach Vojtyn, und ich dachte, in dem Fall werde ich mitfahren, ja, ich freute mich darauf; die Einladung von Pavels Mutter ging an uns beide.
Pavel hatte allerdings eine andere Idee: Er komme wieder zu uns, er habe in Deutschland ein paar Einkäufe zu erledigen und von der Grenze sei es zu mir nicht mehr so weit.
Ich war einverstanden. Und neugierig natürlich auch.
Er wollte am Freitag aufkreuzen und mich zu Hause abholen. Aperitif bei uns, fragte ich mich. Möglich. Aber nicht ideal. Der Vater würde zur Begrüßung herunterkommen, und dann könnte sich alles in die Länge ziehen. Ich reservierte lieber beim «Hirschen»; ein kleines Restaurant, das zum Bayrischen Hof gehörte, dem einzigen Vier-Sterne-Hotel in unserer Stadt. Das hielt ich für notwendig, denn am Freitag gehen viele Menschen aus, und ich wollte nicht, dass unser erstes Abendessen mit einer langen Lokalsuche und einer Verstimmung beginnen würde.
Pavel kam für seine Verhältnisse pünktlich; nur eine Viertelstunde Verspätung. Ins Haus lud ich ihn nicht ein, eben, wegen des Vaters.
Ich setzte mich zu ihm ins Auto, schnallte mich an und wollte ihn zum «Hirschen» navigieren. Er fand aber diese Idee nicht so toll, denn dort seien vor allem Stammgäste, eher höhere Jahrgänge; er habe in erster Linie ans «Santa Lucia» gedacht.
– Wie du meinst, sagte ich. – Ich kenne die Pizzeria. Ich befürchte allerdings, die Unterhaltung kann dort schwierig sein – zu voll und zu laut.
– Ach, nicht so düster, Laura. Es ist erst halb sieben. Wir schauen mal!
Warum eigentlich nicht, dachte ich. Absagen können wir immer noch.
Na ja, nicht das, was ich mir wünschte. Meine Befürchtung hat sich leider erfüllt: voll, ziemlich laut und die Tische besetzt; man lotste uns sofort an die Bar. Ein paar mir bekannte Typen saßen schon auf den Hockern und winkten. Nur kurz, teilte uns der Patron mit. Zehn, fünfzehn Minuten … höchstens.
– Nein, Pavel, sagte ich, – hier fühle ich mich nicht wohl, nicht einmal unterhalten könnten wir uns bei diesem Lärm. Komm, gehen wir!
Er zuckte mit den Schultern. – Wie du meinst. Heute ist halt Freitag.
– Zum «Hirschen»?
– «Hirschen»?
– Ja, dort habe ich für uns reserviert.
Pavel war nicht begeistert, er ließ mich aber einsteigen, und wir fuhren los.
Auch dieses Lokal war bis auf zwei oder drei Plätze besetzt und trotzdem deutlich ruhiger als «Santa Lucia»: Hohe Zimmerdecken, viele Pflanzen, dicke Vorhänge; man konnte sich gut unterhalten.
Pavel war in Hochform, er sprach viel, vor allem über Politik; dazwischen erzählte er hie und da Witze. Das war mir in diesem Augenblick recht, denn unter der Woche musste ich die meiste Zeit ohnehin nur reden.
Nach Hause gingen wir kurz vor elf, wir waren beinahe die letzten Gäste.