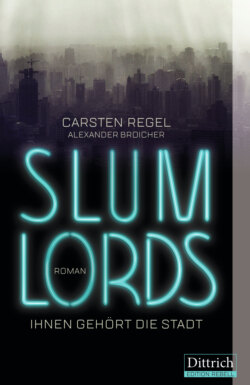Читать книгу Slumlords - Alexander Broicher - Страница 9
5
ОглавлениеDie führenden internationalen Großbanken mussten zuletzt über 280 Milliarden Euro Strafe zahlen für irgendwelche Sauereien, die sie heimlich begangen hatten: Mittlerweile waren sie verpflichtet, für solche Fälle enorme Rücklagen zu schaffen. Sie führten in ihren Bilanzen nun mehr als 100 Milliarden auf, die für Prozesse, Geldbußen oder Schadensersatzzahlungen angespart wurden. Einer der Gründe, warum Aktienkurse von Banken abschmierten, war, dass sie nicht genug Kohle auf der Seite hatten, um einen Krieg mit der Bankenaufsicht zu überstehen.
Meine eigenen Ersparnisse reichten, um mindestens 18 Monate ohne Einkünfte gut leben zu können. Aber in meinem Beruf musste man immer mit allem rechnen. Die Cops waren nicht dämlich, deswegen hielt ich meine Bude blitzblank sauber. Die Jungs vom Rauschgiftdezernat würden sich kaputtlachen, wenn sie im Badezimmerschränkchen eine Dose für Vitamintabletten sahen, in der sich aber Ecstasy-Pillen befanden. Wenn sie im Spülkasten des Klos wasserdicht verpacktes Kokain sicherstellen konnten, Haschtütchen aus einer Packung mit Kaffeebohnen fischten oder auf größere Mengen Bargeld stießen, das in Sofakissen gebunkert war. Notfalls brachten sie Hunde mit, die für all das ein verdammt gutes Näschen hatten. So war das einzig wirklich Verdächtige meine Feinwaage, denn die ließ wenig Interpretationsspielraum zu, und die Spezialisten im Labor würden irgendwelche Reste vom Kokain ganz einfach sichtbar machen. Eine Feinwaage im Haushalt eines potenziellen Dealers war fast so belastend, wie bei einer Vergewaltigung auf dem Opfer liegend von der Polizei geschnappt zu werden. Deshalb stopfte ich sie betont achtlos zu anderen überflüssigen Utensilien, die sich bei mir angesammelt hatten: Taschenrechner mit integrierter Weltzeituhr, Stifte in Etuis, USB-Sticks, der typische Schnickschnack eben, den man so zugesandt bekam, wenn man eine Zeitschrift abonnierte.
Um den Bullen keine Verdachtsmomente zu liefern, achtete ich selbst auf meinen Müll penibel. Nichts sollte darauf hinweisen, womit ich mein Geld in Wirklichkeit verdiente, daher entsorgte ich alles, was ich zum Herstellen meiner Ware brauchte, nie vor meiner Haustür, sondern schleppte es in einem Rucksack in irgendeine Wohnanlage und stopfte es dort in deren Mülltonnen.
Ich musste vor allem wegen meiner auffälligen Hausapotheke vorsichtig sein, denn ich hatte einen gewaltigen Verbrauch an Schmerztabletten, die ich zum Strecken brauchte. Das meiste davon beschaffte mir der Besitzer der Cocktailbar, der einen Nachmittag lang herumfuhr und sie in diversen Apotheken ganz offiziell für den Verbandskasten des Ladens einkaufte. Er holte in jeder Zweigstelle höchstens zwei rezeptfreie Schachteln und überreichte mir dann einen Schuhkarton voll. Es war ein Gefallen, den er mir tat, denn er war Teil unserer Abmachung. Er brauchte seinerzeit einen Investor für die Renovierung der ehemaligen Erotik-Bar, ich benötigte eine seriöse Fassade.
Zu meinen Sicherheitsmaßnahmen gehörte, meine Wohnungstür mit einem Spezialriegel aus Stahl zu versperren, der nicht nur Einbrecher fernhalten sollte, sondern vor allem minutenlang standhalten musste, falls die Polizei meine Tür aufstemmte, um mich dranzukriegen. Das massive Schloss würde mir genug Zeit lassen, dass ich alles in der Toilette wegspülen konnte, damit sie keine Beweismittel gegen mich hatten. In einer solchen Situation musste ich zwar blitzschnell Ware für mehrere tausend Euro ins Klo schütten, aber das war mein Berufsrisiko und immer noch besser als Gefängnis.
Das Strecken funktionierte letztendlich wie Kuchenbacken. Ich benötigte ein paar Zutaten, die ich miteinander verrührte, um dann kleine Leckereien daraus zu formen. Ich nahm ein Küchenbrett als Arbeitsplatte und bedeckte es mit einer Klarsichtfolie, um keine Spuren zu hinterlassen. Darauf zermalmte ich die Dragees mit einem handelsüblichen Gewürzmörser, bis sie pulverisiert waren. Danach gab ich basisches Nahrungsergänzungspulver aus der Drogerie hinzu, das geschmacksneutral und homöopathisch war, denn ich war an der Gesundheit meiner Kundschaft interessiert. Ich wälzte das Kokain darin wie in Mehl und knetete es durch wie einen Teig. Den Klumpen bestrich ich mit einem Pinsel mit Wasser, damit sich alles miteinander verband. Anschließend breitete ich die zähe Masse auf dem Blech im Backofen aus wie einen Pizzateig. Das vorsichtige Erwärmen diente dem Trocknen, denn irgendwie musste ich die Flüssigkeit wieder herauskriegen. Meine Kunden wollten sich ja keinen Schleim reinziehen, sondern guten Stoff, von daher war dieser Arbeitsaufwand nötig, um die Qualität zu halten, obwohl das G zur Hälfte mit Schmerztabletten und Basenpulver versetzt war. Das Kokain nahm ich direkt vom Backpapier, wog die Portionen ab und wickelte sie filigran wie ein Chirurg in Gummikügelchen ein. Anschließend reinigte ich den Mörser mit Spülmittel und heißem Wasser, denn was Sauberkeit anbetraf hatte ich beruflich das Ethos eines Chefchirurgs.
Ich band mir eine Schürze um, bevor ich mich an die Operation machte. Das nervigste waren die festen Pillen, die ich zu Pulver zermalmen musste. Jedes Mal 250 Stück. Ich schlug mit einem Hammer drauf und nahm den Mörser nur noch für die Feinarbeit. Anstrengend war es trotzdem. Und dann klingelte mein Handy. Hoffentlich keine eilige Bestellung. Ich wischte mir etwas Schweiß von der Stirn und nahm ab. Es war mein Vater.
»Ronnie, es ist was passiert. Kannst du vorbeikommen?«
Ich hasste solche Ansagen, die im Vagen blieben. Mein Herz begann, schneller zu schlagen.
»Was ist los?«, setzte ich ihn unter Druck.
»Deine Mutter ist überfallen worden.«
»Was? Ist sie okay?«
»Ich würde sagen, den Umständen entsprechend.« Seine Stimme zitterte nicht vor Aufregung, sondern vom Bourbon, den er wohl zum Frühstuck getrunken hatte.
»Gib sie mir mal ans Telefon«, forderte ich ihn auf.
»Sie hat sich hingelegt…«
Ich checkte die Uhrzeit auf meinem Phone. Dann hielt ich es mir wieder ans Ohr. «Hör zu, ich muss hier noch was erledigen. Bin in zwei Stunden bei euch.«
Meine Mutter hatte versucht, ihre Prellungen im Gesicht zu überschminken, damit ich mir keine Sorgen machte. Sie hockte erschöpft auf dem Sofa, während ich auf und ab latschte. Natürlich war ich wütend auf die Täter. Ich hatte meinen Totschläger in der Jacke, falls die drei Typen immer noch im Haus rumlungerten. Die Jungs wären tot. Aber was ging meine Mutter allein in den Keller? Wie blauäugig und weltfremd sie manchmal war! Selbst ich betrat die verschachtelten Flure nur ungern, weil da Penner nächtigten, Kiffer abhingen oder Cracksüchtige. Die hatten keinen Bock auf Publikum, wenn sie ihre Pfeifen rauchten. Und sie schlugen dir für zwei Euro den Schädel ein. Insofern war meine Mutter glimpflich davongekommen.
»Kannst du mir mal erklären, was du da unten wolltest?«, fragte ich sie gestresst.
»Altkleider entsorgen.« Ihre Stimme war dünn.
»Mach es doch wie die Zigeuner aus dem elften Stock: Schmeiß deinen Müll einfach vom Balkon runter«, empfahl ihr mein Vater.
»Die werfen ihren Müll aus dem Fenster?«
»Klar! Frag Zbigniew, der hat denen das verboten, interessiert die aber nicht!«
Zbigniew war der Hauswart. Ein Skinhead aus Krakau mit einem Tattoo auf dem Hals von seinem polnischen Fußballverein. Wenn er Mietern eine Ansage machte, wussten alle, dass er nicht die Hausverwaltung anrief, wenn seine Anweisungen nicht befolgt wurden. Er regelte so was persönlich auf dem kleinen Dienstweg. Mit einem Schlag in den Magen oder in die Fresse. Aber bei der Großfamilie aus Rumänien oder Albanien fruchtete das nicht. Die hausten mit mindestens zehn Leuten in einer Dreizimmerwohnung. Wahrscheinlich hatte Zbigniew keinen Bock, von denen mal wie Abfall vom Balkon geworfen zu werden. Elf Stockwerke runter.
»Wenn zukünftig etwas in den Keller gebracht werden soll, werde ich das zusammen mit Vater erledigen«, machte ich meiner Mutter klar.
Sie nickte und fing an zu weinen. Was mich jedes Mal traf wie ein Faustschlag. Ich legte ihr eine Hand auf die Schulter. Auch, um mich selbst zu trösten. Ich sammelte mich. Blickte meinen Vater an, der mit überkreuzten Beinen im Sessel saß. Dann wandte ich mich an meine Mutter. »In der heutigen Zeit muss man leider immer und überall auf der Hut sein.« Ich redete auf sie ein wie diese Sozialarbeiter, die ich früher schon gehasst habe.
»Ich will hier weg«, schluchzte sie.
»Jetzt geht das wieder los!« Es regte meinen Vater auf.
»Ich halte das nicht mehr aus!«
»Einen alten Baum verpflanzt man nicht!«, bellte er zurück.
Womit er nicht nur sich meinte, sondern zwei alte Jugendfreunde, die hier auch seit über 40 Jahren wohnten. Mit denen er sich zum Skat und zum Saufen traf. Oder zum Reden über die alten Zeiten, als sie zusammen eine kleine Gang waren, die in der Nähe immer Klauen gingen. In Supermärkten und in Klamottenläden.
Ich hätte meine Mutter sofort mitnehmen und bei mir unterbringen können, nur leider war meine Küche eine Backstube für Kokain. Und Mama würde niemals meinen Vater unversorgt zurücklassen, denn er war nahezu unfähig, etwas anderes als Tütensuppe zu kochen, Wäsche zu waschen oder die Bude turnusmäßig zu reinigen. Er hing an diesem versifften Ghetto wie ein Junkie an der dreckigen Nadel. Ihn hier wegzubewegen wäre für ihn wie ein Alkoholentzug. Mit einer stinknormalen Bude in einem ruhigen Viertel brauchte ich ihn nicht zu ködern, da musste ich schon kistenweise Champagner auffahren, um den trägen Sack von WhiskyCola runter zu kriegen. Seinem geliebten Arme-Leute-Gesöff. Doch bevor meine Mutter hier vor die Hunde ging, spendierte ich ihr lieber einen Monat in einem Luxushotel in der Innenstadt. Um Zeit zu gewinnen, in der ich ein cooles Apartment für meine Eltern anmieten konnte. Was mich scheiße viel Kohle kosten würde. Meine Eltern. Hakan. Die Inkasso-Schläger. Julia. Mein Lifestyle. Frankfurt verschlang immer nur Geld, Geld, Geld.