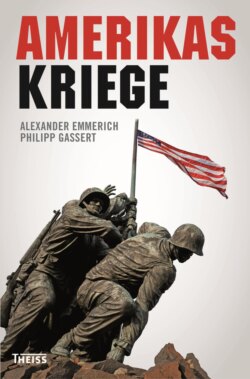Читать книгу Amerikas Kriege - Alexander Emmerich - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung: Demokratie und Krieg
ОглавлениеAm 2. April 1917 trat der amerikanische Präsident Woodrow Wilson vor beide Häuser des amerikanischen Kongresses. Wilson warb für eine Kriegserklärung gegen das Deutsche Reich. Bislang waren die Vereinigten Staaten neutral geblieben, seit mit den Morden von Sarajevo 1914 der Erste Weltkrieg ausgebrochen war. Mit viel Umsicht hatte der Präsident das Land aus dem Konflikt der Europäer herausgehalten. Doch nun sah Wilson sich zum Eingreifen gezwungen. Er wollte nicht länger die Schrecken dieses Krieges dulden. Vor allem aber sah er eine wachsende Gefahr für Amerikas Sicherheit und die seiner Bürger. Hatte Deutschland, das seit Anfang 1917 wieder einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg führte, nicht wenige Tage zuvor erneut drei US-Handelsschiffe ohne Warnung versenkt? Doch der Erste Weltkrieg barg in Wilsons Sicht eine noch viel fundamentalere Gefahr: Das Überleben der Demokratie in der Welt stand auf der Kippe.
Von heute aus betrachtet ist Wilsons Rede voll von Paradoxien: Amerika müsse Krieg führen, so der Präsident, um Krieg zu beenden. Durch Krieg solle Krieg für alle künftigen Zeiten obsolet gemacht werden, wie es weiter heißt. Durch Krieg müsse die Welt „sicher für die Demokratie“ gemacht werden. Wörtlich sprach der Präsident die seither unzählige Male zitierten Worte: „The world must be made safe for democracy.“ Man müsse für das Recht aller Menschen kämpfen, sich eine eigene Regierung zu wählen, für die Freiheit der kleinen Nationen, für eine universale Ordnung des Rechts, für ein „Konzert freier Völker“. In diesem Krieg gehe es darum, allen Menschen Frieden und Sicherheit und der Welt endlich Freiheit zu bringen („to make the world at last free“). Es sei die „traurige Pflicht“ Amerikas, sein Blut für diese Prinzipien zu opfern. Dafür sei Amerika seit seiner Gründung eingestanden: „Gott helfe ihr, sie kann nicht anders.“
Wilson hatte einen Traum. Seine mit großem Pathos vorgetragene Rede lässt sich als Schlüssel zum Verhältnis der USA zum Krieg lesen. Seine Worte, der Tonfall eines Predigers, alles erinnert an seine großen Vorgänger wie Lincoln und Jefferson; sie wurden seither immer wieder zitiert, sind fester Bestandteil der präsidentiellen Rhetorik der USA; sie haben Männer wie Martin Luther King und John F. Kennedy inspiriert, aber auch Harry Truman, als er der Sowjetunion im frühen Kalten Krieg in die Parade fuhr; oder nach dem 11. September 2001, als der jüngere George W. Bush den „Krieg gegen den Terror“ erklärte; oder Barack Obama, als er in Ägypten den Völkern des arabischen Raums und des Nahen Ostens die Hand reichte.
Wilsons Ansatz war nicht unumstritten. Er traf auf zum Teil massiven Widerstand. Erst nach längerem Ringen und gegen eine starke Opposition konnte er eine Mehrheit der Abgeordneten für sein Vorhaben gewinnen, dem Deutschen Kaiserreich den Krieg zu erklären. Dabei reichte es selbstverständlich nicht, auf nüchterne wirtschaftliche Interessen oder auf internationales Recht zu verweisen. Allein dafür ziehen Demokratien nicht in den Krieg. Erst mit der Anrufung von hehren Prinzipien und allgemein verbindlichen Werten, aber auch mit der Beschwörung einer existentiellen Bedrohung überzeugte Wilson den Kongress.
Dem stellte sich eine Friedenspartei entgegen. Sie lehnte im Namen derselben Werte den Kriegseintritt ab. Wie könne Amerika an der Seite Englands in den Krieg ziehen, rief Senator Robert LaFollette aus Wisconsin aus, wenn dieser Verbündete doch mitnichten demokratisch sei, sondern eine erbliche Monarchie, mit mehr sozialer Ungleichheit als Deutschland und begrenztem Wahlrecht für die unteren Klassen? Wie stehe es um die Freiheit und Selbstbestimmung der englischen Kolonialvölker in Irland, Ägypten oder Indien? Die amerikanische Demokratie selbst werde unter einem Krieg leiden, bedrohe der Krieg doch die Freiheit der amerikanischen Bürger im Inneren wegen der Gesetze zur Überwachung, bei der Bekämpfung der Spionage und durch die Einführung der Wehrpflicht.
Streit um Kriegseintritt, Kriegsführung sowie die Resultate militärischer Auseinandersetzungen begleitet seit jeher in den USA eine Argumentation, die ein immer gleiches Bild bemüht: Amerika kämpft gegen das Böse in der Welt und führt so die Menschheit zu einem besseren Miteinander. Aber auch die Kriegsgegner malen ihre Ablehnung in den leuchtenden Farben der Demokratie und der Rhetorik der Freiheit, auch sie treten für das Gute ein, setzen ihre Deutung Amerikas und seiner Geschichte den Kriegstreibern entgegen.
Dies deutlich zu machen, nämlich dass Amerika fast immer uneins in seine Kriege zog und sich darüber stritt, wie man die Welt sicher für die Demokratie machen könnte, ist ein zentrales Anliegen dieses Bandes. Fast jede militärische Intervention war umstritten, provozierte heftige Redeschlachten im Kongress. Schon der britisch-amerikanische Krieg von 1812, den die jungen USA mutwillig vom Zaun brachen, oder erst recht 1898 die von den Anti-Imperialisten vehement abgelehnte Annexion der Philippinen sorgten für inneren Zwist; sogar mit dem Eintritt in den Ersten und selbst den Zweiten Weltkrieg, als die USA unstrittig von Japan und Deutschland angegriffen wurden, taten sich viele Amerikaner anfangs schwer. Auch im Kalten Krieg, als der Widerstand gegen den Vietnamkrieg zu zahlreichen Protesten führte oder angesichts der Raketenhochrüstung der 1980er-Jahre Hunderttausende auf die Straßen gingen, stand einer Kriegspartei eine Friedenspartei gegenüber. Natürlich gilt dies erst recht für die Zeit nach 9/11.
Der Zweikampf „Gut gegen Böse“ zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Amerikas Kriegen. Aber wie „dem Guten“ am besten zum Durchbruch verholfen werden konnte, war dabei selten klar. Selbst wenn sich häufig die Kriegspartei durchsetzen konnte, ging Amerika mit einem schlechten Gefühl aus einem Krieg heraus. Das zeigt das Beispiel Wilsons besonders prägnant, dessen Hoffnungen auf eine bessere Welt bitter enttäuscht wurden, oder in jüngster Zeit der „Krieg gegen den Terror“. Denn die USA verfügen über die älteste demokratische Verfassung der Welt, was sie im Unterschied zu Diktaturen oder autoritären Staaten zu einer öffentlichen Auseinandersetzung um Kriege und Kriegsziele zwingt.
Seit die dreizehn Kolonien 1776 ihre Unabhängigkeit von England erklärten und sich in einem revolutionären Krieg vom Joch der britischen Kolonialherrschaft befreiten, ist dieses Land fast ununterbrochen in militärische Konflikte verwickelt. Daher stellt sich auch die Frage, ob es einen „democratic way of war“ gibt. Die USA setzen bevorzugt auf hoch entwickelte Kriegstechnologie, womit sie – als Demokratie – ihr Personal schonen, was jüngst im Drohnenkrieg gipfelte, in dem Soldaten nur noch aus sicherer Distanz agieren. Auch der Aufbau geheimdienstlicher Apparate hilft, die Zahl der Opfer zu minimieren. Ihren größten Sieg, im Zweiten Weltkrieg über Deutschland und Japan 1945, errangen die USA mit einem Bruchteil der deutschen, japanischen oder sowjetischen Toten. Eine Demokratie toleriert militärische Opfer nur in Grenzen. Das zeigt etwa das Debakel des Vietnamkriegs. Und als der Irakkrieg 2005 aus dem Ruder lief, waren es die amerikanischen Toten, die die öffentliche Unterstützung schwinden ließen. Prompt durften die Särge amerikanischer Soldaten nicht mehr in den Medien gezeigt werden.
Wie also geht das zusammen: Demokratie und Krieg? Mit dieser brennenden Frage muss sich in der heutigen Situation auch ein mittelgroßes Land wie die Bundesrepublik Deutschland immer wieder aufs Neue beschäftigen. Denn auch Deutschland sieht sich im Rahmen seiner Bündnisse zur Teilnahme an militärischen Interventionen genötigt. Doch fehlen ihm dabei die historischen Orientierungsmöglichkeiten. Auch die Deutschen müssen sich, wie die Amerikaner beim Ersten Weltkrieg, fragen, ob sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren können, wenn sie in fernen Ländern intervenieren, oder wenn sie dies nicht tun. So hat auch die Bundeswehr in Afghanistan mehrfach die Erfahrung gemacht, dass bei allem guten Willen ein Krieg unweigerlich zivile Opfer nach sich zieht. Solange Menschen Entscheidungen über Leben und Tod treffen, werden sie Fehler machen, werden sie oft auch in fehlgeleitetem Idealismus ihre Unschuld verlieren (wie es Graham Greene in „Der stille Amerikaner“ unübertroffen gezeichnet hat). Amerika hat mehr als hundert Jahre lang in unzähligen öffentlichen Debatten mit solchen moralischen Dilemmata Erfahrungen gesammelt.
Aus dem US-Beispiel lässt sich etwas für unsere gegenwärtigen Diskussionen in Deutschland und Europa lernen, obwohl sich Geschichte natürlich nie eins zu eins wiederholt und jeder Krieg die Demokratie vor andere und neue Herausforderungen stellen wird. Allerdings hat die Übertragbarkeit der amerikanischen Diskussionen auf europäische oder gar deutsche Verhältnisse Grenzen. Denn die USA sind auch ein Sonderfall. Die Vereinigten Staaten lagen lange Zeit als europäische Gründung am Rande der westlichen Zivilisation. In einer langen Kette von Indianerkriegen, die sich bis in die 1890er-Jahre zogen, verdrängten die USA die nordamerikanischen Ureinwohner aus ihren Territorien und entwickelten ein spezielles Verhältnis zur Gewalt, das in dieser Form so in Europa nicht existiert und hier immer wieder für Verwunderung sorgt. Indes sind die USA doch auch ein Stück weit den europäischen Kolonialmächten vergleichbar, von denen die meisten (England, Frankreich, die Niederlande) ja ebenfalls alte Demokratien sind.
Hinzu kommt zweitens das ausgeprägte demokratische Sendungsbewusstsein der USA und ihre charakteristische politische Kultur: Aber auch hier steht Amerika nicht ganz allein. Das US-Beispiel lehrt, dass Demokratien dann leichter militärisch für ihre Ziele kämpfen, wenn sich die andere Seite als Verkörperung eines Übels erweist, wenn (tatsächlich oder vermeintlich) die eigene Lebensform und die Freiheit durch einen ideologischen Gegner wie das Dritte Reich oder die Sowjetunion bedroht wird, und wenn keine andere Abhilfe möglich scheint. Der Heidelberger Historiker Detlef Junker hat für diesen Mechanismus das Bild der „manichäischen Falle“ geprägt, wonach in einer Gut und Böse sauber scheidenden, „manichäischen Weltsicht“ der Feind entsprechend abgestempelt werden muss. Historische Erfahrung lehrt, dass es für Kriege Feindbilder braucht, zumal in Demokratien. Das amerikanische Beispiel zwingt zum Nachdenken, denn auch Europa ist nicht frei davon – und schon gar nicht Deutschland.
Der größte Unterschied ist drittens, dass die USA seit 1898 eine imperiale Macht sind und im 20. Jahrhundert zu der überragenden Weltmacht überhaupt wurden (so dass man schließlich von einer Supermacht und nach 9/11 auch von einer Hypermacht sprach). Ein solcher Status bringt Verpflichtungen und Bürden mit sich, auch Automatismen, denen das heutige Europa sich leichter entziehen kann. Die USA wehrten zweimal den deutschen Griff nach der Weltvorherrschaft ab, sie dämmten vierzig Jahre lang das imperiale Streben der Sowjetunion ein. Aber sie wurden dadurch und in Kombination mit ihrer wirtschaftlichen Stärke und kulturellen Ausstrahlung zum Hegemon, an dem sich seither alle anderen abarbeiten. Amerika ruft allein deshalb immer wieder Kritik und Ablehnung hervor, die sich bis zum blinden Antiamerikanismus steigern kann, weil es als stärkstes Land der Welt geradezu reflexartig Widerstand provoziert. Man kennt das aus Hollywood: Der „bully“ wird abgelehnt, man sympathisiert mit dem „underdog“, selbst wenn dieser, wie z.B. im Falle Kubas oder Venezuelas, alles andere als ein aufrichtiger Demokrat ist.
Historiker dürfen sich ab und an ein Werturteil erlauben. Es ist völlig unstrittig, dass der Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland, das Europa mit einem Terrorregime überzog, moralisch gerechtfertigt war. In der Erinnerung Amerikas erscheint er heute noch als der „gute Krieg“. Auch der Kalte Krieg gegen die stalinistische Sowjetunion, die unglaubliches Leid über die Menschen brachte und Amerika zwang in Drittstaaten einzugreifen, wird man die Rechtfertigung nicht absprechen, auch wenn man den USA sekundäre Motive unterstellen kann – und niemand würde wirtschaftliche Interessen leichtfertig in Abrede stellen. Es waren gerade diese Kriege gegen undemokratische, totalitäre Systeme, die Amerika zum Welthegemon machten. Mit dem dadurch erreichten militärtechnologischen Vorsprung der USA entwickelte sich eine Art interventionistischer Automatismus und eine globale Vorwärtsverteidigung mit exorbitanten, ausufernden Sicherheitszielen. Diese haben im „Krieg gegen den Terror“ der jüngsten Zeit jedes vernünftige Maß überschritten. So gerät Amerika moralisch in die Bredouille. Schon in den 1950er-Jahren hatte dieses Szenario Befürchtungen geweckt, das Land könne zu einem „Garnisonsstaat“ werden, vor dem ein nüchtern denkender Ex-Militär, der damalige Präsident Eisenhower, warnte. Viele Amerikaner, wie der jüngst verstorbene Folk-Musiker Pete Seeger, haben sich am Kult der Sicherheit kritisch abgearbeitet und für ein anderes, in ihrer Sicht besseres Amerika gestritten.
Dieser Band gibt einen chronologischen Überblick über Amerikas wichtigste Kriege, von den Anfängen der kolonialen Gesellschaften bis in die Gegenwart. „Amerikas Kriege“ zeigt Gemeinsamkeiten, Muster und Schablonen in der amerikanischen Kriegsführung und Außenpolitik auf, es befasst sich mit den historischen Parallelen der Kriegsgründe, den Rechtfertigungen und auch der politischen Rhetorik US-amerikanischer Politiker und Präsidenten. Darüber hinaus beleuchtet dieser Band die Bündnispolitik der USA und die Rolle der Religion im Bezug auf die amerikanischen Kriege. Zugleich aber soll deutlich werden, dass der Imperialismus der USA, sosehr er sich aus der Logik der Größe und der einzigartigen Machtstellung dieses Landes ergab, in seinen Auswirkungen auf die amerikanische Gesellschaft und in seiner Wahrnehmung eine sehr ambivalente Geschichte ist. Viele Amerikaner haben daher im Lauf der Geschichte gegen das Weltmachtstreben der USA und die Politik ihrer Regierungen opponiert. Amerikas Kriege waren stets auch Kriege im Inneren, sie haben Kontroversen und inneren Streit provoziert – nicht nur rhetorisch. Das gilt es nachdrücklich festzuhalten.