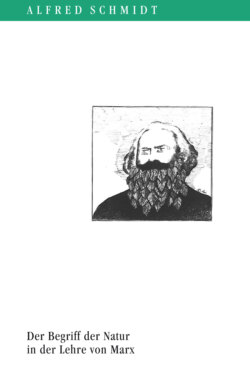Читать книгу Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx - Alfred Schmidt - Страница 12
Anmerkungen zum Vorwort des Verfassers
zur französischen Ausgabe
Оглавление1 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Band I.3, Frankfurt am Main 1980, S. 1232.
2 Cf. hierzu Iring Fetscher, Überlebensbedingungen der Menschheit. Ist der Fortschritt noch zu retten?, München 21985, S. 110.
3 Cf. Alfred Schmidt, Emanzipatorische Sinnlichkeit. Ludwig Feuerbachs anthropologischer Materialismus, München 31988, S. 32ff.
4 Engels an Marx, Brief vom 15. Dezember 1882, in: Marx/Engels, Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, S. 425 (Hervorhebung von Engels).
5 Marx, Die künftigen Ergebnisse der britischen Herrschaft in Indien, »New York Daily Tribüne«, Nr. 3840 vom 8. August 1853, in: Ausgewählte Schriften, Band I, Berlin 1964, S. 330.
6 Manifest der Kommunistischen Partei, in: ibid., S. 30f.
7 Ibid.
8 Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf), Berlin 1953, S. 313.
9 Ibid.
10 Marx, Das Kapital, Band III, Berlin 1953, S. 873.
11 Cf. Fetscher, l.c., S. 120f.
12 Marx, Grundrisse, l.c., S. 387.
13 Ibid.
14 Ibid., S. 387; 388.
15 Cf. ibid., S. 79.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid., S. 79f.
21 Ibid., S. 231; cf. auch S. 415. – Cf. zur historischen Notwendigkeit des »Hindurchgangs« der Menschheit durch die kapitalistische Produktionsweise auch Fetscher, l.c., S. 115ff.
22 Marx, Grundrisse, l.c., S. 80.
23 Ibid., S. 231.
24 Marx/Engels, Werke, Band I, Berlin 1957, S. 375.
25 Marx, Das Kapital, Band III, l.c., S. 289.
26 Marx, Das Kapital, Band I, Berlin 1955, S. 531 (Hervorhebungen vom Verfasser).
27 Marx bezieht sich in diesem Zusammenhang (cf. ibid., S. 532) auf Justus von Liebig, dessen Buch Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie (71862) er dafür lobt, die »negative Seite der modernen Agrikultur ... vom Naturwissenschaftlichen Standpunkt« aus entwickelt zu haben. Cf. dazu auch Fetscher, l.c., S. 137.
28 Marx, Das Kapital, Band I, l.c., S. 531f. (Hervorhebungen von Marx). – Cf. hierzu auch die Theorien über den Mehrwert, wo es lapidar heißt: »Antizipation der Zukunft – wirkliche Antizipation – findet überhaupt in der Produktion des Reichtums nur statt mit Bezug auf den Arbeiter und die Erde. Bei beiden kann durch vorzeitige Überanstrengung und Erschöpfung, durch Störung des Gleichgewichts zwischen Ausgabe und Einnahme, die Zukunft realiter antizipiert und verwüstet werden. Bei beiden geschieht es in der kapitalistischen Produktion« (in: Marx/Engels, Werke, Band 26.3, Berlin 1968, S. 303).
29 Marx, Das Kapital, Band I, l.c., S. 532.
30 Marx/Engels, Werke, Band 26.3, l.c., S. 295.
31 Marx, Brief an Engels vom 25. März 1868, in: Marx/Engels, Werke, Band 32, Berlin 1965, S. 52f. (Hervorhebungen von Marx).
32 Marx, Das Kapital, Band II, Berlin 1955, S. 241. – Marx kommentiert hier Friedrich Kirchhofs Handbuch der landwirtschaftlichen Betriebslehre, Dessau 1852, S. 58.
33 Marx, Das Kapital, Band II, l.c., S. 241.
34 Marx/Engels, Werke, Band 20, Berlin 1968, S. 275f.
35 Ibid., S. 276.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid., S. 455.
39 Ibid., S. 454.
40 Ibid., S. 452f; cf. hierzu auch S. 455.
41 Ibid., cf. S. 277.
42 Ibid., S. 453.
43 Ibid., S. 454. – Hinsichtlich der von Engels erwogenen Möglichkeit auch die Naturbeherrschung künftig lückenlos zu beherrschen, haben spätere Marxisten wie Max Adler sich mit Recht eher skeptisch geäußert. Adler warnt davor, »in die übliche und gedankenlose Verherrlichung des technischen Fortschritts zu verfallen, wie sie die bürgerliche Welt zu ihrer Berühmung und Rechtfertigung liebt«. Es bleibt zu beachten, »daß eine Möglichkeit sozusagen für den Einbruch der unbeherrschten Natur in das System der geregelten und beabsichtigten Naturwirkungen nicht nur immer bestehen bleibt, sondern, wo er gelingt, gerade infolge der größeren, aber momentan durchbrochenen Naturbeherrschung auch bedeutsam größere, ja manchesmal sogar katastrophale Wirkungen hervorruft« (Natur und Gesellschaft. Soziologie des Marxismus 2, Wien 1964, S. 81; 83).
44 Marx/Engels, Werke, Band 20, l.c., S. 454.
45 Ibid.
46 Marx, Das Kapital, Band III, l.c., S. 826.
47 Marx/Engels, Werke, Band 3, Berlin 1962, S. 5ff.; 42ff.
48 Cf. hierzu besonders das III. Kapitel, Abschnitt C): Weltkonstitution als historische Praxis. – In seinem Artikel Praxis (1973) hat der Verfasser die »praxeologische« Auffassung der Wirklichkeit näher entwickelt (in: Alfred Schmidt, Kritische Theorie. Humanismus. Aufklärung, Stuttgart 1981).
49 Am deutlichsten noch im Abschnitt B) des II. Kapitels, wo der Verfasser den »Stoffwechsel von Mensch und Natur« erörtert und dabei auch auf dessen Zusammenhang mit den komplexen Interaktionen innerhalb des Naturganzen zu sprechen kommt.
50 Marx/Engels, Werke, Band 3, l.c., S. 43.
51 Marx, Das Kapital, Band I, l.c., S. 8.
52 Marx/Engels, Werke, Band 20, Berlin 1968, S. 453.
53 Max Adler, Natur und Gesellschaft, l.c., S. 84.
54 Ibid., S. 83 f.
55 Marx/Engels, Ausgewählte Schriften, Band II, Berlin 1964, S. 11 (Hervorhebungen vom Verfasser).
56 Marx, Das Kapital, Band III, l.c., S. 879.
57 Martin Heidegger hat denn auch im Humanismusbrief den Marxschen Materialismus als Ausdruck einer weltgeschichtlichen Erfahrung des modernen Bewußtseins interpretiert und gegen »billige Widerlegungen« verteidigt. »Das Wesen des Materialismus«, betont Heidegger, »besteht nicht in der Behauptung, alles sei nur Stoff, vielmehr in einer metaphysischen Bestimmung, der gemäß alles Seiende als das Material der Arbeit erscheint. Das neuzeitlichmetaphysische Wesen der Arbeit ist in Hegels Phänomenologie des Geistes vorgedacht als der sich selbst einrichtende Vorgang der unbedingten Herstellung, das ist Vergegenständlichung des Wirklichen durch den als Subjektivität erfahrenen Menschen. Das Wesen des Materialismus verbirgt sich im Wesen der Technik« (Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den »Humanismus«, Bern 21954, S. 87f.).
58 Marx, Das Kapital, Band I, l.c., S. 47; cf. auch S. 186.
59 Cf. Alfred Schmidt, Humanismus als Naturbeherrschung, in: Jörg Zimmermann (Hrsg.), Das Naturbild des Menschen, München 1982, S. 301ff.
60 Cf. Alfred Schmidt, Emanzipatorische Sinnlichkeit. Ludwig Feuerbachs anthropologischer Materialismus, München 31988, S. 46ff.
61 Marx/Engels, Werke, Band 3, l.c., S. 7.
62 Ludwig Feuerbach, Gesammelte Werke, hrsg. von Werner Schuffenhauer, Band 5, Berlin 1973, S. 206.
63 Ibid., S. 207.
64 Ibid., S. 206 (Hervorhebungen von Feuerbach).
65 Ibid., S. 207 (Hervorhebungen von Feuerbach).
66 Ibid. (Hervorhebungen von Feuerbach).
67 Marx an Feuerbach, Brief vom 3. Oktober 1843, in: Marx/Engels, Werke, Band 27, Berlin 1963, S. 420.
68 Schellings Werke, hrsg. von Manfred Schröter, Zweiter Hauptband, München 1927, S. 17.
69 Marx/Engels, Werke, Band 20, l.c., S. 307.
70 Diesen Begriff hat Carl Amerys Buch Natur als Politik. Die ökologische Chance des Menschen, Reinbek bei Hamburg 1976, in die wissenschaftliche und politische Debatte eingeführt (cf. S. 17ff.). – Der marxistische Materialismus, erklärt Amery, sei darin inkonsequent gewesen, daß er sich an »Leitvorstellungen aus der politischen Ökonomie« orientiert habe, die es nunmehr »theoretisch und praktisch« den »Leitvorstellungen der Ökologie« unterzuordnen gelte (S. 184). Habe der Materialismus sich bisher damit begnügt, »die Welt zu verändern«, so komme es jetzt »darauf an, sie zu erhalten« (S. 185). – Hieraus folgt, daß Amery hinsichtlich der utopischen Hoffnungen des traditionellen Marxismus erhebliche Abstriche empfiehlt. Die »Perspektive des konsequenten Materialismus« formuliert Amery folgendermaßen: »Versöhnung mit der Erde: das ist die Notwendigkeit, aus der konsequenter Materialismus erwächst und handelt. Nicht Ende der Entfremdung, nicht Fülle der Güter für den Menschen kann sein Ziel sein, sondern zunächst und vor allem eine Zukunftsordnung, die sich aus dem Respekt vor jeder Materie, auch nichtmenschlicher, ergibt. Gewiß, noch immer und stets gilt der Marxsche Satz, daß Natur dem Menschen vermittelt wird und auch die Einwirkung des Menschen auf die Natur (der bekannte ›Stoffwechsel‹) gesellschaftlich erfolgt. Aber dies sagt noch nichts über die Aufgaben aus, die sich die Gesellschaft als Vermittlerin stellt« (S. 166).