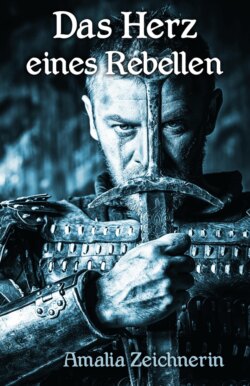Читать книгу Das Herz eines Rebellen - Amalia Zeichnerin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII
Dieser Bastard drückte seinen Kopf wieder in das eiskalte, trübe Wasser. Severin fand kaum die Zeit, Luft zu holen. Verdammt, es reichte nicht! Schon nach kurzer Zeit brannte seine Lunge und der Drang, den Mund zu öffnen, wurde übermächtig. Er versuchte sich aus dem eisernen Griff zu befreien, der ihn festhielt, ihn weiter nach unten drückte. Vergeblich. In seinem Inneren brodelte die Wut, ohnmächtige, brennende Wut. Sein Kopf ruckte hin und her, es half alles nichts. Luft! Das Wasser drang ihm in Nase und Ohren.
Endlich, als schon die Todesangst mit ihren gierigen Klauen nach ihm griff und ihm war, als ob Eis durch seine bis eben noch brennenden Adern fließe, zog der Gefängnisscherge seinen Kopf mit einem groben Ruck aus dem Wasser.
Mit einem japsenden Laut sog Severin die ersehnte Luft in seine Lungen, während das Wasser über sein Gesicht lief, den Hals hinunter bis in den Kragen seiner Tunika.
Der bärtige Mann, der ihm gegenüber saß, lächelte maliziös, als ob er Gefallen an dieser grausigen Vorstellung fand. Er gab dem anderen ein Zeichen und dieser blieb schweigend neben Severin stehen.
„Also, was ist nun? Wo lagern die Rebellen ihre Waffen? Wirst du es uns endlich sagen? Und wo sammeln sie sich als nächstes und von wo wollen sie angreifen? Wer sind die Anführer? Rede endlich!”
Diese und noch mehr Fragen prasselten auf ihn ein. In Severins Geist blitzten Bilder auf von dem unterirdischen Versteck der Rebellen, so wie es ihm beschrieben worden war und er es sich vorstellte: Eine Höhle am Fuß des Gebirges im Norden, der Eingang so unscheinbar, dass er für eine einfache Felsspalte gehalten werden konnte. Dort lagerten sie einen ganzen Haufen Waffen und noch andere Gerätschaften. Oftmals diente die Höhle auch als Unterschlupf und Versammlungsort, denn in ihrem Inneren war sie ziemlich geräumig.
Vor seinem inneren Auge sah er auch die Gesichter mehrerer Anführer – tapfere Männer und Frauen, die kampferfahren waren und strategisch vorgingen. Einige von ihnen kannte er. Doch von dem Versteck in der Höhle hatte er nur aus zweiter Hand erfahren. Er selbst war nicht dort gewesen und auch der Weg war ihm nicht bekannt.
Severin schüttelte den Kopf. „Nein! Ich weiß das alles nicht!”
„Das ist eine Lüge, das möchte ich wetten. Aber wie du willst.”
Ein weiteres Zeichen an den Schergen neben ihm und die Folter begann aufs Neue. Er hätte nie gedacht, dass er das kühle Nass einmal so hassen würde. Dieser verdammte Kerker!
Später, als sie ihn zurück in die stinkende kleine Zelle brachten, deren Boden mit schimmelndem Stroh bedeckt war, lag dort eine Gestalt zusammengekrümmt in der Ecke. Bisher war Severin allein in der kleinen Zelle gewesen, mit einem weiteren Gefangenen hatte er nicht gerechnet.
Der Wächter schlug die schwere Tür zu und schob knirschend den Riegel vor. Das wenige Licht, welches durch das kleine vergitterte Fenster drang, reichte kaum aus, um die Zelle auszuleuchten. Vorsichtig näherte Severin sich dem am Boden liegenden Mann, der sich nicht rührte. Er trug Sandalen und eine helle, völlig verdreckte Tunika, die an den Ärmeln blutig war, dazu einen schlichten Stoffgürtel. Was hatten die mit ihm gemacht?
Vorsichtig drehte Severin ihn auf den Rücken, da riss der Mann die dunkelbraunen Augen auf und zuckte zurück.
Severin hob beschwichtigend die Hand. „Nur die Ruhe, ich werde dir nichts tun. Ich bin genau so gefangen wie du.”
Vorsichtig setzte sich der Andere auf. Severin betrachtete ihn genauer. Das Gesicht mit den dichten schwarzen Augenbrauen war von einem dunkleren Hautton als sein eigener und voller blauer Flecke, einer davon unter dem rechten Auge. Die Nase leicht schief; vielleicht eine alte Verletzung? An einem Unterarm hatte der Mann eine lange Narbe, die schon älter zu sein schien. Bartstoppeln bedeckten die untere Hälfte seines Gesichts. Bei dem kurzen schwarzen Haar war nicht recht zu erkennen, ob es einfach nur völlig zerzaust oder von Natur aus lockig war. Auf jede Fall war es ziemlich schmutzig. Darunter ragten Ohren hervor, die oben leicht spitz zuliefen.
„Ich bin Severin”, stellte er sich vor.
„Lucius”, murmelte der andere. „Ich hab mich zur Wehr gesetzt, als sie mich eingesperrt haben.”
„Tja, genutzt hat es dir wohl nichts”, erwiderte Severin. Er sah Lucius direkt an. „Ich trage eine wilde Blume in meinem Herzen”, sagte er ernst.
„Und sie wird blühen, wenn der Frühling kommt”, erwiderte Lucius ohne Zögern.
Die vereinbarten Worte, mit denen Rebellen einander erkennen konnten. Zugleich drückte sich darin die Hoffnung aus, dass die Rebellion bald Früchte tragen würde.
Severin seufzte. „Also bist du einer von uns. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte wird dir nicht gefallen.”
Lucius zuckte mit den Schultern. „Was immer es ist, ich werde es schon ertragen.”
„Bist du dir sicher? Sie werden dich foltern. Das haben die Bastarde bei mir auch gemacht, mit einem Eimer Wasser. So harmlos auf den ersten Blick und so grauenvoll, wenn man keine Luft mehr bekommt. Aber ich hab ihnen nichts verraten. Nicht ein Wort.”
Lucius biss sich auf die Lippe. Seine Stirn umwölkte sich und er schwieg einen Moment lang. „Ich werde ihnen auch nichts verraten”, sagte er schließlich leise.
Es kam so, wie Severin befürchtet hatte: Schon am folgenden Tag wurde Lucius von einem Wächter aus der Zelle gezerrt. Er warf Severin einen erschrockenen Blick aus aufgerissenen Augen zu, dann war er fort.
Severin wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, doch es dämmerte bereits, als die Tür erneut aufgeschlossen, und Lucius von dem Wächter in die Zelle gestoßen wurde. Er fiel auf die Knie, Tropfen spritzten von seinen nassen Haaren. Er rappelte sich wieder auf, machte einige unsichere Schritte. Dann schlug er mit der geballten Faust gegen die steinerne Wand und schrie auf. Wieder und wieder donnerte seine Faust gegen die Wand.
„Bist du von allen guten Geistern verlassen?”, rief Severin. Er griff nach Lucius’ Arm, hielt ihn fest. „Hör auf, das bringt doch nichts.”
Lucius entwand ihm den Arm und sah ihn finster an. „Und wohin soll ich mit all meiner Wut? Diese elenden Bastarde!”
„Ja, das sind sie, da gebe ich dir recht. Und der größte von ihnen ist der Tyrann, Salvicius. Du hast ihnen hoffentlich nichts verraten.”
„Nein. Aber ich stand kurz davor. Und ich hatte schon immer Angst vor Wasser. Vor dem Ertrinken, meine ich. Ich kann nicht schwimmen.”
„Oh.” Severin verzog das Gesicht. „Mich haben sie mehrmals gefoltert, immer mit Wasser.”
Lucius biss sich auf die Lippe. „Ich frag mich, warum nur das? Es gibt doch noch ganz andere Folterwerkzeuge.”
Severin überlegte. „Ich weiß nicht, was die noch mit uns vorhaben. Aber es scheint nicht in ihrem Interesse zu sein, uns ernsthaft zu verletzen, sonst würden sie sicherlich noch zu anderen Methoden greifen.”
Lucius ließ sich an der Wand heruntersinken und lehnte sich mit dem Rücken dagegen.
Mittlerweile drang nur noch ein schwacher rötlicher Lichtschein durch das vergitterte Fenster in die Zelle, der mehr und mehr verblasste. Tagsüber waren durch das vergitterte Fenster zwitschernde Vögel zu hören, aber auch das hatte sich nun gelegt. Auf der anderen Seite drangen keine Geräusche bis zu ihnen durch, die Mauern und die massive Tür waren zu dick.
Severin setzte sich ebenfalls, Strohhalme piksten in seine Beine, unangenehm, aber nicht schmerzhaft. Es war kühl in der Zelle, vermutlich mehr als draußen, weil die dicken Steinmauern die Wärme fernhielten.
„Wie bist du zu den Rebellen gekommen?”, fragte er seinen Leidensgenossen.
Lucius antwortete nicht gleich. Es war mittlerweile zu dunkel im Raum, als dass Severin noch die Mimik seines Gegenübers hätte erkennen können.
„Mein Vater war in der kaiserlichen Armee und hat von mir erwartet, dass ich in seine Fußstapfen trete. Er ist vor sieben Jahren gefallen, in der Schlacht im Wald von Sivaern, damals, als der Krieg gegen die Peoritas zu Ende ging. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade meine Grundausbildung als Soldat begonnen.” Er zögerte.
Severin blickte ihn ungläubig an. „Wie kommt ein Soldat zu den Rebellen?“
Lucius runzelte die Stirn. „Spielt das jetzt noch eine Rolle?“
„Erzähl mir davon. Oder hast du was Besseres vor als Reden? Ins Theater gehen oder in eine Taverne?“
Lucius sah auf seine Fußspitzen. „Mach dich nur lustig.”
Severin nickte. „Es tut mir leid. Bitte, erzähl.”
Noch immer zögerte der Andere. Dann holte er tief Luft. „Also, ich bin nach der Ausbildung noch eine Weile bei der Armee geblieben, aber mir war bereits klar, dass ich dort weg wollte. Verstehst du, ich wollte nicht wie mein Vater enden. Aber ich war an den Vertrag gebunden und wenn ich einfach fortgegangen wäre, hätte ich als Deserteur gegolten. Damals habe ich immer mehr über die Politik des Tyrannen gehört und es erfüllte mich mit Grauen. Dass er schon den nächsten Krieg plante, weitere Länder erobern wollte. Dazu ist es ja dann glücklicherweise nicht gekommen, weil sich der Senat gegen ihn gestellt hat. Ich hörte auch, dass er den Vetrusiern ihre Bürgerrechte entziehen wollte. Dass er die Sklavereigesetze verschärfen wollte, sodass flüchtige Sklaven ohne weiteres getötet werden konnten.”
Lucius seufzte. „Und noch andere Dinge, auch einiges an Gerüchten, es ging um Intrigen am Kaiserhof. Davon gab es offenbar eine ganze Reihe. Außerdem so manchen Günstling und Emporkömmling, der dem Kaiser Honig um den Bart schmierte, um sich eigene Vorteile zu verschaffen. Eines Tages erzählte unser Hauptmann von einer neuen Bedrohung – die Widerstandsbewegung. Er sagte, sie hätten sich in den Kopf gesetzt, den Kaiser zu stürzen und eine Republik zu errichten, mit Wahlen und einer Ratsversammlung.”
Lucius hielt kurz inne und im Zwielicht sah Severin, dass er seine Beine in einen Schneidersitz faltete.
„Unser Hauptmann lachte darüber und sagte, das sei sicher ein unorganisierter Haufen, den wir schon bald unschädlich machen würden. Und wenig später gab es einen Einsatz meiner Kohorte gegen eine Rebellengruppe. Ich hab nicht lange überlegt, es erschien mir wie ein Geschenk des Himmels. Hinter einem Schuppen hab ich mir die Soldatenabzeichen und die Insignien des Kaisers von der Rüstung gerissen, den Helm abgenommen, mein Gesicht mit Schlamm unkenntlich gemacht und mich auf die Seite der Rebellen geschlagen.”
„Das ist ganz schön mutig. Und dich hat niemand von den Soldaten erkannt?”
„Vielleicht schon, aber in einem Kampf bleibt schließlich keine Zeit für Gespräche.”
„Allerdings.”
„Seitdem bin ich bei den Rebellen. Über ein Jahr. Und du?”
„Ich gehöre zu den Vetrusiern, denen der Tyrann die Bürgerrechte entzogen hat.”
„Oh ...”
„Ich hab dann eine Ausbildung als Leibwächter gemacht”, erklärte Severin. „Viele andere Möglichkeiten hat man ja ohne die Bürgerrechte nicht mehr, ich meine, abgesehen von dienenden Tätigkeiten. Also habe ich Faustkampf und Schwertkampf gelernt. Ich hab‘s auch mit Bogenschießen probiert, aber das kann ich nicht so gut, ich hab Probleme mit den Augen. Zumindest bei Dingen, die weiter entfernt sind.”
Er seufzte. „In den letzten Jahren hatte ich viele wechselnde Auftraggeber. Adlige, die mich angestellt haben, um ihre Töchter und Frauen zu bewachen. Wobei es dem einen wohl mehr darum ging, seine Frau von der Untreue abzuhalten, denn die konnte ganz gut auf sich selbst aufpassen. Ich stand auch gelegentlich im Dienst von Handeltreibenden, deren Wagen ich gegen Wegelagerer verteidigen sollte. Und ich hab Diplomaten auf Reisen begleitet. Bis ich von den Rebellen erfuhr. Seitdem kämpfe ich an ihrer Seite. Damit der Tyrann abgesetzt wird, mitsamt seiner Familie. Ich möchte, dass wir Vetrusier unsere Bürgerrechte wiederbekommen und der Senat vom Volk gewählt wird.”
„Ich verstehe.”
Einen Moment lang schwiegen sie beide.
„Wartet eigentlich jemand zu Hause auf dich?”, fragte Lucius schließlich. „Ich meine, eine Frau, oder …”
„Nein, niemand.”
„Hast du denn noch Familienangehörige?”
„Nur meinen Vater. Ich habe bei ihm gewohnt, bevor ich mich den Rebellen anschloss.” Er lächelte schief, aber das war in der Dunkelheit sicher nicht zu sehen. „Ausgerechnet in der Kaisergasse in Damascurdia. Was für eine Ironie … Meine Mutter ist vor drei Jahren gestorben. Ich hatte einen älteren Bruder, aber der lebt schon lange nicht mehr. Eine schwere Lungenentzündung, in einem der harten Winter. Ich wäre damals auch fast draufgegangen.”
„Oh … das tut mir leid.”
„Danke. Wie gesagt, es ist schon lange her. Und wie ist es bei dir? Wartet jemand auf dich?”
„Nein, auch nicht.” Lucius zögerte ein weiteres Mal. „Ich hatte einen Gefährten, aber das war vor meiner Soldatenausbildung. Wir haben uns aus den Augen verloren, denn Naevius ist nach Damascurdia gegangen, um dort an einer Akademie zu studieren und ich blieb in unserer Heimatstadt Calpanea. Meine Mutter und ihre Eltern leben auch dort. Ich habe zwei Schwestern, die eine ist verheiratet und kümmert sich um die Kinder, die andere ist Gelehrte geworden, sie erforscht die Natur, gemeinsam mit ihrem Mann. Als ich das letzte Mal von ihnen hörte, wollten sie auf die Insel Nitrisestra, um dort eine seltene Heilpflanze zu finden.”
„Ich verstehe.” Severin lag eine Frage auf der Zunge, allerdings war das eine sehr persönliche und sie beiden kannten sich gerade mal wenige Stunden. Andererseits, Lucius hatte ihm verraten, dass er einen Gefährten gehabt hatte, was wiederum auch ziemlich persönlich war. Außerdem gab es hier drinnen kaum etwas anderes zu tun, als sich voneinander zu erzählen. „Bevorzugst du Männer?”, fragte er deshalb.
„Du bist ziemlich neugierig.”
Severin lachte. „Du hast damit angefangen, als du gefragt hast, ob jemand zu Hause auf mich wartet. Und als du deinen Gefährten erwähnt hast.”
„Also gut. Ja, wenn du es genau wissen willst.”
„Das geht mir auch so. War schon immer so, seit ich ein Jugendlicher war.”
„Aber du hast nie jemanden gefunden, der …”
„Ja und nein. Ich habe gelegentlich mit anderen das Bett geteilt. Aber mehr ist nie daraus geworden. Und mein Vater liegt mir immer noch in den Ohren, wann ich endlich heirate und Kinder in die Welt setze.”
„Ah, ein Traditionalist?”, fragte Lucius und klang nicht überrascht.
In ganz Ithyrios wurden Beziehungen zwischen Männern und zwischen Frauen geduldet. Allerdings erwarteten die meisten Familien, dass sich ihre Söhne und Töchter den Traditionen beugten und irgendwann doch heirateten und Kinder bekamen, schließlich ging es nicht selten um ein Erbe, das weitergegeben werden sollte. Für manche Leute bildeten dann Dreiecksbeziehungen einen Ausweg – Eheleute, die eine Beziehung mit einer weiteren Person eingingen. Severins Vater war in der Tat traditionell eingestellt, kein Wunder, dass er noch immer darauf hoffte, dass sein Sohn heiratete.
„Genau, die Familie muss fortgeführt werden. Aber ich habe mich noch nie zu Frauen hingezogen gefühlt”, sagte er nun. „Ich schätze sie durchaus als Gesprächspartnerinnen, als Kampfgefährtin oder in anderen Professionen und natürlich als Mütter, oder was sie sonst für Aufgaben in ihrem Leben übernehmen wollen. Aber ich möchte mit ihnen nicht das Bett teilen. Ich habe es versucht, doch es hat mir nicht gefallen.”
„Da geht es dir ähnlich wie mir”, sagte Lucius. „Erzähl mir etwas von den Vetrusiern. Sind sie nicht aus dem Norden eingewandert?”
„Ja, das stimmt. Vor etwa sechzig Jahren gab es in der Heimat meines Volkes – die Vjætrusor, wie wir uns selbst nennen – starke Kälteeinbrüche, die monatelang anhielten. Bald gab es kein Wild mehr zu jagen und das Getreide konnte in der eisigen Kälte nicht gedeihen. Also haben sich viele Vjætrusor in den dünn besiedelten Gebieten im Norden vom Ithyrios niedergelassen. Und manche von ihnen, wie meine Großeltern, sind in die größeren Städte abgewandert.”
Draußen krächzte eine Krähe, im nächsten Moment erklang das Flattern von Flügeln. Severin blickte Lucius direkt an. „Mein richtiger Name ist übrigens Sværin. Aber weil das kaum jemand gut hierzulande aussprechen kann, haben mir meine Eltern stattdessen den ithyrischen Namen Severin gegeben. Als Rufname. Und mittlerweile ist er mir in Fleisch und Blut übergegangen.”
„Ah, ich verstehe. Mein zweiter Name ist übrigens elfisch.”
„Oh. Ich hatte mich schon gefragt, ob du ein Elf bist.”
„Halbelf. Und mein zweiter Name ist Ithildorin, nach meinem Großvater. Aber Lucius ist mein Rufname.”
Severin rief sich ins Gedächtnis, was er über die ithyrischen Elfen wusste. Die meisten von ihnen lebten im Süden des Landes, in den Waldgebieten bei Calpanea oder in der Stadt selbst. Sie waren ein alteingesessenes Volk, das eigentlich schon immer im Land lebte, und im Gegensatz zu den Einwanderern besaßen sie die vollen Bürgerrechte. Allerdings war ihre Gemeinschaft im Laufe der Zeit geschrumpft, zumindest hatte er davon gehört. Außerdem sagte man ihnen nach, dass sie eher unter sich blieben. Was aber offenbar nicht für alle galt, sonst säße nun sicherlich kein Halbelf vor ihm.
Manche Barden besangen gern die Schönheit und die Kunstfertigkeit der Elfen, aber vermutlich wurden dabei auch so einige Klischees breitgewalzt. Lucius sah – wenn man sich all den Dreck wegdachte – gar nicht schlecht aus, aber eine ausgesprochene Schönheit war ihm nicht zu eigen.
„Sag mal, wie kam es dazu, dass der Kaiser deinem Volk die Bürgerrechte entzogen hat?”, riss der Halbelf ihn aus seinen Gedanken.
Severin runzelte die Stirn. „Sein Vorgänger hat verfügt, dass allen Vjætrusor, die seit zwanzig oder mehr Jahren hier leben, als Bürger anerkannt werden. Das betraf meine Großeltern und meine Eltern, später auch mich. Aber Kaiser Salvicius hat diese Bürgerrechte wieder aufgehoben. Angeblich, weil mein Volk mittlerweile in den Norden zurückkehren könnte, weil die Winter dort nicht mehr so schlimm seien. Aber das ist nicht wahr”, sagte er mit Nachdruck.
Er verstummte für einen Moment, als ganz in der Nähe eine Tür krachend ins Schloss fiel.
„Jedenfalls, ich hab mehr als einmal gehört, dass jene, die noch dort leben, immer wieder mit starkem Frost und Unwettern zu kämpfen haben. Durchreisende und Handeltreibende erzählen davon. Außerdem haben die meisten von uns nun in Ithyrios eine Existenz aufgebaut, viele über Jahrzehnte hin. Der Erlass des Tyrannen ist eine Katastrophe! Meine Leute dürfen weder studieren, noch Geschäfte eröffnen oder Land kaufen. Eine Lehre beginnen, das ist ebenfalls verboten. Die vetrusischen Landwirte werden gerade noch geduldet, aber sie müssen, wie auch die langjährigen Einheimischen, hohe Abgaben entrichten, um die Kornkammern des Landes zu füllen. Die Möglichkeiten, überhaupt einen Beruf zu ergreifen, sind für uns seit dem Erlass stark eingeschränkt.”
Ein Schrei irgendwo im Gefängnis ließ sie beide zusammenzucken.
„Das wusste ich nicht. Nicht mit all diesen Einzelheiten.” Lucius’ Miene verfinsterte sich. „Auf jeden Fall ein Grund mehr, den Kaiser abzusetzen.”
Severin nickte ihm zu. „Wohl wahr.” Sein Blick wanderte zu Lucius’ Ohren, deren Spitzen aus dem dunklen, lockigen Haar hervorragten.
„Sag mal, wenn du Kinder hättest, würden sie runde Ohren oder spitze haben?” Die Frage rutschte ihm heraus, ehe er weiter darüber nachdenken konnte.
„Wie bitte?”
„Nun, ich meine, weil du doch ein Halbelf bist?”
Lucius zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Aber das werde ich auch wohl nie herausfinden.”
„Ich hoffe, ich bin dir nicht zu nahegetreten.”
„Schon gut. Ich hab mir schon ganz anderes Zeugs anhören müssen. Weder ein richtiger Mensch, noch ein richtiger Elf, und so was.”
„Das tut mir leid”, sagte Severin leise.
„Das muss es nicht”, erwiderte der sein Gegenüber. Mittlerweile war es fast ganz dunkel geworden.
Lucius gähnte deutlich hörbar. „Lass uns morgen weiterreden. Ich bin ziemlich müde.”
„Geht mir ähnlich”, gab Severin zu.
Sie beide legten sich auf den Boden, drehten sich geräuschvoll im Stroh.
Severin wünschte seinem Leidensgenossen eine gute Nacht.
„Dir auch”, erwiderte Lucius. Wenig später hörte Severin dessen ruhige Atemzüge, ein Geräusch, das ihn selbst allmählich in den Schlaf wiegte.