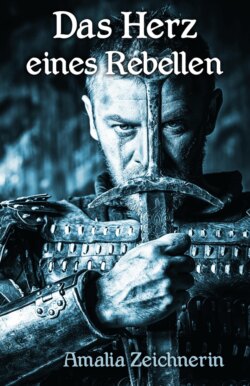Читать книгу Das Herz eines Rebellen - Amalia Zeichnerin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII
Draußen erklang der Ruf einer Eule. Mondlicht drang durch das kleine vergitterte Fenster in die Zelle. Lucius lag auf dem Boden, auf dem piksenden Stroh, doch er konnte nicht schlafen. Fünf Tage waren vergangen. Fünf endlose Tage in diesem scheußlichen, stinkenden Kerker. Und der Fraß, den man ihnen vorsetzte, hätte er keinem Hund serviert – ein undefinierbarer, fader Getreidebrei.
Sein vetrusischer Leidensgenosse hatte kurzes braunes Haar und ein kantiges Gesicht, in das sich die Spuren seines Lebens eingezeichnet hatten. Da war zum Beispiel eine kleine Narbe am Kinn, die allerdings von Bartstoppeln weitgehend verdeckt wurde. Die Farbe seiner blaugrauen Augen erinnerten Lucius an die Wolken bei einem Gewitter.
Severin hatte recht behalten; auch Lucius war gefoltert worden. Wieder und wieder hatten sie seinen Kopf ins Wasser gedrückt, bis sich die Todesangst wie tausend spitze Nadeln angefühlt hatte, die seinen Körper durchbohrten. Aber kein Wort war über seine Lippen gekommen, er hatte geschwiegen, nichts preisgegeben.
Irgendwann floh er innerlich, an einen hellen, ruhigen Ort in seiner Vorstellung, sodass er von außen auf sich herabblicken konnte, während ihm der Gefängnisaufseher mit bellender Stimme seine Fragen stellte. Lucius sah ihn an, doch nicht richtig, er schaute durch ihn hindurch.
Auf diese Weise floh er ein weiteres Mal, als sie die Prozedur am folgenden Tag wiederholten. Dreimal hatten sie ihn mittlerweile gefoltert, und auch Severin hatten sie wieder aus der Zelle gezerrt.
Lucius hatte die Rebellen nicht verraten, trotz allem, doch ihm graute vor dem nächsten Tag. Er richtete sich halb auf, lehnte seinen Rücken an die kalte Steinwand. Was, wenn sie ihn erneut folterten? Wie lange konnte er dem noch standhalten? Was, wenn er den ruhigen Ort in seiner Vorstellung nicht wiederfand und sich der Folter ohne diesen geistigen Schutz aussetzen musste? Auch hatte er Angst, dass sie noch zu anderen Methoden greifen würden, um die Geheimnisse der Rebellen aus ihm herauszupressen.
Die Gedanken wirbelten in seinem Kopf umher. Sein Herzschlag beschleunigte sich und seine Haut war klamm, kalter Angstschweiß hatte sich auf ihr gebildet. Die ganze ausweglose Situation brach in seinem Inneren über ihm zusammen, wie eine gewaltige Welle in der Brandung des Meeres. Lucius begann zu schluchzen. Sein Gesicht verkrampfte sich zu einer Maske aus Schmerz, während ihm Tränen die Wangen herunterliefen.
„Was ist denn los?”, erklang auf einmal Severins Stimme neben ihm. Im Schein des Mondlichts bemerkte er, dass dieser ihn ansah.
„Ach, es ist nur … alles. Dass wir im Gefängnis festsitzen und gefoltert werden. Es macht mir eine verdammte Angst. Was werden die noch mit uns machen!?”
Severin richtete sich wortlos auf und erhob sich. Dann setzte er sich direkt neben ihn.
Lucius kämpfte gegen die Tränen an, er wischte sich mit dem Handballen über die Augen.
Das Mondlicht fiel seitlich auf sein Gesicht, eine Hälfte verschwand im Schatten. „Es geht mir kaum anders als dir. Ich kann es nur besser verbergen. Weine nur, wenn es dir hilft – wir sind hier unter uns. Aber lass sie deine Tränen nicht sehen. Sie verachten uns ohnehin schon, und das werden sie noch mehr, wenn sie sehen, wie es dich mitnimmt.”
Plötzlich strich er mit drei Fingern sanft über Lucius’ Wange. Lucius zuckte zusammen, er hatte diese Berührung nicht kommen sehen. Severin fuhr der Spur der Tränen nach, als ob er sie ihm aus dem Gesicht wischen wollte. Hatte er sie im Mondlicht glänzen sehen?
„Entschuldige”, sagte Severin und zog seine Hand zurück.
Einem Impuls folgend, griff Lucius nach Severins Hand und drückte diese kurz. „Schon gut. Dein Trost ist mir willkommen, ich bin nur verdammt schreckhaft geworden.”
„Das ist wohl besser so. Ich meine, es erhöht deine Überlebenschancen. Versuch zu schlafen. Wer weiß, was morgen sein wird.”
„Du hast recht”, erwiderte Lucius.
Severin stand auf und legte sich auf die andere Seite der Zelle. Lucius folgte seinem Beispiel, doch es dauerte lange, bis ihn der Gott des Schlafes in sein Reich holte.
Am folgenden Tag wurden sie beide schon früh aus ihrer Zelle gezerrt. Diesmal führte sie allerdings kein Wächter in eine Folterkammer, stattdessen legten die Gefängniswärter ihre Hände in Ketten und brachten sie nach draußen, vor das Gebäude. Lucius blinzelte in das Licht des frühen Morgens, das ihm viel zu grell erschien nach der langen Zeit in der stinkenden Zelle, in die kaum ein Sonnenstrahl gedrungen war.
Zwei große, vergitterte Gefährte aus massivem Holz standen dort, vor die Pferde gespannt waren.
Er wechselte einen verwirrten Blick mit Severin, der noch immer neben ihm stand. Sollten sie in ein anderes Gefängnis verlegt werden? Severin schüttelte nur stumm den Kopf und zuckte mit den Schultern. Er schien ebenso ratlos zu sein.
„Weiter!”, rief einer der Wärter und Lucius stolperte vorwärts. Noch mehr Gefangene wurden nach draußen getrieben. Sie alle waren gefesselt oder in Ketten gelegt, flankiert von Kerkerschergen, die Dolche und Kurzschwerter trugen.
Lucius rechnete sich seine Chancen aus. Der Platz vor dem Gefängnis war ringsum von einer hohen Steinmauer umgeben, ein massives zweiflügeliges Tor der einzige Weg nach draußen. Und angesichts der vielen bewaffneten Wächter kam eine Flucht nicht in Frage. Zwei Männer öffnete die Türen der Fahrzeuge und die ersten Gefangenen wurden von weiteren Wärtern hineingestoßen.
„Rein da!”, befahl einer von ihnen, ein Mann mit einem groben, verlebten Gesicht, das von einer Narbe verunstaltet war.
Er machte Anstalten, Lucius anzufassen, doch er wich dem Kerl aus. „Ich gehe schon von allein”, sagte er mit tonloser Stimme, während es in seinem Inneren brodelte.
Severin wurde in dasselbe Gefährt verfrachtet wie er selbst. Bei allem Elend war ihm das ein Trost. Bald wurde es eng in dem Wagen. Lucius zählte vierzehn Gefangene, darunter auch mehrere Frauen. Sie alle hatten schmutzige Gesichter und zerzaustes Haar, die Kleidung war fleckig und von vereinzelten Strohhalmen bedeckt. Sicherlich sah er selbst kaum besser aus, aber das spielte ohnehin keine Rolle.
Als sich das Gefährt rumpelnd in Bewegung setzte, merkte Lucius bald, dass er Schwierigkeiten hatte, das Gleichgewicht zu halten. Sitze gab es nicht. An einer der Gitterwände ließ er sich auf den Boden sinken. Severin machte es ihm nach.
„Wo werden sie uns hinbringen?”, fragte eine Frau, deren langes braunes Haar struppig wirkte.
„Vielleicht ein anderes Gefängnis”, mutmaßte ein etwas älterer Mann mit einem graumelierten Vollbart. „Oder auf einen der Sklavenmärkte.”
Die Frau verzog das Gesicht. „Oh, nein …”
„Verdammt!”, sagte Severin grollend.
Eine Welle der Übelkeit überschwemmte Lucius’ Magen, und das lag nicht an dem Rumpeln des Wagens. Eines der erklärten Ziele der Rebellen war es, die Sklaverei abzuschaffen oder aber wenigstens zu reformieren, um bessere Lebensbedingungen für die Sklavinnen und Sklaven zu schaffen. Lange Zeit hatten verschiedene Bürgergruppen versucht, dies auf friedlichem Weg zu erreichen, doch sie waren an dem beharrlichen Widerstand des Kaisers und vieler Adliger gescheitert.
Seine Gedanken rasten. Wenn die Regierung nun ihrerseits Leute aus dem Widerstand versklavte, schaffte sie diese nicht nur aus dem Weg, weg von den Kriegsschauplätzen, sondern erzielte damit für sich einen praktischen Nutzen, weil sie auf diese Weise den Adligen und wohlhabenden Bürgern kostenlose Arbeitskräfte zur Verfügung stellte. Die Übelkeit in seinem Inneren nahm zu. Zugleich ergriff ohnmächtige Wut von ihm Besitz, sodass er unwillkürlich die Fäuste ballte.
Eine junge Frau begann leise, fast lautlos, zu weinen. Der Mann neben ihr nahm sie in den Arm. „Noch sind die Würfel nicht gefallen”, sagte er zu ihr. „Sie, deren Name nicht genannt werden soll, wird uns beschützen.”
Die Schicksalsgöttin. Nach alten Überlieferungen brachte es Unglück, ihren Namen auszusprechen.
Severin redete mit dem Gefangenen, der sich neben ihm niedergelassen hatte, ein hagerer, sehniger Mann mit einer rötlichen Narbe am Arm. Lucius lauschte der Unterhaltung.
„Warum wart ihr im Kerker?”
„Kann ich nicht sagen. Besser, ihr wisst es nicht.”
Severin flüsterte dem Mann etwas ins Ohr, und dieser antwortete ihm auf dieselbe Weise.
„Seid ihr auch gefoltert worden?”, fragte Severin danach in gewöhnlicher Lautstärke
„Ja, aber ich hab das schweigend über mich ergehen lassen.”
Severin nickte ihm zu.
„Wisst ihr, wohin diese Straße führt?”, erkundigte sich Lucius bei dem Fremden.
„Nach Serdicia, wenn mich nicht alles täuscht. Von Zeit zu Zeit gibt es dort tatsächlich einen Sklavenmarkt, der wird in der Halle abgehalten, in der sonst das Vieh verkauft wird. Habe ich jedenfalls gehört.”
Lucius runzelte die Stirn. Bei allem, was ihm heilig war, das waren verdammt düstere Aussichten …
Severin nickte dem Mann zu, sagte aber nichts.
Ein hochgewachsener Mann untersuchte unauffällig das Schloss an der Tür ihres fahrenden Gefängnisses, obwohl seine Handgelenke gefesselt waren. „Das hat keinen Zweck”, sagte er nach kurzer Zeit mit niedergeschlagener Miene.
Lucius sah zur Tür hinüber, die mit einer massiven Eisenkette zugesperrt war. Kein Ausweg. Aber vielleicht konnten Severin und er fliehen, wenn sie in Serdicia angekommen waren?
Seltsam, mit welcher Selbstverständlichkeit er nicht nur an sich, sondern auch seinen Leidensgenossen dachte, obwohl er diesen erst wenige Tage kannte. Aber warum auch nicht? Sie hatten schließlich ihre Lebensgeschichten ausgetauscht, waren einander nicht mehr fremd. Außerdem gehörte Severin ebenfalls zum Widerstand, was ihn im Grunde zu seinem Waffenbruder machte.
Noch immer blinzelte er angesichts des Sonnenlichtes, das nun an Stärke gewann und direkt in den vergitterten Wagen schien. Singvögel zwitscherten in den Bäumen an beiden Seiten der Straße, darunter hohe Zypressen. Der Fahrtwind war wie eine frische Brise. Es kam ihm vor, als ob das heitere, milde Wetter und der muntere Gesang der Vögel ihn verhöhnten.
Immer weiter fuhr das Gefährt über die unebene Straße. Manche der Gefangenen unterhielten sich leise, während die Frau, die vorhin geweint hatte, nun apathisch in die Ferne starrte.
Bis auf den hageren Mann, der mit Severin gesprochen hatte, und noch ein, zwei weitere Gefangene sahen diese Leute im Wagen nicht wie Krieger aus. Weder trugen sie Narben noch andere Hinweise auf alte Verletzungen, allerdings hatten einige blaue Flecken. Aber die waren vermutlich durch die grobe Behandlung der Gefängniswärter entstanden. Die Gefangenen waren auch nicht gerade muskulös, wirkten kaum durchtrainiert. Ein schon etwas älterer Mann war eher rundlich, ein anderer schlaksig, beinahe dürr.
Lucius war nicht nach einer Unterhaltung zumute, denn die Übelkeit in seinem Inneren verstärkte sich noch durch das Rumpeln des Wagens. Er hielt sich den Magen, hoffte, sich nicht in der Enge zwischen all den Leuten übergeben zu müssen.
Severin schwieg ebenfalls, seine gewittergrauen Augen wirkten dunkler als sonst.
Die Sonne erreichte den Zenit und es wurde recht warm. Oder vielleicht lag es einfach daran, dass sie dichtgedrängt in diesem Wagen ausharren mussten? Er hatte Durst, doch bei dem bloßen Gedanken, etwas zu trinken, steigerte sich seine Übelkeit. Aber es spielte keine Rolle, denn sie hatten ohnehin kein Wasser im Wagen.
Sie passierten ein schmales Wäldchen, dessen Bäume einen erdigen, frischen Geruch zu ihm herübertrugen. Später folgte eine wilde Landschaft mit Grasbewuchs und Büschen, die schließlich in Weideland und Felder überging. Auf einem der Felder befanden sich einige Männer und zwei Ochsen, die vor Pflüge gespannt waren.
„Wie ich dachte, das ist Serdicia”, sagte der hagere Mann mit der Narbe wenig später und deutete auf eine Ansammlung von Häusern und Türmen, die sich vor ihnen erstreckte.
Schon bald erreichten sie die Stadtmauer, dort hielten die Wagen vor dem massiven geöffneten Tor, an dem sich mehrere Wächter aufhielten. Lucius konnte nicht hören, was weiter vorn gesprochen wurde, doch es dauerte nicht lange, ehe sich die Gefährte erneut in Bewegung setzten. Die staubige Straße war in der Stadt an den Seiten mit Steinen befestigt. Sie fuhren vorbei an kleineren und größeren Häusern, manche davon aus Stein, andere aus Holz. Reiter passierten ihren Weg, Bauern mit ihren vollbeladenen Karren, bis hin zu Kindern, die fröhlich lärmend am Straßenrand spielten. Lucius nahm das alles nur am Rande wahr, denn der schmerzende Knoten in seinem Magen nahm inzwischen seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch.
Die Gefängniswagen wühlten sich durch den Verkehr, bis sie schließlich vor einem großen steinernen Gebäude hielten, in dessen Nähe sich mehrere Marktstände befanden.
Ein reges Treiben herrschte dort, Händler priesen ihre Waren an, Marktschreier waren über den ganzen Platz hinweg zu hören. Zahlreiche Stadtbewohner schlenderten zwischen den Ständen hindurch, manche von ihnen beladen mit Körben oder Beuteln. Aus mehreren Holzkäfigen drang das Gackern von Hühnern und die Geräusche anderer Vögel. Die Ausdünstungen von Unrat, der am Straßenrand lag, vermischten sich mit den Gerüchen von rohem Fleisch, frisch gebackenem Brot und verschiedenen Gewürzen, eine Mischung, die Lucius‘ Übelkeit noch weiter befeuerte.
Als ein bewaffneter Mann die Tür des Wagens öffnete, erkannte Lucius, dass es kein Entkommen gab. Zwar hätte der Markt in unmittelbarer Nähe gute Möglichkeiten geboten, ungesehen in der Menge unterzutauchen, doch so weit würde er gar nicht kommen; eine ganze Reihe an Bewaffneten hatte sich unmittelbar vor den Wagen in einem Halbkreis aufgestellt, mit griffbereiten Schwertern und Dolchen. Sie trugen rote Tuniken und darüber schwere Lederrüstungen, während ihre Arme und Beine von metallenen oder ledernen Schienen geschützt wurden, wie sie auch die Soldaten des Kaisers im Kampf trugen. Lucius vermutete, dass es sich um Stadtwachen handelte, denn diese trugen meistens Rot. Auch die Machart der Rüstungen sprach dafür.
Einige dieser Männer trieben nun die Gefangenen aus den beiden Wagen in das große Gebäude. Lucius stolperte, als er aus dem Gefährt kletterte. Einer der Wächter griff nach seinem Arm und zerrte ihn grob weiter. Er wehrte sich nicht dagegen, um sich nicht noch mehr Ärger einzufangen. Severin war noch immer in seiner Nähe.
Im Inneren des Gebäudes, dessen Dach von Säulen getragen wurde, war es ein weniger kühler. Dort gab es eine weitläufige Halle, auf deren Boden eine dünne Schicht Stroh lag. Eine Markthalle für Vieh, erinnerte Lucius sich an die Worte des hageren Mannes, der irgendwo zwischen den anderen Gefangenen verschwunden war.
Lucius und seine Leidensgenossen mussten sich in einer Schlange aufstellen, die langsam die Halle durchquerte, bis hin zu deren anderen Ende. Mit einem Mal stand Severin nicht mehr in seiner Nähe. Suchend blickte er sich um. Und was hatten die Wächter mit ihnen vor?
Nach kurzer Zeit erklang draußen ein gellender Schrei und ein seltsamer Geruch erreichte seine Nase. Irgendetwas brannte. Nein, das war … verbranntes Fleisch. Nackte Angst fraß sich in seine Eingeweide. Lucius entdeckte Severin, dieser stand nun etwas weiter hinten in der Schlange.
„Los, weiter!”, herrschte ihn einer der Wächter an und er stolperte zwischen zwei der Säulen hindurch ins Freie.
Direkt vor der Halle brannte ein Feuer in einer Feuerschale. Zwei Wächter, ebenfalls in roten Tuniken, hielten einen der Gefangenen fest. Ein dritter Mann, der eine helle Tunika und eine Lederschürze trug, hob einen rotglühenden Eisenstab und presste das untere Ende dem Mann auf die Innenseite von dessen Handgelenk.
Lucius erstarrte. Ein Brandzeichen! Der Mann schrie erst auf und wimmerte dann vor Schmerz. Der Anblick und der grässliche Geruch waren zu viel für Lucius – er brach in die Knie und übergab sich, als eine ätzend-saure Flüssigkeit seine Kehle hochschoss. Einer der Wächter zerrte ihn vom Boden hoch, als das Würgen endlich aufhörte.
„Zurück in die Schlange!”, verlangte der Mann mit grimmiger Miene und stieß ihn zwischen zwei andere Gefangene, die ihm Platz machten.
Er schaute sich um. Eine Flucht war unmöglich, die Wächter hätten ihm sofort den Weg versperrt oder Schlimmeres mit ihm gemacht. Außerdem endete der Platz hinter der Halle an einem hohen Zaun. Was dahinter lag, wusste er nicht und bis er dort hinaufgeklettert wäre, hätten ihn diese Bastarde längs mit ihren Schwertern bearbeitet. Hilfe konnte er ebensowenig erwarten. Zwar waren weniger Wächter als Gefangene anwesend, doch die meisten der Männer und Frauen, die hierhergebracht worden waren, machten auf ihn nicht gerade den Eindruck, dass sie erfahrene Kämpfer seien.
Und selbst wenn es der Fall gewesen wäre, war es so gut wie unmöglich, einem Krieger das Schwert abzunehmen, wenn man selbst unbewaffnet war. Vor allem dann nicht, wenn man keine Kampferfahrung hatte. Aber selbst für ihn war es in dieser Situation zu riskant.
Die Zeit rannte ihm davon, während die Menschenschlange vor ihm immer kürzer wurde. Der Geruch nach verbranntem Fleisch wurde immer stärker, je mehr von den Gefangenen das Brandzeichen erhielten. Schreie und schluchzende Laute erfüllte die Luft, oftmals überlagert von den lauten Rufen und Befehlen der Wächter.
Sie kannten keine Gnade, selbst eine junge Frau, die kaum erwachsen war, wurde gebrandmarkt. Weinend brach sie zusammen und wurde mit einem groben Griff beiseitegeschoben, um Platz zu schaffen für den nächsten Unglückseligen.
Wie schon auf der Fahrt erfasste Lucius eine ohnmächtige Wut. Was ihnen hier angetan wurde, war grausiges Unrecht. Wenn er es doch nur irgendwie verhindern könnte!
Dann war er selbst an der Reihe. Ein Wächter entfernte die Kette von seinen Handgelenken. Er spielte mit dem Gedanken, diesem einen Kinnhaken zu verpassen und doch zu fliehen, aber schon hielten ihn zwei weitere Wächter fest. Einer von ihnen streckte Lucius’ Arm dem Brandeisen entgegen. Er wehrte sich, versuchte sich loszureißen, doch der Griff des Wächters war so hart, dass er es nicht vermochte. Dessen Fingernägel bohrten sich ihm schmerzhaft in die Haut.
Doch das war nichts im Vergleich zu dem anderen Schmerz, der auf ihn wartete. Seine Haut dampfte und es gab einen hässlich zischenden Laut, als der Mann mit der Lederschürze ihm das glühende Brandeisen auf die Innenseite seines linken Handgelenks presste.
Ein sengend heißer Schmerz barst auf seiner Haut, kroch rasch hinauf bis in seinen Oberarm. Das zwang ihn in die Knie und er schrie auf. Tränen traten ihm in die Augen. Einer der Wächter zerrte ihn hoch, was den Schmerz noch verdreifachte. Lucius taumelte, er konnte sich kaum auf den Beinen halten.
Ungläubig starrte er auf das rote „S”, das sich nun auf seinem Handgelenk abzeichnete. Sklave.
Im nächsten Moment wurde er beiseitegezogen, bekam nun von einem anderen Mann Fußfesseln verpasst. Diese bestanden aus einem fast schulterbreiten Eisenstab, an dessen beiden Enden sich Ketten befanden. Letztere schnitten ihm in die Fußgelenke, ein weiterer Schmerz, der aber keine Sekunde lang seine verbrannte Haut vergessen machte.
„Rein da!”, bellte ihn ein Wächter an und deutete auf die Halle. Mit den Fußfesseln musste er breitbeinig gehen und kam nur langsam voran. Lucius stolperte hinter anderen Gefangenen her, die sich wankend vorwärtsbewegten.
In der Halle mussten sie sich in mehreren Reihen aufstellen, während die Wächter sie alle scharf beobachteten. Lucius hatte Mühe, überhaupt stehenzubleiben. Immer mehr Gefangene strömten herein, ihre Bewegungen aufgrund der Fußfesseln unsicher, schwankend. Viele von ihnen weinten, und nicht nur Frauen.
Lucius wischte sich über das tränenverschmierte Gesicht. Wo war Severin? Eine plötzliche Welle von Panik überfiel ihn bei dem Gedanken, dass er den Vetrusier vielleicht nicht wiedersehen würde.
Die Anspannung fiel von ihm ab, als er Severin doch noch bemerkte. Ihre Blicke trafen sich. In Severins Miene erkannte er eine Mischung aus Schmerz und Zorn. Einer der Wächter schubste seinen Leidensgenossen in eine Reihe vor ihm und wandte sich danach einem anderen Gefangenen zu.
Severin sah kurz über seine Schulter, musterte Lucius ein weiteres Mal. Im nächsten Moment machte er zwei Schritte rückwärts und stellte sich direkt neben Lucius, der beiseitetrat, um ihm Platz zu machen. „Vielleicht können wir zusammenbleiben”, murmelte er kaum hörbar.
Lucius nickte wortlos, denn dasselbe hoffte er auch.