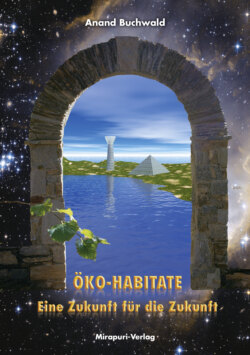Читать книгу Öko-Habitate – Eine Zukunft für die Zukunft - Anand Buchwald - Страница 11
Gemeinschaft
ОглавлениеFür das Entstehen und Gedeihen der Öko-Habitate gibt es neben der Bewusstseinsentwicklung eine weitere wichtige Voraussetzung. Es ist nicht damit getan, ein Öko-Habitat mit enthusiastischen Öko-Freaks und Fortschrittsbeflissenen zu füllen. Mit genügend Bewusstsein und Gutwillen werden sie zwar imstande sein, die technischen Abläufe zum Funktionieren und Ineinandergreifen zu bringen, aber das Ergebnis wird nur eine perfekte technokratische Struktur sein. Um die zukünftigen Lebensräume wirklich mit zukunftsorientiertem Leben zu füllen, ist mehr nötig als die Anwesenheit der optimalen Anzahl von Menschen. Die Menschen müssen auch einen Bezug zueinander haben, der über die Einrichtung und Aufrechterhaltung der Funktionsprozesse hinausgeht.
Wenn dieser Bezug fehlt, wie es zum Beispiel häufig in schnell hochgezogenen Wohnsilo-Ghettos und Trabantenstädten der Fall ist, deren Bevölkerung nicht zusammengewachsen ist, sondern zusammengewürfelt wurde, dann sind soziale Auswüchse die Folge, wie Ghettobildung, Gewaltbereitschaft, Vereinsamung, soziale Kälte und Ähnliches. Was dann fehlt, ist das Wir-Gefühl, der soziale Bezugspunkt, der Rück- und Zusammenhalt und die Wärme der Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft ist ein Grundpfeiler der menschlichen Existenz, wenn nicht sogar des Lebens an sich. Die allerursprünglichste, physische Form der Gemeinschaft ist das Zueinanderfinden der ersten Atome zu großen Gasmassen und zu Molekülen; ihre Verschmelzung, die Fusion zu höherwertigen Elementen, ist sozusagen das Ergebnis oder der Genuss dieser Gemeinschaft. Daraus sind dann in letzter Konsequenz Sonnen und Planeten und ihre Gemeinschaftsformen Galaxien und Sonnensysteme entstanden. Auf dem einen oder anderen dieser Planeten bildete sich dann eine komplexere Form der Gemeinschaft heraus. Es entstand das Leben, zuerst in Form von Einzellern und dann von Mehrzellern, die sich zu Gruppen zusammenfanden und begannen, ihre Umweltbedingungen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Und diese Entwicklung setzte sich in der gesamten Natur fort, mal deutlicher sichtbar, mal fast nicht wahrnehmbar.
Gemeinschaft macht stark und erfolgreich, und u.a. die Gemeinschaft hat es dem Menschen ermöglicht, zur dominierenden Spezies auf diesem Planeten zu werden. Die Gemeinschaft bot nicht nur Schutz vor Feinden und konnte durch Zusammenarbeit eine zuverlässigere Versorgung mit allem bieten, was man zum Leben braucht, sondern sorgte auch für gegenseitige Unterstützung und Hilfe, und bot vor allem auch Wärme und Geborgenheit.
Darum war früher die Gemeinschaft oder der Clan von immenser Bedeutung und kam in den meisten Belangen vor dem Individuum. Wenn man die Natur so betrachtet, könnte man vielleicht sogar sagen, dass das Individuum umso weniger zählt, je größer die Gemeinschaft ist und je straffer sie organisiert ist.
Mit zunehmender Technologisierung des menschlichen Lebens traten aber immer mehr Aspekte des Gemeinschaftswesens in ihrer Bedeutung zurück. Die Entfernungen sind subjektiv geringer und die Mobilität ist größer geworden, so dass für das Individuum die unmittelbare Gemeinschaft immer verzichtbarer wird. Auch die Abhängigkeit der Versorgung hat sich durch Handel und sich immer stärker ausbreitende Geldwirtschaft anonymisiert. Die Funktion des Schutzes wurde an allgemeingültige Gesetze und an den Staat, die Polizei und das Militär delegiert. So ist es nicht verwunderlich, dass sich alle größeren Gemeinschaftsformen nach und nach aufgelöst haben und ein anonymer Staat einen Teil von deren Funktionen übernommen hat. Die Gemeinschaft ist in kleinere Einheiten, die Familien zerfallen, die in kleinerem Rahmen die benötigte emotionale Geborgenheit bieten, aber auch mehr Raum für neurotische Entwicklungen lassen. Mit der stark beschleunigten Entwicklung der letzten hundert Jahre und den vielfältigen technologischen Neuerungen ist die bislang schleichende Individualisierung stark beschleunigt worden. Der Familienverband verliert seitdem immer stärker an Wertschätzung, die Familienstrukturen lösen sich auf und es gibt immer mehr Singles, die nur noch per Geburt und aus Gewohnheit irgendwie Teil einer Familie sind.
Man könnte das auch so formulieren, dass sich archaische und rudimentär tierische, atavistische, fast biologische Gesellschaftsformen in Auflösung befinden. Und während diese Entwicklung weitergeht, setzt in geringem Umfang bereits die Gegenbewegung ein. Die Singles, die sich langsam aus den überkommenen Familienstrukturen lösen, möchten natürlich nicht auf die emotionale Geborgenheit verzichten und schaffen sich neue Strukturen. Statt der biologischen Bindung suchen sie, vereinfacht gesagt, eine Interessenbindung, statt Familienbande knüpfen sie ein Freundschaftsnetzwerk, in dem sie weniger Verpflichtungen und mehr Freiräume haben, die biologische Zwangsgemeinschaft macht einer inneren Gemeinschaftsform Platz, die auf Freiwilligkeit, übereinstimmenden Interessen und innerer Verwandtschaft beruht.
Diese neue Gemeinschaftsform befindet sich noch in den allerersten zarten Anfängen. Der Versuch der 68er Generation war zwar von Begeisterung erfüllt, aber er war letztlich vor allem ein erstes Spiel mit den Möglichkeiten, ein blindes Herantasten an eine unbestimmte Schauung zukünftiger Seinsweisen, ein ungestümer Versuch, die Grenzen der Beschränktheit niederzureißen. Gescheitert sind sie vielleicht daran, dass die Vision nicht weit und authentisch genug war und das Bewusstsein zwar nach Neuem strebte, aber noch gänzlich unvorbereitet war und eigentlich noch immer tief in der verhassten Spießerwelt wurzelte. Und doch haben sie einen Anstoß gegeben und einem Traum zu größerem Leben verholfen, der sich undeutlich und verschwommen in immer mehr Menschen abzeichnet.
Das, was sich jetzt herauszubilden beginnt, ist immer noch geprägt von alten Verhaltensmustern und dem Streben nach Zweierbeziehungen und von Eifersucht. Aber die Macht der alten Formationen fängt langsam an zu bröckeln. Alte Werte werden nicht mehr ganz so selbstverständlich übernommen und in vielen Herzen gibt es eine verborgene, unbenennbare Sehnsucht nach etwas Besserem, Hellerem, Weiterem. Parallel zur Entstehung von Öko-Habitaten und Lichtinseln werden sich neue Beziehungsmuster bilden. Die eifersuchtsgeprägte Zweierbeziehung wird ihre Besitzansprüche und Verlustängste in einem zusammenwachsenden Geflecht von Freunden langsam verlieren. Zweierbeziehungen werden deswegen zwar nicht aufhören zu existieren, denn es wird immer Seelen geben, die füreinander geschaffen sind, aber es werden offenere und nicht mehr so ausschließliche Beziehungen sein, die Raum für vielfältige, den Menschen entsprechende Ausdrucksweisen bieten. Die Scheu vor der Erfahrung der Nähe wird verschwinden und es werden sich neue Familien bilden, die nicht auf dem Muster „ein Mann, eine Frau“ oder „ein Mann, viele Frauen“ basieren, sondern meist auf „mehrere Männer, mehrere Frauen, viele gemeinsame Kinder“. Die immer noch existente Stigmatisierung der Homosexualität und das damit zusammenhängende Schubladendenken wird einem neuen Bewusstsein von Männlichkeit und Weiblichkeit Platz machen und zu einer neuen Beziehungsfähigkeit der Männer und der Frauen untereinander führen, welche die neuen Großfamilien überhaupt erst lebensfähig macht und ein wirkliches Gemeinschaftswesen begründet, das nicht auf einer Ansammlung von Paarbeziehungen aufgebaut ist. Dieses unausgesprochene und „niemanden betreffende“ Problem der Homosexualität ist etwas, das immer irgendwo gegenwärtig ist und unerkannt großen Einfluss auf das menschliche Miteinander hat. Ein unverkrampfter Blick auf die eigene Sexualität und die Sexualität anderer lässt sich nicht per Dekret oder eigenem Entschluss verwirklichen. Dazu sind Generationen von Bewusstwerdung und zunehmend selbstverständlicher Präsenz und Diversität nötig. Eine neue Gemeinschaft muss auf einem allumfassenden Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen, das Vielfalt und individuelle Entwicklung nicht nur toleriert, sondern versteht und explizit fördert, denn Leben drückt sich durch Vielfalt aus, nicht durch tote Monokultur.
Und erst aus dem gemeinsamen Ziel, aus innerer Einheit, aus Akzeptanz, Verstehen, Offenheit und Zuneigung kann wirkliche Zusammenarbeit entstehen, die für den Aufbau und das stetige Wachstum der Öko-Habitate notwendig ist. Zusammenarbeit bedeutet nicht nur, dass Arbeitsgänge ineinander übergreifen, das tun sie auch am Fließband, sondern dass vor dem Hintergrund des großen gemeinsamen Ziels oder Ideals ein jeder sich bemüht, seine ganzen Fähigkeiten nicht nur einzusetzen, sondern auch weiterzuentwickeln und im Rahmen seiner Möglichkeiten das Erblühen seines Öko-Habitats und der Idee an sich weltweit zu fördern. Zusammenarbeit bedeutet nicht nur harmonische Handreichungen, sondern ein Hineinwachsen in den Geist und die Seele des Öko-Habitats und seiner Gemeinschaft, und Anteil zu nehmen an allem, was geschieht. Wenn eine Blüte erblüht, dann geschieht dies in einem harmonischen Konzert aller Elemente der Blüte und der Pflanze, durch eine Aspiration jeder einzelnen Zelle, und erst die Gesamtheit dieser Zellen macht die Blüte aus. Und im Gegensatz zu einer Blüte muss ein Öko-Habitat nicht einen Höhepunkt durchschreiten und danach verblühen, sondern kann seine Pracht endlos zeigen und sogar weiter entfalten, solange das Bewusstsein von Einheit, Zusammenarbeit und stetigem Fortschritt in der Gemeinschaft lebendig ist.
Die Energie dafür, der innere Antrieb dazu, kommt aus der Urkraft an sich, aus dieser Macht, aus der das Universum entstand und ohne die, in welch entstellter Form auch immer sie sich äußert, kein Leben möglich wäre. Öko-Habitate werden nicht aus Angst vor Vernichtung entstehen, obwohl dies sicherlich der primär wahrgenommene Grund sein wird – und dies sollte auch nicht der eigentliche Grund sein, denn dann wären sie aus Verneinung geboren. Öko-Habitate müssen aus einer positiven Vision entstehen, wenn sie etwas bewirken wollen. Es ist nicht so wichtig, gegen etwas zu sein, als für etwas, denn wenn man etwas beseitigt, einen Missstand abgeschafft hat, heißt das nicht, dass nicht ein neues Übel an dessen Stelle tritt. Diese Unterscheidung mag marginal erscheinen, als eine Entscheidung zwischen zwei Seiten einer Münze, und doch ist sie essenziell: die eine Sache ist destruktiv und vergangenheitsorientiert und die andere konstruktiv und in die Zukunft blickend, das eine ist Hass, das andere Liebe. Und ein Öko-Habitat, eine Kraft, die vorwärts, in die Zukunft drängt, muss erfüllt sein von positiver Fortschrittskraft. Der Urgrund dieser Fortschrittskraft, das, was, wenn auch verborgen und vielfach unbewusst, hinter der Vision der Öko-Habitate steht, ist die Liebe.
Liebe bedeutet nicht zuallererst die Liebe eines Menschen zu einem anderen. Liebe ist vor allem eine Emotion oder sogar das Wesen der Seele. Liebe ist das, was alle Menschen miteinander verbindet, von den allgegenwärtigen Zu- und Abneigungen mal abgesehen. Liebe ist so etwas wie ein Grundbaustein des menschlichen Seins, wenn nicht sogar sein Axiom schlechthin. Liebe ist die absolute und vielleicht einzige Urkraft, und Mystikern oder Bewusstseinsforschern zufolge ist alles, was existiert, aus ihr entstanden.
Zumindest psychologisch gesehen sind wohl alle menschlichen Beziehungen auf Liebe aufgebaut, allerdings in sehr unterschiedlicher Ausprägung oder Unmittelbarkeit. Das fängt schon beim Verlangen an, oder beim Besitzen-wollen, sei es auf einen Menschen oder einen Gegenstand bezogen. Zugrunde liegt hier der Wunsch nach Einheit. Eins-sein-wollen ist ein Ausdruck der Liebe und Teil ihrer Natur. Innerlich möchte man dem Anderen näherkommen, die trennende Barriere überwinden, ihn in sich aufnehmen. Nur, das klappt nicht so, wie wir das gerne hätten. Zwei Dinge können physikalisch nicht denselben Raum einnehmen, und so können wir nie zu dieser Art Einheit kommen. Aus dieser Tatsache resultieren sehr viele verschiedene Verhaltensmuster: Liebe zu gutem Essen, starkes sexuelles Verlangen, häufiger Partnerwechsel, Eifersucht... All das sind Folgen unerfüllter oder unbewusster Liebe. Selbst Hass ist nur eine Form der Liebe, die daher rührt, dass man eine bestimmte Beziehung nicht bekommen kann, sei es, weil man abgewiesen wurde, weil man sie als jenseits der eigenen Möglichkeiten empfindet, weil sie einem madig gemacht wurde, weil sie eigenen oder fremden Konventionen nicht entspricht, oder was auch immer. Jemand, der hasst, beschäftigt sich oft mehr mit dem Gegenstand des Hasses als jemand, der liebt; wenn er nicht die Umarmung des Liebenden bekommt, dann die dies Kriegers.
Dieses Eins-sein-wollen zieht sich durch alle Bereiche des Lebens und alle Ebenen von Beziehung. Ob es sich nun um Bekannte, Kameraden, Freunde, gute Freunde oder geliebte Menschen handelt, immer ist das Element der Liebe ursächlich vorhanden, es ist nur unterschiedlich stark und bewusst ausgeprägt. Jede Beziehung trägt das Potenzial in sich, zur höchsten Stufe zu gelangen. Fast alle Menschen haben die Neigung, Freundschaft als eine eigenständige, von der Liebe getrennte Sache oder Emotion zu betrachten. Aber sie ist eine Form der Liebe und trägt die Möglichkeit in sich, zu einer intensiven Liebe zu werden. Ein Teil dieser Art Kasteneinteilung ist sicherlich sexuell begründet, aber vor allem auch in einem recht archaischen Beziehungskonzept, in dem festgelegt ist, wer wann wieviel welcher Form der Liebe bekommen und geben muss oder darf. Der – einzige – Partner bekommt die tiefe und die sexuelle Liebe, die Verwandten die biologische Liebe, der König, Clanführer oder Staat die patriotische Liebe, und einige Menschen, meist auf das gleiche Geschlecht beschränkt, die Form der Liebe, die Freundschaft genannt wird.
So ist die Liebe parzelliert und ihre Macht in lenkbare Bahnen gebannt. Damit verbunden ist auch die Ansicht, dass Liebe nicht teilbar ist. Das stimmt zwar in gewisser Weise, weil die Liebe ihrem eigentlichen Wesen nach unteilbar ist, aber auf der Beziehungsebene ist der damit verbundene Eindruck grundfalsch, und zwar umso mehr, je tiefer und echter die Liebe ist. Liebe ist nicht teilbar, weil sie elementar ist. Aber von den Möglichkeiten der Liebe in uns drücken wir nur einen Bruchteil aus, so wie auch ein Eisberg nur einen Bruchteil seiner wahren Größe zeigt. Aber auch wenn wir sie nur teilweise zeigen können, ist doch ihr ganzes Potenzial in uns vorhanden. Wenn wir lieben, bemühen wir uns, die verborgenen Teile aus dem Dunkel zu heben, um die Liebe mehr zu genießen. Wenn wir sie nun parzelliert genießen, dann zeigen wir mehrere unterschiedlich kleine und große und scheinbar unzusammenhängende Spitzen unseres Eisbergs, die ihr separiertes Dasein fristen. Wenn wir aber erkennen, dass jede dieser Spitzen ein Ausdruck einer einzigen Liebe sind, dann können sie zu einer großen Emotion zusammenwachsen. Und wenn die große Liebe zu einem Menschen eine große Spitze hervorbringt, dann bringt die Liebe zu zwei Menschen eine noch größere Spitze hervor. Und damit erklärt sich dann auch die alte, gerne ignorierte Weisheit, dass Liebe die einzige Sache ist, die mehr wird, je mehr man davon gibt. Und je mehr die Liebe wächst, desto tiefer und reiner wird sie.
Und je reiner die Liebe, desto eher finden wir zur Einheit. Und aus der Einheit erwächst dann die Kraft. Und das sind die Elemente, die für die Pionierarbeit beim Aufbau der ersten Öko-Habitate, aber auch später unerlässlich sind.
Aber Liebe lässt sich nicht herbeireden, befehlen oder in Kursen aneignen. Liebe ist ein dynamisches Geschehen, das von jedem Einzelnen abhängt und anfangs eher einem scheuen Reh als einem wilden Löwen gleicht. Darum ist es wichtig, günstige Bedingungen zu schaffen, wozu vor allem ein Bewusstseinswandel nötig ist.
So sollte sich der Einzelne als nicht unbedeutendes Teil des Ganzen empfinden können, aber auch als geschätztes Individuum. Um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern, sind neben gemeinsamen Festen und Besprechungen auch gemeinsame Arbeiten sehr hilfreich, an denen sich jeder beteiligen sollte, z.B. Gartenarbeit, Ernte, Verarbeitung...
Und man sollte sich darüber klar sein, dass man nicht wegen Umweltschutz in ein Öko-Habitat kommt, sondern aus Liebe: zu sich selbst, zu seinem Mitmenschen, zur Natur, zur Erde, vielleicht auch zum Universum und zu Gott. Man kann in sich auf Entdeckungsreise gehen und den eigenen Empfindungen der Liebe nachspüren. Allein dabei wird sie schon wachsen.
Dann kann man sich natürlich bemühen, anderen die Liebe entgegenzubringen, die man aufbringen kann. Das mag bei dem einen vielleicht bedeuten, etwas weniger mürrisch zu sein, beim anderen vielleicht ein zartes Lächeln, beim dritten ein überquellendes Herz. Wenn jeder gibt, was er kann, dann wird seine Liebe wachsen, vielleicht nur langsam, aber nicht nur nach dem Rückkoppelungsprinzip, sondern weil sie wächst, je mehr man sie gibt.
Auch wenn sich Liebe nicht erlernen lässt, so lässt sich doch ihre Entfaltung fördern. Man braucht bloß die Augen schließen und innerlich etwas zur Ruhe kommen. Dann stellt man sich in der Mitte der Brust ein unerschöpfliches strahlendes oder warmes Licht oder ein Feuer oder eine sanfte Wärme oder Freude vor. Wenn dieser Eindruck gefestigt ist, stellen wir uns einen Menschen unseres täglichen Lebens vor. Wenn wir wollen, können wir uns auch seine Schwächen und Stärken und sein Potenzial vor Augen führen. Dann suchen wir das, was uns verbindet oder verbinden könnte oder was uns an ihm gefällt. Dabei versuchen wir die Empfindung in der Brust zu öffnen und nach außen, auf diesen Menschen zuströmen zu lassen und ihn damit zu umarmen. Wir versuchen nur, unsere Liebe, unsere Zuneigung, unsere Freude und Wärme zu geben und nicht im Gegenzug etwas zu erwarten. Man kann das jeden Tag mit jemand anderem machen, oder mit allen Menschen, die man kennt, oder mit Gruppen von Menschen oder mit der Erde. Das ist eine einfache Möglichkeit, die Liebe, die in uns wohnt zu entfalten.
Wenn in der Gemeinschaft, die ein Öko-Habitat entwickelt und belebt, Liebe kein abstraktes Fremdwort, sondern eine wachsende Gegenwart ist, dann können Bewusstsein, Einheit und Kraft zusammenwirken und jede Schwierigkeit personeller wie organisatorischer Art überwinden, dann ist das Öko-Habitat wirklich lebendig und zukunftsfähig.
Auch wenn die Liebe und Beziehungsfähigkeit ein wesentlicher Grundbestandteil der Gemeinschaft bilden, so basiert die Gemeinschaftsdynamik noch auf einer zweiten Grundlage: dem Individuum bzw. dem Zusammenspiel von Individuum und Gemeinschaft. Wenn man große Zukunftsvisionen hat, sieht man immer gern das große Ganze, übersieht aber leicht, dass die Menschen, die diese Vision verwirklichen sollen, keine homogene und namenlose Masse sind, sondern viele verschiedene einzelne Persönlichkeiten. Der Einzelne wird immer großzügig dem hehren Ziel untergeordnet und darf seine Arbeitskraft für das Gemeinwohl geben, aber seine Persönlichkeit, seine individuelle Entwicklung wird über das zielführende Maß hinaus nicht gefördert und in diktatorischen und militaristischen Gemeinschaften eher unterdrückt. Diese insbesondere, aber auch fast jede andere Art von Gemeinschaft neigen dazu, das Gemeinwohl über das Wohl des Einzelnen zu stellen.
Aber eigentlich sind Gemeinschaft und Individuum voneinander abhängig. Eine Gemeinschaft würde ohne die sie konstituierenden Individuen nicht existieren, und das Individuum ist ohne Gemeinschaft kaum lebens- und entfaltungsfähig. Der Mensch ist seiner Natur nach ein Gemeinschaftswesen, und daran ändern auch die Beispiele von erleuchteten Einsiedlern nichts, denn diese haben es gelernt, in Gemeinschaft mit den Tieren und Pflanzen des Waldes oder der göttlichen Gegenwart in sich selbst in Gemeinschaft zu leben. Jeder Mensch, wie sehr er es auch leugnen mag, sehnt sich nach dem Kontakt mit anderen Menschen. Manchen mag ein ganz klein wenig Kontakt reichen, während andere sich nicht wohlfühlen, wenn nicht immer andere Menschen um sie herum sind. Für den Einzelnen stellt die Gesellschaft anderer Menschen einen nicht-materiellen und nicht-bezifferbaren Wert dar und ist für seine geistige und seelische Gesundheit und sein Wohlbefinden unerlässlich. Aber natürlich profitiert er auch materiell: Die Gemeinschaft anderer Menschen bietet ihm Schutz und Unterstützung. Und wo viele Menschen beisammen sind, gibt es auch viele verschiedene Fähigkeiten, die sich ergänzen und das Leben für den Einzelnen angenehmer gestalten.
Je primitiver oder auch durch die Umwelt gefährdeter eine Gemeinschaft ist, desto restriktiver ist sie und desto mehr sind handwerkliche Grundkenntnisse gefragt, wie Gartenbau, Landwirtschaft, Jagd, Backen, Nähen, Weben, Schreinern... Gefestigtere und größere Gemeinschaften haben dann auch noch künstlerische Bedürfnisse. Allgemein kann man sagen, dass Gemeinschaften die Neigung haben, festzulegen, welche Fähigkeiten erwünscht sind und welche nicht, und alles, was den Status Quo verändern könnte, ist generell unerwünscht. Die Mitglieder einer jeden Gemeinschaft werden also in der Entwicklung mancher Fähigkeiten gefördert und bei anderen unterdrückt. Dabei wird das Bewusstsein ihrer Mitglieder so subtil manipuliert, dass diese damit meist auch zufrieden sind. Das führt dazu, dass Gemeinschaften die Tendenz haben, traditionell zu werden und zu stagnieren. Manchmal gibt es einen Schub, technische Neuerungen oder eine kleine Revolution, aber das ist selten dauerhaft und umfassend progressiv, sondern mündet bald in die nächste Stagnation.
Diese Gefahr besteht auch für die Öko-Habitate. Die Habitate an sich sind sicher eine aufregende Neuerung, aber die Menschen sind vielfach weniger aufregend und neigen dazu, sich mit den Neuerungen zu arrangieren und sich ein neues, bequemes, traditionelles Leben zu gestalten. Die Öko-Habitate sind aber eigentlich ein erster Schritt aus dem gewöhnlichen selbstmörderischen Leben hinaus und in ein progressives, zukunftsorientiertes Leben hinein. Wenn wir als Menschheit eine Chance haben wollen, dann dürfen die Habitate kein altes Leben in neuem Gewand werden, sondern müssen zu Kristallisationspunkten werden, um die herum sich ein neues Leben, ein neues Gemeinschaftsideal entfaltet.
Dazu muss sich auch das bisherige Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft ändern. In Öko-Habitaten ist es wichtig, dass die Bewohner stetig im Bewusstsein wachsen. Es geht nicht darum, nur die Fähigkeiten zu entwickeln, die für das übliche Gemeinwohl wichtig sind. Da die Gemeinschaft sich aus den Individuen zusammensetzt und von ihnen definiert wird, ist es wichtig, dass diese Individuen sich auch optimal entwickeln. Jeder Mensch ist einzigartig und hat eine ganz eigene Sicht der Dinge und ganz eigene Fähigkeiten. Alle Menschen zusammen bestimmen die Lebendigkeit, die Farbigkeit, die Ausdruckstiefe einer Gemeinschaft. In einem Öko-Habitat unterliegt man nicht mehr so ohne weiteres der Gemeinschaft, obwohl natürlich die Gemeinschaft feststellen kann, was ihrer Entwicklung förderlich ist und was nicht, sondern man formt die Gemeinschaft selbst mit. Das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft muss dynamisch werden, denn beide profitieren voneinander. Das bisherige System ist für Öko-Habitate mega-out.
In einem wahren Öko-Habitat wird also auch die Ökologie der Menschen gepflegt. Nur ein erblühter, reicher Charakter kann ein verantwortungsvoller Bestandteil der Gemeinschaft sein, und die Gemeinschaft profitiert von einem solchen mehr als von jedem Mitläufer. Darum wird die Gemeinschaft großen Wert darauf legen, dass alle zukunftsträchtigen Aspekte der Mitglieder optimal gefördert werden, also die künstlerische Ausdruckskraft, das Verständnis für den Mit-Habitanten, die wissenschaftliche Ausbildung, das Bewusstseinswachstum, die Kritikfähigkeit, die Persönlichkeitsentwicklung, die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, Flexibilität, Begeisterungsfähigkeit, handwerkliches Geschick... Jeder Mensch kann so vieles lernen und so vieles sein und dadurch so viel zur Gemeinschaft beitragen. Und damit die Gemeinschaft nicht einschläft, ist es wichtig, jeden Tag Fortschritte zu machen, jeden Tag dazuzulernen, jeden Tag vollkommener zu werden, jeden Tag mehr man selbst.
Jede Ökologie ist ein dynamisches System, und die Zukunftsökologie der Öko-Habitate macht es möglich, dass dieses System kein natürliches, statisches Gleichgewicht findet, wie in der Natur bislang üblich, sondern ein dynamisches, hoffnungsvolles, fortschrittliches Gleichgewicht.
Zufriedenheit hängt nicht von äußeren Umständen ab, sondern von einem inneren Zustand.
Mira Alfassa