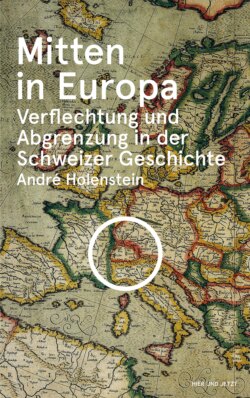Читать книгу Mitten in Europa - André Holenstein - Страница 12
Zivile Arbeitsmigration
ОглавлениеIm Unterschied zu den Söldnern in fremden Diensten sind die zivilen Arbeitsmigranten der frühen Neuzeit im allgemeinen historischen Bewusstsein viel weniger gegenwärtig. Dies hat mehrere Gründe: Die historische Erinnerung an die fremden Dienste wurde im 19. und 20. Jahrhundert besonders von Nachkommen von Militärunternehmern und Offizieren aus dem Ancien Régime wachgehalten, die als Militär- und Kriegshistoriker neben der Familienmemoria auch das im Zeitalter des Nationalismus und Militarismus verbreitete Interesse an Militaria bedienten. Paul de Vallières Buch «Honneur et Fidélité» (1. Aufl. 1914), ein frühes Standardwerk zu den Schweizer fremden Diensten, wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ausdrücklich zur Stärkung des eidgenössischen Wehrwillens neu aufgelegt und erhielt Einführungen von General Henri Guisan (1874–1960) und Oberstkorpskommandant Ulrich Wille (1877–1959). Eine solch prominente Erinnerungstradition vermochte die zivile Arbeitsmigration wohl auch deshalb nicht zu stiften, weil sie nicht einen einzigen Berufsstand, sondern ganz verschiedene Tätigkeitsfelder berührte, und weil sie kein Massenphänomen, sondern das unspektakuläre Werk von Einzelpersonen und kleinen Gruppen war. Zivile Arbeitsmigranten waren vielfach als Spezialisten und Experten ihres Metiers unterwegs und fanden dank ihren handwerklichen und gewerblichen Fertigkeiten, ihres künstlerischen Talents, ihres Wissens oder ihren pädagogischen und kulturellen Kompetenzen ein Auskommen im Ausland. Die Weltläufigkeit und hohe Anpassungsfähigkeit dieser zivilen Arbeitsmigranten korrigieren verbreitete Vorstellungen: Zum einen widerlegen sie das Stereotyp einer ländlich-bäuerlichen, schollenverhafteten und wenig mobilen Schweiz, und zum anderen hinterfragen sie besonders die Vorstellung einer Bergwelt, in der die Menschen fernab von den dynamischen gesellschaftlichen Zentren und kulturellen Brennpunkten ein eingezogenes, bescheidenes Leben in den Bahnen der immer gleichen Gewohnheiten fristeten.
ZUCKERBÄCKER AUS GRAUBÜNDEN
Die Bündner Zuckerbäcker und ihre Bedeutung für die Verbreitung des Geschäfts mit Süssigkeiten und Kaffee quer durch das Europa des 17. bis 19. Jahrhunderts stellen eines der sonderbarsten und faszinierendsten Kapitel der schweizerischen Migrationsgeschichte dar. In hohem Mass erklärungsbedürftig ist dieses Geschäft, weil die Zuckerbäcker aus Graubünden eine Ware verkauften, die in ihrer Heimat kaum bekannt war. Kaffee und Zucker mussten als Kolonialwaren von weit her eingeführt werden. Bis weit ins 18. Jahrhundert galten sie aus christlich-moralisierender Sicht als verwerfliche Genussmittel, in ökonomischer Hinsicht aber als unnötige, teure Konsumgüter, die nicht für die breite Bevölkerung bestimmt waren.
Die Bündner Zuckerbäcker trafen den Geschmack einer kaufkräftigen adeligen und bürgerlichen Oberschicht in den Grossstädten des 18. und 19. Jahrhunderts, wo damals die Kaffeehauskultur aufkam. Als öffentlicher Raum unterschied sich das Kaffeehaus von den herkömmlichen Wirtshäusern, wo hauptsächlich Alkohol getrunken wurde. Im Kaffeehaus traf sich die gehobene Gesellschaft zur Erholung, zur Lektüre, zum Gespräch und zum Spiel. Dazu trank man Kaffee und verspeiste Fein- und Süssgebäck, womit man sich symbolisch von den Arbeitern und Handwerkern abhob, die sich solchen Luxus nicht leisten konnten.
Die Anfänge des Bündner Zuckerbäckergewerbes liegen im Venedig des 17. Jahrhunderts. Seit der Bündner Eroberung des Veltlins 1512 grenzten die Drei Bünde und die Republik Venedig in den Bergamasker Alpen aneinander. Die beiden Staaten unterhielten enge wirtschaftliche und politische Beziehungen. 1603 schlossen sie ein Bündnis, das den Bündnern gestattete, sich als Gewerbetreibende in Venedig niederzulassen. Schon 1612 hielten sich über 300 Bündner in der Lagunenstadt auf, wo sie sich zu einem frühen Zeitpunkt als Verkäufer von Kaffee betätigten. Aufgrund seiner führenden Rolle im Handel mit der Levante war Venedig ein Einfallstor für den «Türkentrank» im westlichen Europa; ein erstes Kaffeehaus wurde schon 1647 eröffnet. Dass sich die Bündner in Venedig auf das Gewerbe mit Kaffee und Backwaren spezialisierten, mochte damit zusammenhängen, dass ihnen dieses Gewerbe ein Betätigungsfeld eröffnete, das die eingesessenen Zünfte noch nicht besetzt hatten.
Das Geschäft der Bündner mit Süssigkeiten und Kaffee in Venedig florierte, bis die Serenissima die Bündner Handelsund Gewerbeprivilegien 1766 aufhob. Die Bündner Regierung hatte Venedig vor den Kopf gestossen, weil sie 1763 ein Bündnis mit dem habsburgisch-österreichischen Mailand abgeschlossen hatte. Venedig kündigte 1764 die Allianz mit den Drei Bünden, sodass 1766 3000 Bündner Kaufleute und Gewerbetreibende die Stadt verlassen mussten.12 Da es damals in Graubünden weder Grossstädte noch Kaffeehäuser gab, zogen viele ausgewiesene Zuckerbäcker in die Städte Deutschlands (Berlin, Leipzig, Dresden), Polens, des Baltikums (Riga), Österreich-Ungarns und Russlands. Warschau wurde ein Zentrum des Bündner Konditoreigewerbes, von wo aus es sich im 19. Jahrhundert in zahlreiche weitere Städte des russischen Zarenreichs ausbreitete. St. Petersburg wurde für die Bündner Zuckerbäcker die zweite wichtige Niederlassung in Osteuropa. Wiederum andere wanderten im 18. und 19. Jahrhundert nach Süden und Westen, wo Marseille und die aufstrebenden französischen Atlantikhäfen neben den italienischen Städten häufige Destinationen waren.
Im europaweiten Bündner Zuckerbäcker- und Kaffeehausgewerbe gaben Familien aus dem Puschlav (Mini, Semadeni), aus dem Oberengadin (Josty, L’Orsa, Zamboni) und Unterengadin (Arquint), aus Davos (Branger, Isler, Wolf) und dem Bergell (Castelmur), aus dem Hinterrheintal (Caviezel) sowie dem Safiental (Gredig, Zinsli) den Ton an. Ihr Gewerbe blieb insofern bemerkenswert, als sie dieses bis zum Aufkommen des Tourismus in Graubünden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur im Ausland ausübten. Zu Hause wurden keine Zuckerbäcker benötigt. Das ganze Gewerbe – von der Ausbildung der Lehrlinge und der Absolvierung der Gesellenzeit über die Tätigkeit der selbständigen Meister und Besitzer eines oder mehrerer Betriebe – spielte sich ausschliesslich im Ausland ab. Dennoch wurden die Beziehungen zur Heimat vielfach über Generationen hinweg aufrechterhalten und bestimmten so das Migrationsverhalten der Bergbevölkerung. Die Gewerbetreibenden in der Fremde zogen junge Landsleute und Verwandte als Lehrlinge nach. Sie heirateten Bündnerinnen, schickten ihre Kinder zur Ausbildung in die Schweiz und kehrten bisweilen als erfolgreiche Unternehmer nach Graubünden zurück, wo sie sich in repräsentativen Alterssitzen niederliessen, politische Ämter in Gemeinde und Kanton übernahmen oder als Pioniere im aufstrebenden Tourismus aktiv wurden.
HANDWERKER, GEWERBETREIBENDE UND HÄNDLER AUS DEN SÜDALPINEN TÄLERN
Die Wanderungs- und Laufbahnmuster der Zuckerbäcker aus Graubünden lassen sich auch bei anderen Handwerkern und Gewerbetreibenden aus den südalpinen Tälern des Tessins und Graubündens nachweisen. Zahlreiche Berufsgruppen betrieben dort eine saisonale oder lebenszyklische Wanderarbeit, die keine Besonderheit dieser heute schweizerischen Gebirgsgegenden, sondern grundsätzlich im ganzen Alpenraum von den Karnischen Alpen im Nordosten Italiens bis in die Täler der französischen Haute-Dauphiné verbreitet war. Aus den Bergtälern zogen zahlreiche Arbeitskräfte in die Ebene und kehrten jeweils nach einigen Monaten oder Jahren in ihre Bergdörfer zurück. Über die Migration pendelte sich ein intensiver Austausch von Dienstleistungen und Gütern zwischen den Bergen und den Städten der Tiefebene ein.
In ganz unterschiedlichen Gewerben wurde diese weiträumige Arbeitsmigration praktiziert, wobei sich einzelne Regionen auf bestimmte Tätigkeiten spezialisierten. Schon im 15. Jahrhundert tauchten Gepäckträger aus dem Bleniotal, dem Locarnese und der Leventina in Mailand, Genua und in der Toscana auf. Aus dem Onsernonetal kamen vor allem Hutmacher, während unter den Auswanderern aus dem Verzascatal, aus Minusio, Intragna und dem Misox die Kaminfeger stark vertreten waren. Das Bleniotal war im 18. und 19. Jahrhundert mit seinen Schokoladefabrikanten und -händlern sowie Marronibratern, die ihre Ware in Oberitalien, Frankreich, England, Holland und Deutschland absetzten, besonders im Konsumgütersektor stark vertreten.
Die Städte und Territorien Italiens waren aus politischen und kulturellen Gründen das erste Auswanderungsziel. Wirtschaftlich, kulturell und politisch-herrschaftlich gehörten die südalpinen Täler des Tessins zum Einflussbereich lombardischer Herrschaften. Erst im 15. Jahrhundert griffen die Innerschweizer Orte über den Gotthard nach Süden aus. Ihre Expansion wurde mit der Eroberung des Luganese, Locarnese und Mendrisiotto (1512/17) und dem Verzicht des Herzogtums Mailand auf diese Gebiete abgeschlossen. Schon im 16. Jahrhundert richteten Wanderarbeiter ihre Ziele auch nach Norden und Osten aus und waren seitdem je nach Gewerbe in Frankreich und den Niederlanden, in Deutschland, Österreich-Ungarn, Böhmen, Mähren und Polen anzutreffen.
Beobachtungen zur Wanderarbeit der Gepäckträger, Transportarbeiter sowie der Kaminfeger sollen diese allgemeinen Feststellungen veranschaulichen.
Gepäckträger und Transportarbeiter aus dem Locarnese waren in den grossen Häfen von Genua, Livorno und Pisa tätig, wo sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten aus dem Bergamaskerland und Veltlin behaupteten. Im Hafen von Livorno knöpften die 50 Gepäckträger aus dem Locarnese (Rasa, Ronco, Losone) 1631 ihren Konkurrenten das Monopol gegen eine Jahresgebühr von 1750 Dukaten ab und willigten ein, ohne Ehefrauen im Zollgebäude des Hafens zu leben und nicht ohne obrigkeitliche Bewilligung in die Heimat zurückzukehren. Sie behaupteten das erbliche und lukrative Monopol auf die Verladearbeiten bis 1847.
Die Misoxer Kaminfeger stiegen in Wien im 17. und 18. Jahrhundert auf, als die Bevölkerung dieser Metropole von etwa 130 000 Einwohner (1720) auf 260 000 Einwohner (1818) anwuchs. In Grossstädten wie Wien ordneten die Behörden aus feuerpolizeilichen Gründen frühzeitig das regelmässige Fegen der Kamine an. Das Wiener Kaminfegergewerbe florierte nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Kaminfeger zünftisch-korporativ organisierten und feste Bezirke untereinander aufteilten. Die Zunftmeister konnten bis ins 19. Jahrhundert die Zahl der Meisterstellen auf 18 beschränken und damit die Marktverhältnisse kartellisieren. In der habsburgischen Residenz behaupteten mehrere Kaminfegerfamilien aus dem Misox eine starke Position. 30 Männer aus der Familie Martinola aus Soazza waren dort zwischen dem späten 17. und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tätig. 28 Kaminfeger aus der Familie Toscano aus Mesocco schafften es bis zur Meisterschaft. Zwischen 1775 und 1860 stellten die zugewanderten Meister aus Soazza und Roveredo fast ausschliesslich die Vorstände der Kaminfegerzunft in Wien. Das angesehene Amt des kaiserlichen Hofrauchfangkehrers bekleideten zwischen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und dem Jahr 1826 ausschliesslich Meister aus Soazza. Der Hofkaminfeger hatte alle Gebäude der kaiserlichen Verwaltung unter sich. Das Amt brachte nicht nur einen hohen Verdienst, sondern auch grosses Prestige ein.
Die in Wien lebenden Kaminfeger aus dem Misox standen in regem Austausch mit ihren Familien zu Hause. Das Beziehungs- und Kommunikationssystem funktionierte über die weite Entfernung in beide Richtungen. Es etablierte sich eine langfristig stabile Migrationstradition innerhalb eines Dorfes oder gar innerhalb derselben Familie, wie der Fall der Familie Toscano zeigt, die zwischen der Mitte des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts 31 junge Männer nach Wien in die Lehre schickte. Für die anhaltenden Verbindungen zwischen Wien und dem Misox spricht auch die Tatsache, dass viele Wiener Gewerbler in der Heimat Grund und Boden in ihrem Besitz behielten und sich damit die Option der Rückwanderung offenhielten. Von der Verbundenheit mit der Heimat zeugten auch Schenkungen und Erbschaften der Wiener Familien für ihre Verwandten sowie fromme Legate für kirchliche Einrichtungen im Misox. Die Wanderungen der Misoxer Kaminfeger waren offenbar eine Mischung von lebenszyklischer Wanderung und permanenter Auswanderung. Für die einen beschränkte sich der Aufenthalt in Wien auf eine bestimmte Lebensphase, andere liessen sich dort dauerhaft nieder.
Ganz anders getaktet waren die Bewegungen der saisonal migrierenden Gepäckträger, Hutverkäufer, Marronibrater oder Bauarbeiter. Diese Saisonarbeiter hielten sich jeweils etwa ein halbes Jahr in der Fremde auf, kehrten dann in ihre Dörfer zurück, um im Jahr darauf wieder loszuziehen. Für mehrere Monate entleerten sich die betroffenen Tessiner Dörfer von ihren Männern, und die Frauen, Kinder und Alten blieben unter sich. Vermutlich bestanden diese Wanderzyklen schon im 16. Jahrhundert. Je nach Branche und regionaler Herkunft überwogen die Sommerwanderer, die jeweils zwischen März und Mai auszogen und im November oder Dezember zurückkehrten, oder die Winterwanderer, die zwischen Herbst und Frühling landesabwesend waren. So waren die Tessiner Bauarbeiter allgemein im Sommerhalbjahr von zu Hause weg, während die Männer aus den Alpentälern des Sopraceneri ihre Dörfer im Winter verliessen.
Die saisonale Wanderung war eine verbreitete gesellschaftliche Erscheinung. Einträge der Priester in den Kirchenbüchern geben für bestimmte Stichjahre einen Eindruck vom Ausmass der Auswanderung: In Mezzovico waren 1677 65 Prozent der erwerbsfähigen Männer (15–64 Jahre) bei der Erhebung nicht im Land. Im Bleniotal, wo im Jahr 1743 insgesamt 1741 Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren lebten, waren zum Zeitpunkt der Erhebung 815 Männer (56%) landesabwesend. In einzelnen Blenieser Gemeinden lag dieser Anteil wesentlich höher. So waren 1743 in Leontica 92 von 99 Männern, in Olivone 217 von 260, in Buttino 30 von 34, in Campo 42 von 53 und in Torre 24 von 30 Männern nicht zu Hause.13 Auch wenn diese Zahlen für das Bleniotal besonders hoch sind und in anderen Gemeinden nur zwischen 11 und gut 21 Prozent der Männer im erwerbsfähigen Alter als Saisonarbeiter wanderten, bleibt allgemein festzuhalten, dass die saisonale Wanderung das soziale, ökonomische und kulturelle Leben dieser Tessiner Dörfer wesentlich prägte.
Welche ökonomische Logik lag den saisonalen Wanderungen zugrunde, und welche Folgen hatte diese für den Lebensalltag der Wandernden und der Zuhausebleibenden? Die Wanderung bildete das eine tragende Element einer Haus- und Familienwirtschaft, die ihre Subsistenz aus zwei Quellen bestritt. Die Männer brachten aus der Fremde Geldeinkünfte nach Hause, die sie in der Heimat nicht erwerben konnten, weil das Tessin nur wenig urbanisiert und kommerzialisiert war. Abgesehen vom fruchtbaren, flachen Mendrisiotto war das Tessin mit seinen vielen Tälern, Hügel- und Berglandschaften stark auf die Subsistenzlandwirtschaft ausgerichtet. Mit dem Geldeinkommen der Wanderarbeiter kauften sich die Haushalte Nahrungsmittel und Güter, die im Tessin nicht oder nicht in hinreichender Menge produziert wurden, vornehmlich Wein, Getreide und Salz, und sie bezahlten damit ihre Abgaben und Gebühren. Flüssiges Geld alimentierte zudem das lokale Kreditwesen und den Immobilienmarkt. Komplementär zu diesem geldwirtschaftlich-kommerziellen Pol der lokalen Ökonomie agierten die Frauen und übrigen Angehörigen des Haushalts, die zu Hause blieben. Sie bewirtschafteten die Felder, besorgten das Vieh und betrieben Sammelwirtschaft in den Wäldern. Sie produzierten die meiste Nahrung, die der Haushalt im Jahreslauf konsumierte. Männer und Frauen trugen je auf ihre Weise zur Subsistenz von Familie und Haushalt bei. Das saisonale Ausströmen der Männer erfolgte keineswegs aus der Not heraus, sondern war vielmehr in eine komplementäre Familienökonomie mit geschlechterspezifischer Rollen- und Arbeitsteilung eingebunden. Diese Verbindung von saisonalem Wandergewerbe und Subsistenzlandwirtschaft löste sich erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts auf, als sich mit der Massenauswanderung nach Übersee neue Möglichkeiten eröffneten.
Die duale Familienwirtschaft hat die Tessiner Täler in vielfältiger Hinsicht geprägt. Sie bestimmte die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen und den Zyklus der sozialen Reproduktion der Haushalte. Die Frauen trugen mit einer hohen Arbeitsbelastung die familiale Haus- und Landwirtschaft, was ihnen eine hohe Eigenverantwortung und Selbständigkeit verschaffte. Die Wanderungen der Männer strukturierten den Rhythmus der Heiraten und Geburten. Wo Winterwanderung vorherrschte wie im Bleniotal, wurde im Juni und Juli geheiratet, obwohl in diesen Monaten die anstrengenden Heuarbeiten anfielen. Die Kinder kamen im März und April des darauffolgenden Jahres zur Welt. Die letzten Monate der Schwangerschaft fielen damit günstigerweise in die Winterzeit, wo die Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft vergleichsweise gering war. Die Sommerwanderer heirateten dagegen im Januar und Februar, die Geburten der Kinder häuften sich zwischen August und November. Auch das gesellschaftliche und politische Leben war auf die Wanderungen abgestimmt. Gemeindeversammlungen, Wahlen oder die Arbeiten im Gemeinwerk für die Ausbesserung von Kanälen, Wegen und Brücken fanden statt, wenn die Männer zu Hause waren.
Die meisten Wanderarbeiter und insbesondere die qualifizierten Baufacharbeiter waren für ihre berufliche Tätigkeit im Ausland auf eine gute Grundausbildung angewiesen. Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten waren erforderlich, um Arbeitsverträge abzuschliessen, mit den Angehörigen zu Hause brieflich in Kontakt zu bleiben und die eigenen Geschäfte in der Fremde zu betreiben. Deshalb verdichtete sich seit dem 16. Jahrhundert das Netz an Dorfschulen. 1630 zählte man in der italienischen Schweiz 52 Schulen. Die meisten lagen im Sottoceneri, woher die meisten Baufachleute stammten. Allerdings waren diese Dorfschulen allein für die Knaben – die künftigen Wanderarbeiter – bestimmt, die vom sechsten oder siebten Lebensjahr an die Schule besuchten, bevor sie in der Regel mit zwölf Jahren ein erstes Mal auszogen. Ihre frühesten Erfahrungen als Wanderarbeiter machten die jungen Männer gewöhnlich, wenn sie von älteren Verwandten oder Nachbarn angeworben oder mitgenommen wurden.
BAUFACHLEUTE UND KÜNSTLER
Die hoch qualifizierten Baumeister, Maler, Bildhauer, Steinmetzen und Bauarbeiter aus den Tessiner und Bündner Tälern verdienen bei der Betrachtung der Arbeitsmigration besondere Aufmerksamkeit. Schon im Mittelalter zogen sie aus den lombardischen Voralpen aus und waren auf den grossen Baustellen der sich stark entwickelnden Städte Italiens anzutreffen. Hauptsächlich stammten sie aus dem Sottoceneri – aus der Umgebung von Lugano, dem Malcantone und dem Mendrisiotto, die im frühen 16. Jahrhundert unter die Herrschaft der eidgenössischen Orte gelangten –, häufig auch aus dem Misox, das seit dem späten 15. Jahrhundert bündnerisch war.
Auch diese ausgeprägte Spezialistenwanderung war meist zeitlich befristet. Die Facharbeiter hielten sich für eine Saison oder wenige Jahre in der Ferne auf. Im Rhythmus von Auszug und Rückkehr entstanden enge Beziehungen zwischen den Bauherren in Italien und den Baufachleuten aus den südalpinen Tälern. Die Verbindungen der Wanderer zu ihren Dörfern blieben bestehen, sodass die heimatliche Verwandtschaft und Nachbarschaft über die Jahrhunderte hinweg das wichtigste Reservoir für die Rekrutierung und Ausbildung junger Facharbeiter bildeten. Auf diese Weise entstanden eigentliche Dynastien von Baufachleuten, die über Generationen hinweg auf bedeutenden Bauplätzen des Auslands anzutreffen waren: die Aprile, die wie die Casella, die Lombardo und die Solari aus Carona stammten, die Artari aus Campione beziehungsweise Arogno, die Baroffio aus Mendrisio, die Bossi aus dem Luganese und Mendrisiotto, die Cantoni aus dem Valle di Muggio, die Carlone aus Rovio, die Castelli, Porri und Tencalla aus Bissone, die Fontana aus Melide, die Lucchesi aus dem Luganese, die Oldelli aus Meride, die Pozzi aus Castel San Pietro und die Silva aus Morbio Inferiore, die Soldati aus dem Malcantone, die Somazzi aus Montagnola und Gentilino, die Taddei und Verda aus Gandria oder die Visconti aus Curio.
Warum gerade Männer aus diesen Regionen über besondere bautechnische Fertigkeiten verfügten, ist nicht eindeutig zu klären. Eine gewisse Plausibilität hat die Vermutung für sich, dass die Vorkommen verschiedener Steinarten in den südalpinen Tälern frühzeitig die Meisterschaft in der Steinbearbeitung gefördert haben. Der unternehmerische Erfolg dieser Baufachleute gründete darin, dass sie eigentliche Konsortien («maestranze») bildeten, die alle anstehenden Arbeiten auf grossen Baustellen erledigten. Der Baumeister übernahm die Leitung des Bauplatzes und brachte die Spezialisten zusammen, die er für die verschiedenen Bauetappen benötigte: Steinmetzen, Maurer, Maler, Bildhauer, Stuckateure. Die gemeinsame Herkunft und die Zusammenarbeit auf den Baustellen begründeten die korporative Organisation dieser in hohem Grad arbeitsteiligen Unternehmungen. Mit dem Zusammenschluss zu Gesellschaften und Bruderschaften wahrten die Baufacharbeiter ihre Rechte und Interessen gegenüber Bauherren und lokalen Behörden und leisteten sich Hilfe in materieller Not, bei Krankheit oder Tod in der Fremde.
Frühe Wirkungsstätten dieser Wanderarbeiter waren die Bauhütten der romanischen und gotischen Kathedralen in Modena, Bergamo, Parma, Trient oder Mailand. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts boten Rom und Neapel, wo die Päpste und die spanischen Vizekönige eine intensive städtebauliche Tätigkeit entfalteten, interessante Aufträge in der Übergangsperiode von der Spätrenaissance zum Barock. Seit dem 16. Jahrhundert wandten sich Tessiner und Misoxer Baumeister auch nach Norden und Osten (Deutschland, Schweden, Polen, Böhmen). Ab etwa 1700 weitete sich ihr Aktionsradius bis nach Russland aus, wo sie bis weit ins 19. Jahrhundert einen beträchtlichen Einfluss auf die Repräsentationsarchitektur ausübten.
Die Baumeister der frühen Zeit sind namentlich nicht bekannt. Im Unterschied zu den Architekten, Bildhauern und Malern der Renaissance, die sich als unverwechselbare Künstler einen Namen machten, verstanden sich jene noch als Handwerker, die im Auftrag ihrer Bauherren tätig waren und namenlos blieben. Doch seit dem 16. Jahrhundert traten auch unter den Tessiner und Misoxer Baumeistern, Malern und Stuckateuren Künstlerpersönlichkeiten hervor, die mit ihren Werken in die europäische Architektur- und Kunstgeschichte eingingen.
Tessiner und Misoxer Baufachleute im Ausland (A: Architekt/Baumeister; B: Bildhauer; I: Ingenieur; M: Maler; S: Stuckateur) (Auswahl, 15.–19. Jahrhundert)14
Drei herausragende Tessiner Baumeister sollen hier stellvertretend für zahlreiche andere porträtiert werden. Ihre Bauten bestimmen noch heute das Stadtbild der Ewigen Stadt und Neapels.
Domenico Fontana (1543–1607) aus Melide kam als junger Stuckateur um 1563 nach Rom, wo er als Baumeister in die Dienste Papst Gregors XIII. (1502–1585, Papst ab 1572) trat. Die Begegnung mit Kardinal Felice Peretti, der als Sixtus V. (1521–1590, Papst ab 1585) Papst Gregor nachfolgte, förderte Fontanas Karriere massgeblich. Sixtus V. entfaltete eine intensive Bautätigkeit in Rom und beauftragte Fontana mit dem Bau der päpstlichen Paläste im Vatikan, Lateran sowie auf dem Quirinal. Er erneuerte die Wasserversorgung Roms und liess Wasser in die höher gelegenen Stadtteile führen, wofür Domenico Fontana – teilweise mit seinem Bruder Giovanni – Aquädukte und repräsentative Brunnen wie den Mosesbrunnen auf der Piazza San Bernardo errichtete.
Zusammen mit Giacomo della Porta (um 1532–1602) aus dem Melide gegenüberliegenden, heute italienischen Porlezza erbaute Fontana die Kuppel des Petersdoms. In einer bemerkenswerten Ingenieursleistung restaurierte er im Auftrag Sixtus’ V. die umgestürzten, zerbrochenen ägyptischen Obelisken aus dem antiken Rom, überführte sie innerhalb weniger Jahre auf den Petersplatz (1586), die Piazza S. Maria Maggiore (1587), die Piazza S. Giovanni in Laterano (1588) und die Piazza S. Maria del Popolo (1589), wo er sie als nunmehr geweihte Monumente neu aufstellte. Nach dem Tod seines päpstlichen Patrons und Förderers verlor Fontana seine Stellung am päpstlichen Hof und trat 1592 in den Dienst des Vizekönigs von Neapel, für den er die Hafenanlagen Neapels umbaute, Strassenbauprojekte leitete und ab 1600 den neuen königlichen Palast errichtete.
Carlo Maderno (Maderni) (1555/56–1629), Fontanas Neffe aus Capolago am Luganersee, durchlief eine nicht minder eindrückliche Karriere. Um 1576 holten die Onkel den 20-Jährigen nach Rom, wo sie ihn als Stuckateur und Steinmetz, später als Architekten und Ingenieur beschäftigten. Als Domenico Fontana Rom in Richtung Neapel verliess, übernahm Maderno die Leitung der Bauunternehmen seines Onkels in Rom. Als sein bedeutendstes Werk gilt die Vollendung des Petersdoms, dessen Langhaus und Fassade unter Papst Paul V. (1552–1621, Papst ab 1605) nach seinen Plänen errichtet wurden. Neben Kirchen baute Maderno Paläste für den römischen Kurienadel und prägte mit seinem Stil die neue Barockarchitektur Roms.
Das Beziehungsmuster zwischen Fontana und Maderno spielte auch in der nächsten Generation im Fall von Francesco Borromini (1599–1667) aus Bissone. Borromini war ein entfernter Verwandter Madernos und arbeitete seit 1619 unter dessen Leitung auf dem Bauplatz des Petersdoms. Auch Borromini errichtete wie seine Verwandten in Rom zahlreiche Sakral- und Profanbauten, wobei er insbesondere in der Gunst von Papst Innozenz X. (1574–1655, Papst ab 1644) stand. Sant’Ivo alla Sapienzia – die Kapelle der Römer Universität – zeigt mit dem Kontrast von konkaven und konvexen Formen und der in einer spiralförmigen Spitze endenden Kuppel exemplarisch die Ausgefallenheit und Originalität von Borrominis Architektur, die ihn zum grossen Gegenspieler von Gian Lorenzo Bernini (1598–1680), dem zweiten «Stararchitekten» Roms im 17. Jahrhundert, machte.
Baumeister aus der Familie Porri (Pario) aus Bissone fanden schon vor Mitte des 16. Jahrhunderts ihren Weg nach Schlesien, etwas später auch nach Norddeutschland, Polen und schliesslich nach Schweden, wo sie im Auftrag der Kirche, von Königen, Fürsten, Adel und Städten Sakralbauten, Schlösser, Rathäuser und Festungen im Stil der lombardischen Renaissance errichteten. Giacomo Porri († 1575) arbeitete 1569/70 mit dem Luganeser Baumeister Giovan Battista Quadro († um 1590/91) an der Erweiterung des Warschauer Königsschlosses. Giacomos Bruder Francesco († 1580) trat als königlicher Architekt in die Dienste von Johann III. Wasa von Schweden (1537–1592, König ab 1568), für den er die Schlösser von Uppsala und Stockholm baute.
Die Bautätigkeit von Tessiner Baumeistern in Polen setzte sich im frühen 17. Jahrhundert fort. Matteo Castelli (um 1560–1632) – ein Neffe Domenico Fontanas und Carlo Madernos – wurde 1613 von König Sigismund III. Wasa (1566– 1632, ab 1587 König von Polen) an den Hof nach Warschau berufen, nachdem er zuerst auf Madernos Bauplätzen in Rom als Bildhauer, Vorarbeiter und Planer gelernt und gearbeitet hatte. Castelli arbeitete am Bau des Warschauer Schlosses, eines der ersten Barockschlösser Mitteleuropas, welches den Einfluss der Architektur Fontanas und Madernos verrät. Castelli war es, der 1630 seinen Neffen Costante Tencalla aus Bissone (um 1590–1646) nach Warschau holte, nachdem dieser in der Römer Werkstatt Madernos in die Lehre gegangen war. In Warschau trat Tencalla in königliche Dienste ein und schuf neben zahlreichen Bauten 1644 als eines seiner wichtigsten Werke die Sigismundsäule, das Wahrzeichen Warschaus auf dem Schlossplatz der polnischen Hauptstadt.
Grosse Bedeutung für die Verbreitung des italienischen Barocks nördlich der Alpen kam seit dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert den Baumeistern und Stuckateuren aus dem Misox zu. In der Gegenreformation manifestierte der intensive barocke Sakralbau in der Schweiz, in (Süd-)Deutschland, Österreich, Böhmen und Polen das neu erstarkte Selbstbewusstsein der katholischen Kirche. Diese wurde zur wichtigen Auftraggeberin für Baumeister und Künstler, die die neue Formensprache des Barocks beherrschten. Wie ihre Tessiner Kollegen aus dem Sottoceneri empfahlen sich die Misoxer ihren Bauherren durch eine überlegene Bautechnik und die gute Organisation der Bauplätze. Sie operierten in Bautrupps, die sich der Grösse und den Anforderungen des jeweiligen Bauauftrags flexibel anpassten. Die gemeinsame Herkunft, vielfältige verwandtschaftliche Verbindungen und die häufige Zusammenarbeit bürgten für einen gut eingespielten Baubetrieb, der auch schwierige Aufgaben bewältigte.
Gilg Vältin beziehungsweise Giulio Valentini (um 1540 bis nach 1616) aus Roveredo wirkte in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts im schwäbisch-bayerischen Raum. Vermutlich ging bei ihm Hans Alberthal (um 1575/80 bis um 1657), auch bekannt als Giovanni Albertalli und ebenfalls aus Roveredo stammend, in die Lehre. Dieser war später unter anderem in Dillingen, Augsburg, Eichstätt, Innsbruck, schliesslich in Bratislava tätig und gilt als ein Wegbereiter des Barocks in Süddeutschland.
Hatte der Dreissigjährige Krieg die Bautätigkeit in Süddeutschland längere Zeit zum Erliegen gebracht, so setzte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den Residenzen zahlreicher mittlerer und kleiner Fürstenstaaten ein eigentlicher Bauboom ein. Einige herausragende Repräsentanten sollen hier stellvertretend für diese Misoxer Baumeistertradition mit ausgewählten Bauten porträtiert werden.
Giacomo Angelini (1632–1714) – beziehungsweise Jakob Engel, wie er in Deutschland genannt wurde – aus San Vittore stand ab 1661 im Dienst des Fürstbischofs von Eichstätt. Als Hofbaumeister prägte Angelini massgeblich das barocke Stadtbild Eichstätts und errichtete zahlreiche Kirchenbauten in der Umgebung der Bischofsstadt. Sein grösster Auftrag war der Neubau der fürstbischöflichen Residenz ab 1700. Diese wurde von Engels Landsmann Gabriele de Gabrieli (1671–1747) zu Ende gebaut, nachdem dieser in jungen Jahren an der markgräflichen Residenz in Ansbach mitgebaut hatte. 1714 wurde de Gabrieli Engels Nachfolger als Eichstätter Hofbaumeister. In dieser Funktion errichtete er über 30 Kirchen, Schlösser, Adelspaläste und Denkmäler. De Gabrielis Laufbahn bestätigt die Bedeutung landsmannschaftlicher und verwandtschaftlicher Beziehungen in der Tätigkeit der Baumeister aus dem Misox: De Gabrielis Mutter war die Schwester von Gaspare Zuccalli (um 1637–1717), der ab 1688 in Salzburg Hofbaumeister des Erzbischofs war. Als Eichstätter Hofbaumeister wurde de Gabrieli von zwei Brüdern und weiteren Mitarbeitern aus dem Misox unterstützt. Über seinen Onkel Gaspare Zuccalli war de Gabrieli auch mit Enrico Zuccalli (1642–1724) verwandt, der seit 1679 als Hofbaumeister des Kurfürsten von Bayern die oberste Leitung der Bauprojekte der Wittelsbacher innehatte, die ihre politischen Ambitionen im Reich durch eine intensive Bautätigkeit zur Darstellung brachten. Enrico Zuccalli – wie de Gabrieli aus Roveredo gebürtig – vollendete in München die Theatinerkirche und Schloss Nymphenburg, bevor er mit dem Bau der Schlösser Lustheim, des Neuen Schlosses Schleissheim, der Erweiterung von Nymphenburg und ab 1709 mit dem Bau von Kirche und Kloster Ettal massgeblich die bayerische Barockarchitektur prägte. Bei der Erweiterung von Schloss Nymphenburg (1701–1705) arbeitete Zuccalli mit Giovanni Antonio Viscardi (1645–1713) – einem weiteren Misoxer – zusammen, der ihn nach seiner Absetzung durch die kaiserliche Besatzung 1706 als Hofbaumeister ablöste und in Bayern zahlreiche Schlösser und Klosterkirchen errichtete.
Tessiner Baumeister, wie etwa die Solari aus Carona, hatten schon seit dem 15. Jahrhundert für Moskauer Grossfürsten gearbeitet. Russland wurde aber vor allem seit der Regierungszeit von Zar Peter dem Grossen (1672–1725, Zar ab 1682) neben Italien, (Süd-)Deutschland und Polen eine weitere wichtige Wirkungsstätte der Baumeister aus den südalpinen Tälern. Der von Peter dem Grossen seit 1703 in der Newa-Mündung vorangetriebene Bau einer neuen Haupt- und Residenzstadt wurde massgeblich von Domenico Trezzini (um 1670–1734) geleitet. Trezzini aus Astano im Malcantone hatte nach seiner Lehrzeit in Rom zuerst für König Friedrich IV. von Dänemark (1671–1730, König ab 1699) in Kopenhagen an der Hafenbefestigung und am Wiederaufbau der Börse gearbeitet, bevor er zum Baumeister des Zaren berufen wurde. Er verwirklichte selber mehrere herausragende Gebäude, die bis heute das Stadtbild St. Petersburgs prägen, so die Peter-und-Paul-Festung (1706–1734), die Peter-und-Paul-Kathedrale mit ihrem markanten Glockenturm (1712–1732), den Sommerpalast der Zaren (1710–1714) oder das Alexander-Newski-Kloster (1715–1720). Trezzini steht am Anfang einer bemerkenswert langen Präsenz von Tessiner Architekten im Zarenreich, die bis weit ins 19. Jahrhundert andauerte. Landsmannschaftliche Netzwerke spielten auch hier eine Rolle, stammten doch die in Russland tätigen Baumeister aus den Familien Adamini, Gilardi, Rossi, Rusca und Visconti alle aus dem Umland von Lugano. Mehrere Generationen der Adamini aus Bigogno und der Gilardi aus Montagnola prägten mit ihren Bauten für die Herrscherfamilie, den Hochadel und die orthodoxe Kirche das (spät-)klassizistische Erscheinungsbild von St. Petersburg und Moskau.
Das Wanderschicksal der Tessiner und Bündner Baufachleute teilten auch manche Schweizer Maler und Bildhauer aus Gebieten nördlich der Alpen.
Schweizer Künstler aus Orten nördlich der Alpen mit einer Tätigkeit im Ausland (Auswahl, 16.–19. Jahrhundert)15
Seit der Reformation galten insbesondere die bilderfeindlichen reformierten Kantone als schwieriges Pflaster für Künstler, da diese in der frühen Neuzeit noch zu einem erheblichen Teil von kirchlichen Aufträgen lebten. Doch auch die katholischen Kantone, wo im 17. Jahrhundert ein intensiver barocker Sakralbau einsetzte, boten Künstlern weniger Beschäftigungsmöglichkeiten als das Ausland. Die auf Sparsamkeit und unmittelbare Nützlichkeit bedachten eidgenössischen Republiken waren mit Aufträgen für profane Repräsentationsbauten wesentlich knauseriger als die Monarchen und der Adel in den europäischen Fürstenstaaten, für die eine ostentative Zurschaustellung höfischen Glanzes und die mäzenatische Förderung der Kunst zum ständischen Selbstverständnis gehörten. Der Zürcher Maler Johann Caspar Füssli (1706–1782), der 1724–1731 in Wien und an süddeutschen Höfen als Porträtist tätig gewesen war und dessen Sohn Johann Heinrich Füssli (1741–1825) später in Rom und vor allem in London als Historienmaler sowie Professor an der Royal Academy Karriere machen sollte, schilderte in seiner «Geschichte der besten Künstler in der Schweiz» die Gründe, die Schweizer Künstler zur Auswanderung zwangen.
Johann Caspar Füssli zur Zwangsmigration von Schweizer Künstlern im Ancien Régime (1769)
«Es ist schwerer, als man glaubt, eine Geschichte der Künstler zu schreiben, von einer Nation, wo der grössere Teil bei einer edlen Einfalt der Sitten und einer glücklichen Mittelmässigkeit der Reichtümer ihren Aufwand mehr auf das Nötige verwendet, und wo folglich der Künstler, um zu einer wahren Grösse zu gelangen, aus Mangel von Kunst Sachen, und folglich auch Aufmunterung, sein Vaterland verlassen, und auswärts sich bilden muss, will er dann die Früchte seiner Kunst geniessen, so findet er sein Glück leichter und gewisser in Königs Städten und in Ländern, wo Pracht und Aufwand keine Grenzen haben.»16
GELEHRTE UND HAUSLEHRER
Zur Migrationsgeschichte der alten Schweiz gehören nebst den Söldnern, Zuckerbäckern, Kaminfegern und Baumeistern auch die Gelehrten und Hauslehrer – gewissermassen Migranten im Dienst der Wissenschaft und Erziehung. Diese hoch qualifizierten Spezialisten waren ausgeprägte Einzelwanderer und wurden bislang zu wenig in ihrer Bedeutung für eine schweizerische Verflechtungsgeschichte beachtet. Viele von ihnen verliessen das Land in der Erwartung, im Ausland eine bestimmte Lebensphase zu verbringen und dann mit besseren Aussichten auf eine angemessene berufliche und soziale Stellung in die Schweiz zurückzukehren. Für einige trat die Option der Rückkehr im Verlauf ihres Auslandsaufenthalts in den Hintergrund, weil sie ihre Kontakte zur alten Heimat gelockert und sich ihnen im Ausland attraktive Karriereperspektiven eröffnet hatten. Gelehrte und Gebildete verliessen die Schweiz, weil ihre geistige und kulturelle Kompetenz im Ausland mehr gefragt war als zu Hause, wo sie sich mit ihrem Wissen nicht das Ansehen und die Position verschaffen konnten, die ihren Kollegen im Ausland in Aussicht standen. Die Beschäftigung mit der Auswanderung von Schweizer Gelehrten und Gebildeten berührt auch die grundsätzliche Frage nach dem Status des gelehrten Wissens in der alten Schweiz. Fallbeispiele sollen die Chancen und Risiken der Gelehrtenwanderung aus der Schweiz erhellen.
Die Biografie Albrecht (von) Hallers (1708–1777) verdeutlicht den Spagat eines Mannes, der sich als Mediziner und Botaniker eine enorme Reputation in der europäischen Gelehrtenrepublik erwarb und zugleich als Angehöriger einer Familie am Rand des bernischen Patriziats darauf bedacht sein musste, seinen Nachkommen ein standesgemässes Auskommen in der aristokratischen Republik Bern zu sichern.
Haller galt im 18. Jahrhundert als einer der bedeutendsten Gelehrten Europas. Als Begründer der experimentellen Physiologie und als herausragender Botaniker gehörte er den wichtigsten europäischen Wissenschaftsakademien an. Die Reichweite seines Korrespondenznetzes zeigte seinen Rang und Einfluss an. Hallers Netzwerk umfasste 1200 Korrespondenten und reichte von Schweden bis Südspanien und von Irland bis Moskau. Der junge Haller war nach dem Studium der Medizin in Tübingen und Leiden 1729 nach Bern zurückgekehrt, wo er zunächst als Arzt praktizierte und sich erfolglos um die Stelle des Stadtarztes und eine Professur an der Hohen Schule bewarb. 1736 wurde er als Professor der Anatomie, Botanik und Chirurgie an die neue Universität Göttingen berufen, die als Reformuniversität die experimentelle Forschung förderte. Haller trug mit seinen Forschungen und Publikationen massgeblich zum Aufschwung der Göttinger Universität bei, an der er auch das Präsidium der Akademie der Wissenschaften übernahm. Gleichwohl kehrte er 1753 zur grossen Überraschung seiner Gelehrtenkollegen nach Bern zurück. Die Rückkehr erfolgte aus Gründen der langfristigen Familienökonomie. Die Haller waren wohl Burger der Stadt Bern und gelangten ab und zu in den Grossen Rat der Republik, doch gehörten sie nicht zur patrizischen Elite. Albrecht Haller war 1745 – noch von Göttingen aus – dank der Protektion des Berner Schultheissen in den Grossen Rat gewählt worden, doch war ihm sehr wohl bewusst, dass er nur mit seiner Anwesenheit in Bern sich selber und seinen Söhnen eine Perspektive im bernischen Magistratenstand sichern konnte. Im höheren Interesse der Familie brach Haller seine glänzende universitäre Karriere ab, verzichtete auf die Forschungseinrichtungen in Göttingen und hoffte, nach seiner Rückkehr auf eine einträgliche Landvogtei gewählt zu werden, die ihm und seinen Angehörigen ein standesgemässes Auskommen sichern sollte. Den sehnlichst erhofften Sprung in den Kleinen Rat schaffte er allerdings trotz neunmaliger Bewerbung nie. Um in der Berner Aristokratie ganz nach oben zu gelangen und dort zu bleiben, waren nicht wissenschaftliche Pionierleistungen gefragt, sondern die richtige Geburt.
Hallers Beispiel verdeutlicht, was für ein hartes Pflaster die Schweiz im 18. Jahrhundert für Gelehrte war. Die einzige Universität in Basel sowie die reformierten Hohen Schulen in Genf, Bern, Zürich und Lausanne waren keine Stätten der wissenschaftlichen Forschung, sondern dienten der Ausbildung von Theologen, Pfarrern und Juristen. Für Gelehrte, die wie Haller Wissenschaft als empirische Naturforschung betrieben und für ihre Experimente an Tieren und Pflanzen Labors und botanische Gärten benötigten, gab es in der Schweiz keine institutionelle Wirkungsstätte. Hier fehlten auch Akademien der Wissenschaften, die in den grossen Monarchien seit dem 17. Jahrhundert als neuartige Forschungseinrichtungen zum Nutzen der Gelehrsamkeit sowie zum Ruhm der Monarchen gegründet worden waren. Die kleinen eidgenössischen Republiken hätten es nie als ihre Aufgabe betrachtet, mit Staatsgeldern Wissenschaftsakademien zu unterhalten – nicht etwa, weil ihnen das Geld dazu gefehlt hätte, sondern weil dies ausserhalb ihres kulturellen Horizonts und ihres Staatsverständnisses lag. Sie investierten wohl Geld in die Ausbildung von Pfarrern, die nützlich waren, um die Menschen im richtigen Glauben und in der christlichen Moral zu unterrichten, aber nicht in die Forschung, den ergebnisoffenen Prozess der Akkumulation von Wissen.
Schweizer Gelehrten, die sich wie Haller mit ihren Forschungen und Publikationen in der europäischen Gelehrtenrepublik profilieren und von der Wissenschaft leben wollten, blieb nur die Auswanderung übrig.
Schweizer Gelehrte der frühen Neuzeit im Ausland (Auswahl, 16.–18. Jahrhundert)17
Was für Haller der Aufenthalt in Göttingen gewesen war, wurde für andere Schweizer Gelehrte der Aufenthalt an der Akademie in Berlin oder in St. Petersburg. Im 18. Jahrhundert stammte zeitweilig ein Drittel der Mitglieder der Berliner Akademie aus der Schweiz. Besonders eindrücklich war die Schweizer Präsenz an der russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, wo ein eigentliches helvetisches Netzwerk die Politik der Akademie im 18. Jahrhundert wesentlich bestimmte.
Als die noch von Peter dem Grossen 1725 gegründete Akademie in St. Petersburg unter Zarin Katharina I. (1684–1727, regierende Zarin ab 1725) ihre Tätigkeit aufnahm, musste sie als Erstes renommierte Gelehrte aus dem Ausland gewinnen. In Russland selber, das sich unter Zar Peter kulturell stark nach Westeuropa hin geöffnet hatte, fehlte das geeignete Personal. Unter den 22 Ausländern, die zwischen 1725 und 1727 ihre Arbeit als residierende Akademiemitglieder in St. Petersburg aufnahmen, befanden sich auch die Basler Mathematiker Jacob Hermann (1678–1733), Leonhard Euler (1707–1783) sowie Nicolaus (1695–1726) und Daniel Bernoulli (1700–1782).
Basel war im späten 17. und im 18. Jahrhundert ein europäisches Zentrum der Mathematik, Physik und Mechanik. Dies hatte weniger mit der Qualität der dortigen Universität zu tun als mit der Tatsache, dass sich die Bernoulli – eine ursprünglich aus Antwerpen stammende Frankfurter Refugiantenfamilie – 1622 in Basel eingebürgert hatten. Mit den Gebrüdern Jakob (1654–1705) und Johann (1664–1748) stellte diese Familie zwei der besten Mathematiker ihrer Zeit. Die Bernoulli-Brüder begründeten eine eigentliche Gelehrtendynastie, deren Angehörige zusammen mit ihren Schülern Jacob Hermann und Leonhard Euler im frühen 18. Jahrhundert in Europa den Ruhm der Basler Mathematik und Physik begründeten.
Nicht von ungefähr holte sich die junge Petersburger Akademie also ihre Mathematiker in der Stadt am Rheinknie. Sie nutzte dabei die Dienste angesehener, gut vernetzter Gelehrter in Mitteleuropa. Für die St. Petersburger Akademie suchte Christian Wolff (1679–1754), der berühmte Philosoph, Jurist und Mathematiker der deutschen Aufklärung, im deutschsprachigen Raum nach geeigneten Gelehrten, unterbreitete der Akademie Personalvorschläge und handelte teilweise direkt mit den Kandidaten die Anstellungsbedingungen aus. Wolff knüpfte auch die ersten Kontakte zu Johann I. Bernoulli, der zwar selber die Anfrage ablehnte, doch an seiner Stelle seine Söhne Nicolaus und Daniel empfahl. Beide zogen in der Folge nach Russland, wo Nicolaus sehr früh verstarb und Daniel bis zu seiner Rückkehr nach Basel 1733 wirkte. Auf der Basis dieser frühen persönlichen und institutionellen Verbindung zur Akademie konnten sich die Beziehungen zwischen Russland und Basel verstetigen und dauerhaft für die Rekrutierung neuer Gelehrter genutzt werden.
Bei den Berufungen an die russische Akademie der Wissenschaften zog das Basler Netzwerk im 18. und frühen 19. Jahrhundert die Fäden. Besonders erfolgreich war das Gespann Daniel Bernoulli (in St. Petersburg 1725–1733) und Leonhard Euler (in St. Petersburg 1725–1741, 1766–1783), die beide als Schaltstellen bei der Rekrutierung von Akademieangehörigen aus der Schweiz fungierten. Nur zwei Schweizer Gelehrte – der Schaffhauser Botaniker Johann Ammann (1707–1740; ab 1733 in St. Petersburg) und der Basler Mathematiker Jacob Hermann (in St. Petersburg 1725–1731) – verdankten ihre Mitgliedschaft in der Akademie nicht unmittelbar diesem Netzwerk. Daniel Bernoulli holte beziehungsweise vermittelte nicht nur seinen Bruder Johann II. (1710–1790; in St. Petersburg 1732–1733), sondern auch Euler selbst nach Russland. Leonhard Euler wiederum holte den Neuenburger Schneidersohn und Mathematiker Frédéric Moula nach St. Petersburg (1703–1782; in St. Petersburg 1733–1735/36 [?]). Gemeinsam warben Daniel Bernoulli und Euler in Basel auch den Schreinersohn und Mathematiker Niklaus Fuss (1755–1825; in St. Petersburg 1773–1825) sowie den Mechaniker für mathematische Instrumente Isaak Bruckner (1686– 1762; in St. Petersburg 1733–1745) an. Euler sicherte den langfristigen Einfluss dieses Beziehungsnetzes. Nach einem ersten längeren Aufenthalt in St. Petersburg 1727–1741 war er von 1741 bis 1766 als Direktor der Mathematischen Klasse der preussischen Akademie in Berlin tätig, ohne aber die Beziehungen nach Russland abzubrechen. Mehr als die Hälfte der deutschen Gelehrten, die zwischen 1741 und 1766 an die St. Petersburger Akademie wechselten, verdankten ihren Ruf Eulers Empfehlung. Als Zarin Katharina II. (1729–1796, Kaiserin ab 1762) Euler 1766 nach St. Petersburg zurückholen wollte, sagte dieser unter der Bedingung zu, seinen in Russland geborenen Sohn Johann Albrecht (1734–1800) – selber Physiker und Mathematiker, Mitglied der preussischen Akademie und Direktor der Berliner Sternwarte – mit nach Russland nehmen zu können. 1769 wurde Johann Albrecht Euler zum Sekretär der St. Petersburger Akademie ernannt, was ihm grossen Einfluss auf die Tätigkeit der Akademie verschaffte. Er lud die beiden Genfer Astronomen Jean-Louis Pictet (1739–1781) und Jacques-André Mallet (1740–1790) ein, in Russland 1769 den Gang der Venus vor der Sonne zu beobachten und naturkundliche Forschungen in Lappland anzustellen. 1786 holte Johann Albrecht Euler seinen Schwiegersohn Jacob Bernoulli (1759–1789) nach St. Petersburg. Vater Leonhard Euler, ab 1771 praktisch erblindet, zog 1773 den jungen Basler Niklaus Fuss als ständigen Gehilfen nach. Fuss wurde 1783 selber Professor für Mathematik und folgte 1800 seinem Schwiegervater Johann Albrecht Euler als Sekretär der Akademie nach, womit sich der Einfluss des Basler Netzwerks auf die Berufungspolitik der russischen Akademie um eine weitere Generation verlängerte. Fuss war massgeblich an der Ernennung seines Schwagers Jacob Bernoulli beteiligt und wirkte bei der Berufung der beiden Zürcher Hans Jakob Fries (Chirurg; 1749–1801) und Johann Kaspar Horner (Astronom, Geograf; 1774–1834; in St. Petersburg 1806–1809) an die Akademie mit. Fuss’ Sohn Paul Heinrich (1798–1855) – wiederum ein Mathematiker – folgte seinem Vater als Sekretär der Petersburger Akademie nach.
Vater und Sohn Euler sowie Niklaus Fuss, der als Gatte der Euler-Tochter beziehungsweise -Enkelin zu diesem familiären Netzwerk gezählt werden muss, bestimmten über ein Jahrhundert lang die Entwicklung der Petersburger Akademie mit und stiegen in Russland bis in höchste Staatsämter auf. Die temporäre oder dauerhafte Auswanderung schweizerischer Gelehrter brach nach diesen ersten Pioniergenerationen keinesfalls ab, sondern setzte sich im 19. Jahrhundert verstärkt fort und war damit Teil einer insgesamt beachtlichen Wanderung von Schweizerinnen und Schweizern nach Russland, die mit der Russischen Revolution 1917 abrupt abbrach.
Die Aufenthalte Albrecht Hallers in Göttingen und der Basler Mathematiker in Russland stellen die Spitze eines breiteren Phänomens dar. Als diese Gelehrten mit ihren Forschungen Wissenschaftsgeschichte schrieben, waren zahlreiche gut ausgebildete Schweizerinnen und Schweizer als Erzieher, Hauslehrer und Gouvernanten im Ausland tätig. Erzieher und Hauslehrer sind eine charakteristische Erscheinung der europäischen Schul- und Bildungsgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Adelige und wohlhabende Bürger, die es sich leisten konnten, stellten Privatlehrer für die individuelle schulische Bildung und Erziehung ihrer Kinder an. Die Pädagogen hielten sich für eine vertraglich vereinbarte Zeit im Haushalt ihres Dienstherrn auf und schulten die ihnen anvertrauten Kinder im Einzelunterricht. Zu ihren Aufgaben als Erzieher konnte es auch gehören, die ihnen anvertrauten Zöglinge im fortgeschrittenen Alter auf Bildungsreisen durch Europa oder beim Studium an die Universität zu begleiten. Viele Schweizer Abgänger von Universitäten und Hohen Schulen überbrückten im 18. Jahrhundert die Wartezeit bis zur Anstellung als Pfarrer oder in einem anderen Amt mit der zeitweiligen Beschäftigung als Erzieher und Hauslehrer im Ausland. In der zweiten Jahrhunderthälfte war das Überangebot an Theologen in der reformierten Schweiz so gross, dass viele unter ihnen lange – mitunter vergeblich – auf die Wahl auf eine vakante Pfründe warteten. Für ledige Frauen bot die Anstellung als Erzieherinnen in adeligen und grossbürgerlichen Familien des Auslands im späten 18. und 19. Jahrhundert eine attraktive, ihren geistigen und kulturellen Fähigkeiten entsprechende Erwerbsmöglichkeit, die für sie in der Schweiz erst mit dem starken Ausbau der Volksschule im Verlauf des 19. Jahrhunderts entstehen sollte.
Besonders Männer und Frauen aus der reformierten französischsprachigen Schweiz empfahlen sich mit einer guten Ausbildung für Anstellungen als Pädagoginnen und Pädagogen im Ausland. Sie beherrschten die französische Sprache und hatten den richtigen, protestantischen Glauben. Französischkenntnisse waren im 18. Jahrhundert eine unabdingbare Voraussetzung nicht nur für eine berufliche Karriere in Politik und Diplomatie, sondern auch für die Gesellschaftsfähigkeit von Angehörigen der Oberschicht. Gleichzeitig kam der religiös-moralischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen ein hoher Stellenwert zu, weshalb protestantische Fürsten, Adelige und Bürgerfamilien in Deutschland, den Niederlanden, Skandinavien und Russland ihre Zöglinge lieber Pädagogen und Gouvernanten aus Neuchâtel, der Waadt und Genf anvertrauten als katholischen Franzosen.
Ein Gesamtbild dieser Pädagogenmigration zu vermitteln, ist schwierig, doch schätzt man, dass Hunderte von Schweizerinnen und Schweizern im 18. und 19. Jahrhundert im Ausland tätig waren. Wiederum ragen einzelne Figuren heraus, die nach ihrer Tätigkeit als Hauslehrer und Erzieher beziehungsweise Erzieherinnen in anderen Positionen Berühmtheit erlangten. Stellvertretend für zahlreiche andere kann hier Frédéric-César de la Harpe (1754–1838) genannt werden, der Waadtländer Revolutionär und Mitglied des Helvetischen Direktoriums 1798–1800. Zwischen 1783 und 1795 war er für die Erziehung von Alexander und Konstantin Romanow, der beiden Enkel von Zarin Katharina II. von Russland, verantwortlich gewesen und hatte damit die Basis für eine lebenslange, enge Beziehung zur russischen Zarenfamilie gelegt. Dies gilt ebenso für Jeanne Huc-Mazelet (1756–1852) aus Morges, die von 1790 bis 1794 für die Erziehung von Alexanders jüngerer Halbschwester Maria Pawlowna (1786–1859) zuständig war. Beide Waadtländer nutzten ihre Beziehungen zu Zar Alexander I. (1777–1825, Zar ab 1801) beziehungsweise zu dessen Schwester, als es nach dem Zusammensturz der Herrschaft Napoleons 1813– 1815 für die Waadtländer Politik darum ging, die Diplomatie der Grossmächte gegen Berns Ansprüche auf die Restauration der Herrschaft über die Waadt zu mobilisieren und die Souveränität des jungen Westschweizer Kantonalstaats abzusichern.
Schweizer Erzieherinnen bzw. Erzieher und Hauslehrer im Ausland (Auswahl, 17.–19. Jahrhundert)18
Die Beobachtungen zur Auswanderung und Rückwanderung von Gelehrten, Erziehern und Hauslehrern geben Anlass zu einigen allgemeinen Feststellungen zur Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte der Schweiz. Im Vergleich zum Ausland, wo Wissenschaftsakademien und Reformuniversitäten das höhere Bildungswesen und die Dynamik der Forschung in Medizin und Naturwissenschaften bestimmten, fällt die Rückständigkeit der höheren Bildungseinrichtungen in der Schweiz des Ancien Régime auf. Hier richteten erst die liberalen Regierungen im 19. Jahrhundert Universitäten als zeitgemässe Forschungs- und Bildungsanstalten ein. Die alte Schweiz hingegen bot ihren Gelehrten keine deren Fähigkeiten entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeiten. Ihre Forschung betrieben die Schweizer Gelehrten in ihrer Freizeit und als Mitglieder zahlreicher privater gelehrter Gesellschaften, sicherten sich daneben aber ihre Existenz in einem Brotberuf als Pfarrer oder Magistraten, sofern sie nicht als Privatgelehrte von ihrem Vermögen leben konnten. Nicht zufällig stammten zahlreiche Schweizer Gelehrte des 18. Jahrhunderts aus Familien der soziopolitischen Elite. Der Ruf an eine Universität oder Akademie im Ausland bot demgegenüber die Gelegenheit, aus der Vereinzelung eines privaten Gelehrtendaseins hinauszutreten und die Forscherneugier in einem engen institutionellen Austausch mit Gleichgesinnten und gegen Bezahlung befriedigen zu können. Besonders die Zugehörigkeit zu einer Wissenschaftsakademie versetzte die Gelehrten in einen prestigeträchtigen Kontext am Hof eines grossen Monarchen, wo sich mit innovativer Forschung nicht nur Ruhm und Ehre in der Gelehrtenrepublik, sondern auch die Gunst und Zuwendung eines mächtigen Patrons erwerben liessen – ganz im Unterschied zu den republikanisch-aristokratischen Kleinstaaten zu Hause, wo wissenschaftliche Leistungen keine Karriereperspektiven eröffneten und die Obrigkeiten keinerlei Interesse bekundeten, die Staatseinnahmen für die Finanzierung wissenschaftlicher Forschung statt für die Alimentierung der regierenden Geschlechter zu verwenden.
WER GEHT, WER KOMMT? ZUR SCHWEIZER SIEDLUNGSWANDERUNG
Siedlungswanderungen waren aufgrund ihres kollektiven Charakters und der Perspektive der Migrierenden auf die dauerhafte Niederlassung am Zielort in der Regel organisierte Unternehmungen. Sie wurden von interessierten Kreisen in den Zielländern vorangetrieben und sollten grössere Gruppen zur dauerhaften Verlegung ihres Lebensmittelpunkts bewegen.
Grössere Gruppen von Schweizer Siedlungswanderern wanderten erstmals gegen Ende des Dreissigjährigen Kriegs in den 1640er-/1650er-Jahren aus. Im Dreissigjährigen Krieg hatten Württemberg oder die Pfalz Bevölkerungsverluste von bis zu 70 Prozent hinnehmen müssen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden diese Gebiete erneut durch Kriege zwischen Frankreich und dem Reich in Mitleidenschaft gezogen. Die Landesherren dieser Territorien in der näheren und weiteren Nachbarschaft warben deshalb in der vom Krieg verschonten Schweiz um Bauern, die die entvölkerten Landstriche wieder besiedeln sollten. Zwischen 1660 und 1740 zogen 15 000 bis 20 000 Menschen in Richtung Freigrafschaft Burgund, Elsass, Pfalz, Baden, Württemberg, Bayern und Brandenburg weg.
Europäische Destinationen schweizerischer Siedlungswanderung (17.–18. Jahrhundert)19
Die geschätzten Werte vermitteln wenig von der sozialen Dynamik und den organisatorischen Herausforderungen von Siedlungswanderungen in der frühen Neuzeit. Regionalstudien vermögen besser die Ausmasse und die lokalen Muster der permanenten Auswanderung aufzuzeigen.
Aus 22 Dörfern des bernischen Aargaus wanderten zwischen 1648 und 1700 jeweils 5 bis 115 Personen in die Pfalz aus. Zwischen 10 und 40 Prozent der Bewohner dieser Dörfer verliessen in diesem Zeitraum definitiv das Land.20 Dabei konnten sich regionale Auswanderungstraditionen einspielen, die sich über mehrere Generationen erstreckten, wie das Beispiel der Kirchgemeinde Ottenbach im Zürcher Knonauer Amt zeigt: Zwischen 1649 und 1749 verliessen insgesamt 667 Personen die Gemeinde, mehr als 75 Prozent in Richtung Elsass, Zweibrücken und Pfalz. Die Auswanderung erfolgte dabei keineswegs kontinuierlich, sondern in ausgeprägten Wellenbewegungen.21
Die Auswanderer aus dem Knonauer Amt waren überwiegend sogenannte Tauner, das heisst Angehörige der ländlichen Unterschicht, deren Haushalte sich von den bescheidenen Gütlein und der Betätigung im Landhandwerk kaum ernähren konnten und die folglich in Ernte- und Teuerungskrisen als Erste unter Hunger und Not zu leiden hatten. Auch Knechte und Mägde zogen weg, die im Ausland wegen des Arbeitskräftemangels gute Beschäftigungsmöglichkeiten fanden. Eine eigene Gruppe stellten die Täufer, Angehörige einer in der Reformation entstandenen Freikirche, dar, die sich trotz der Verfolgung durch die Obrigkeit meist in peripheren ländlichen Räumen hatten halten können. Die Auswanderung eröffnete dieser Glaubensgruppe die Aussicht, sich ein für allemal der Verfolgung durch Kirche und Obrigkeit zu entziehen und in der Fremde eine sichere Existenz mit herrschaftlich garantierter Glaubensfreiheit aufzubauen. Im Elsass und in anderen Gebieten gehörten die fleissigen Täufer aus der Schweiz bald einmal zu den Pionieren des Landbaus, die auf ihren Höfen erfolgreich Methoden zur Steigerung der agrarischen Erträge ausprobierten.
Die auswandernden Aargauer und Knonauer versuchten, die mit dem Wechsel ihres Wohnorts verbundenen Risiken möglichst gering zu halten. Sie setzten auf Faktoren der Konstanz und Stabilität, die die Kosten der Ansiedlung in der Fremde berechenbarer machen sollten. Sie bevorzugten Zielgebiete, deren Konfession und Sprache ihnen vertraut waren. Gerne zogen sie auch in Gegenden, wo sich früher ausgewanderte Verwandte oder Nachbarn niedergelassen hatten. Vor dem Aufbruch verkauften sie nicht ihren gesamten Grundbesitz, um so ihr Bürgerrecht in der Gemeinde zu behalten und sich die Option auf die Rückkehr offenzuhalten. Die endgültige Ablösung von der alten Heimat erfolgte mitunter erst Jahrzehnte nach dem Wegzug.
Für Siedlungswanderer nach Übersee entfiel die Option der Rückwanderung allerdings in den allermeisten Fällen, sei dies aus Kostengründen oder aus politisch-rechtlichen Überlegungen. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht das frühe Kolonisationsprojekt des Berner Patriziers Christoph von Graffenried (1661–1743), der 1710 eine Gruppe von 106 Auswanderern anführte, mit denen er sich im heutigen North Carolina niederlassen und dort die Stadt New Berne gründen wollte.22 Die bernische Obrigkeit unterstützte das Vorhaben, bestand doch mehr als die Hälfte der Gruppe aus verhafteten Täufern, die der Berner Rat auf diese Weise endgültig loswerden wollte. Die englische Krone förderte das Unternehmen aus kolonialpolitischen Gründen. Von den im März 1710 mit der Kolonistengruppe abgereisten Täufern traf allerdings kein einziger in Nordamerika ein, weil sie sich auf dem Weg nach Amsterdam von Glaubensgenossen in Deutschland und in den Niederlanden befreien liessen. Auch das Kolonisationsprojekt in Übersee endete schon 1713 abrupt, nachdem von Graffenried bei der Suche nach Bodenschätzen von Indianern gefangen genommen und erst gegen die Zusicherung, die Kolonie nicht weiter auszubauen und die Indianer nicht in ihren Fisch- und Jagdrechten einzuschränken, wieder freigelassen worden war. Während Graffenrieds Gefangenschaft war die Siedlung New Berne von den Indianern weitgehend zerstört worden.
Trotz solchen Rückschlägen setzte seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine permanente Schweizer Auswanderung in die englischen Kolonien Nordamerikas ein. In den Vereinigten Staaten von Amerika lebten schon 1790 etwa 25 000 Auswanderer aus der Schweiz, mehrheitlich in Städten. Ihren Höhepunkt erreichte die Massenauswanderung im 19. Jahrhundert. In jedem Jahrzehnt zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und den 1920er-Jahren verliessen die Menschen zu Zehntausenden definitiv die Schweiz. Allein in den 1880er-Jahren waren es mehr als 90 000, die von der Aussicht auf ein besseres Leben in Übersee angelockt wurden. Die Auswanderung wurde massgeblich durch professionelle Auswanderungsagenturen organisiert und durch die rasante Verbesserung der Transportmittel (Eisenbahn, Hochseedampfer) erleichtert. Neben Nord- und Südamerika war Russland seit dem 18. Jahrhundert eine wichtige Destination für Siedlungswanderer. Bis zur Russischen Revolution 1917 zogen mehr als 20 000 Schweizerinnen und Schweizer vorübergehend oder auf Dauer nach Russland, darunter – neben Hofbeamten und Offizieren, Architekten, Gelehrten, Ärzten, Zuckerbäckern, Erziehern und Gouvernanten – im 19. Jahrhundert auch zahlreiche Käser.
EINWANDERER VERÄNDERN DIE SCHWEIZ
In der frühen Neuzeit handhabten Städte und Dörfer die dauerhafte Niederlassung und bürgerrechtliche Integration von Fremden aus Angst vor wirtschaftlicher Konkurrenz und vor den steigenden Kosten für die Armenfürsorge grundsätzlich sehr restriktiv. Die Zuwanderung grösserer Gruppen in die Schweiz blieb bis zur starken Immigration von Arbeitskräften im Zeitalter der industriellen und demografischen Revolution im 19. Jahrhundert die Ausnahme. Eine solche Ausnahme stellten die reformierten Glaubensflüchtlinge dar, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert einwanderten und ein wichtiges Kapitel der schweizerischen Migrationsgeschichte bilden. Die reformierten Territorien der alten Schweiz waren naheliegende Zufluchtsorte für Menschen, die wegen ihres protestantischen Glaubens zur Flucht beziehungsweise Auswanderung gezwungen wurden. Als Kernlande der (zwinglischen und calvinischen) Reformation boten die reformierten Orte diesen Menschen Schutz vor Verfolgung. In Genf, in der Waadt, in Neuenburg sowie in den reformierten Städten der deutschen Schweiz ersuchten Glaubensflüchtlinge aus Italien (Veltlin, Toscana), Savoyen, Frankreich und England schon ab den 1530er-Jahren um Hilfe und um zeitweilige oder dauerhafte Aufnahme.
Neugläubige Glaubensflüchtlinge gelangten in zwei Phasen in die reformierte Schweiz. Eine erste Bewegung («premier refuge») setzte in den 1530er-/1540er-Jahren ein und dauerte bis zum Ende der Religionskriege in Frankreich und der Proklamation des Toleranzedikts von Nantes 1598 durch den französischen König Heinrich IV. (1553–1610, ab 1589 König von Frankreich). Zentren der Zuwanderung waren die reformierten Gebiete der Westschweiz, allen voran Genf, dann aber auch die bernische Waadt und Neuenburg. Fast 8000 Refugianten liessen sich schätzungsweise zwischen 1549 und 1587 als Hintersassen in Genf nieder, das 1580 etwa 17 300 Einwohner zählte. 3000 Flüchtlinge blieben auf Dauer in Genf und machten sich dort als Drucker, Buchhändler und besonders als erfolgreiche Textilfabrikanten und -händler einen Namen. Viele Refugianten der ersten Flüchtlingswelle kehrten nach Frankreich zurück, sobald es die sehr wechselhafte konfessionspolitische Lage in Frankreich zuliess.
Die grosse Einwanderung französischer Hugenotten («second refuge») datiert aus dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts und dem frühen 18. Jahrhundert und wurde durch die Religionspolitik König Ludwigs XIV. von Frankreich ausgelöst, der 1685 das Toleranzedikt von Nantes widerrief. Ungefähr 150 000 Hugenotten sollen die Flucht der erzwungenen Konversion vorgezogen haben. Etwa 60 000 durchquerten dabei die Schweiz, doch liessen sich nur rund 20 000 definitiv hier nieder. Die Solidarität mit den savoyischen und französischen Glaubensbrüdern und -schwestern hielt sich auch in den reformierten Städten und Kantonen in engen Grenzen, sobald erste Hilfe einmal geleistet worden war. Angst vor wirtschaftlicher Konkurrenz, vor politischen Repressalien des mächtigen Nachbarn Frankreich sowie die Ernte- und Hungerkrisen des späten 17. Jahrhunderts veranlassten die Orte zur Wegweisung der meisten Flüchtlinge. Da diese im Gegensatz zu den Glaubensflüchtlingen im 16. Jahrhundert nicht mehr nach Frankreich zurückkehren konnten, zogen viele nach Deutschland weiter, wo sie vor allem in calvinistischen und lutherischen Territorien aufgenommen wurden.
Unter den Familien, die sich nach der Flucht dauerhaft in der Schweiz niederliessen, fanden einige Zugang zur Elite ihrer neuen Heimatstadt, wobei vielfach ihr unternehmerischer Erfolg die Verbindung zu den führenden Geschlechtern anbahnte und die Integration in die soziopolitische und kulturelle Elite erleichterte. Das wirtschaftliche, kulturelle und politische Profil der Städte Genf, Lausanne, Neuenburg, Basel und Zürich in der Neuzeit ist massgeblich von eingewanderten Familien mit Refugiantenhintergrund geprägt worden. Die erfolgreiche Einbindung in die städtische Oberschicht liess die Erinnerung an diese Herkunft mit der Zeit verblassen.
Refugiantenfamilien in der Oberschicht der Städte Genf, Lausanne, Neuchâtel, Basel und Zürich (Auswahl, 16.–18. Jahrhundert)23
Die Integrationspolitik der Stadt Genf spiegelt deutlich die beiden grossen Flüchtlingsbewegungen wider. Mehrere Familien aus dem ersten Refuge (Mitte und zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts) fanden Zugang zur Elite. Darunter waren Franzosen und Luccheser stark vertreten. Zürich nahm protestantische Familien aus südalpinen Tälern auf, besonders jene, die 1555 auf Druck der katholischen Orte Locarno hatten verlassen müssen. Refugianten aus Lothringen und den spanischen Niederlanden bevorzugten die deutschsprachige eidgenössische Grenzstadt Basel. Nicht immer gelangten die Refugianten auf direktem Weg an ihre neue Bleibestätte. Die Wanderung konnte über mehrere Stationen erfolgen, in deren Verlauf die Familien sich in Linien aufspalteten, so im Fall der Fatio, die einen Zweig in Basel und in Genf begründeten, oder bei den Pourtalès, die je eine Linie mit Bürgerrecht in Genf und in Neuenburg besassen. Für die Aufnahme dieser Familien ins städtische Bürgerrecht sowie deren Aufstieg in die soziale, politische und kulturelle Elite ihrer neuen Heimatstadt legte häufig wirtschaftlicher Erfolg die Grundlage. Die Familien aus Lucca und aus dem Locarnese brachten das Seidengewerbe nach Genf beziehungsweise nach Zürich und etablierten dort eine blühende Seidenindustrie. Die Franzosen Fazy, Deluze und Pourtalès führten um 1700 die Indiennefabrikation ins Land ein. Der wirtschaftliche Erfolg dieser Familien auch nach der erzwungenen Migration gründete in der Tatsache, dass sie ihr bewegliches Vermögen, oft in Form von Wechselbriefen, rechtzeitig ins Ausland transferiert und die Liquidität für ihre Geschäftstätigkeit bewahrt hatten. Ebenso hatten sie ihre Bestellbücher und Kundendaten mitgenommen. Die Geschäftsbeziehungen und die unternehmerischen Qualifikationen waren im Gepäck der Refugianten mitgewandert, was eine entscheidende Voraussetzung dafür bildete, dass die reformierten Gebiete der Schweiz seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein starkes Wachstum in verschiedenen Branchen der gewerblichen Warenproduktion erlebten. Heiratsverbindungen mit Familien aus der alten lokalen Elite eröffneten erfolgreichen Zuwanderern auch den Zugang zu den Räten. Sie sicherten auf diese Weise nicht nur ihren bemerkenswerten sozialen Aufstieg in der neuen Heimat ab, sondern gewannen auch Einfluss auf die Politik, nicht zuletzt auch auf die Wirtschafts- und Handelspolitik ihrer Städte. Materieller Wohlstand ermöglichte vielen männlichen Angehörigen dieser Familien akademische Studien und ein Leben als Gelehrte. Zahlreiche Theologen und Juristen wirkten als Professoren an Universitäten, Akademien oder Hohen Schulen. Seit dem späten 17. Jahrhundert brachten diese Familien auch Mediziner und Naturforscher hervor, die sich als Privatgelehrte und Pioniere in der Botanik, Geologie oder Alpenforschung einen Namen in der europäischen Gelehrtenrepublik machten.
Ein Massenphänomen wurde die Einwanderung in die Schweiz allerdings erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die expandierende Schweizer Wirtschaft ihren Bedarf an Arbeitskräften immer weniger im Inland decken konnte. Die Zuwanderung übertraf zahlenmässig erstmals zwischen 1888 und 1900 die Auswanderung. Vor dem Ersten Weltkrieg machten die mehrheitlich unqualifizierten italienischen Bauarbeiter mehr als ein Drittel der Ausländer in der Schweiz aus. Ihre starke Präsenz, die Angst der Schweizer Arbeiter vor ausländischer Konkurrenz und sinkenden Löhnen sowie fremdenfeindliche Gefühle provozierten in Bern 1893 und in Zürich 1896 Zusammenstösse zwischen italienischen und Schweizer Arbeitern sowie den Ordnungskräften.