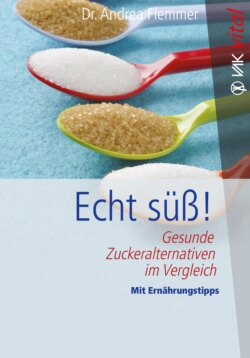Читать книгу Echt süß! - Andrea Flemmer - Страница 6
ОглавлениеWie und warum schmeckt man süß und bevorzugt diese Geschmacksrichtung?
Der Mensch ist in seiner Entwicklung in die Natur eingebunden. So hatten zwei Millionen Jahre lang diejenigen einen Überlebensvorteil, die schnell und ständig an energiereiche Nahrung herankamen. Dies war auch nötig, da das ständig wachsende Gehirn sehr viel Energie benötigt, nämlich 20 bis 30 % des Energiebedarfs. Damit liegt es an der Spitze des Verbrauchs aller unserer Organe, das Herz eingeschlossen. Daraus entwickelte sich auch unsere Vorliebe für fette Speisen, wie zum Beispiel Pommes frites. Außerdem benötigen wir schnell Energie – und diese bekommen wir von einfachen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Zucker. Ein Grund dafür, dass wir ihn so sehr lieben, denn er kann im Stoffwechsel sofort zur Energiegewinnung genutzt werden.
Die Vorliebe für Süßes ist uns angeboren!
Nicht nur zu unserem Vorteil hat sich allerdings unser Lebenswandel von einer überwiegend bewegungsreichen zu einem nahezu bewegungslosen Leben verändert, nur die Nahrungspräferenzen blieben gleich. Ein weiterer Grund für „die süße Lust“ am Zucker ist, dass uns die Vorliebe für Süßes angeboren ist.
Schon die Amnionflüssigkeit (Flüssigkeit in der Gebärmutter, rund um den Fötus) enthält Zucker. Etwa ab der 14. Woche beginnt das Ungeborene täglich bis zu drei Liter Fruchtwasser in kleinen Schlucken zu trinken und nimmt damit auch Zucker auf. Auf diese Weise sind wir bereits vor der Geburt an Süßes gewöhnt. Dann geht es munter weiter. Die Muttermilch enthält etwa 6 % Milchzucker. Zusammen mit der beim Trinken empfundenen Geborgenheit wird so der „Grundstein“ dafür gelegt, dass noch im Erwachsenenalter häufig Trost in Süßem bzw. Süßigkeiten gesucht wird. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass industriell hergestellte Babynahrung häufig recht hohe Zuckermengen enthält, von denen selbst Gemüsebreie nicht verschont bleiben. Grund dafür ist weniger der Bedarf der Kleinen an Süßem, als der Appell an den Geschmack der Mutter. Die Kinder erhalten meist nur, was auch den Müttern schmeckt.
Die speziellen Kinderlebensmittel sind gegenüber Lebensmitteln für Erwachsene auch noch häufig deutlicher gesüßt und setzen die Geschmacksschwelle für „süß“ immer weiter hinauf – mit entsprechenden Konsequenzen für das Leben als Erwachsene.
Dazu kommt, dass Süßes den Weg dafür öffnet, dass der Eiweißbaustein Tryptophan vom Blut ins Gehirn gelangen kann. Diese Aminosäure ist die Vorstufe des Botenstoffes Serotonin, der auch als „Glückshormon“ bezeichnet wird. Dieser Kreislauf ist auch der Grund dafür, dass Menschen in Frustsituationen oder in der dunklen Jahreszeit vermehrt Süßigkeiten naschen, denn Serotonin sorgt für gute Laune.
Aber wie schmeckt man nun süß?
Heutzutage unterscheidet man fünf Grundqualitäten des Geschmacks: süß, sauer, salzig, bitter und umami (japanisch: fleischig, herzhaft). Dutzende verschiedenartigster Substanzen vermitteln den Geschmackseindruck süß. Leider kann man Süße nicht objektiv mit Instrumenten messen. Dazu benötigt man erfahrene Sensoriker. Mit Hilfe des ursprünglichsten aller Sinne, der Geschmackswahrnehmung, vergleichen diese „Berufsschmecker“ eine definierte Menge Zucker, gelöst in Wasser, mit unterschiedlich konzentrierten Lösungen des zu untersuchenden Süßstoffes. Dies geschieht so lange, bis jene Süßstoffkonzentration gefunden ist, die auf der prüfenden Zunge den gleichen Eindruck von Süße hervorruft wie das Zuckerwasser. Den Geschmackseindruck „süß“ kann man mit nur einer Sorte von Geschmacksrezeptoren empfinden.
Erstaunlicherweise rufen ihn die verschiedensten Substanzen hervor. Rezeptoren sind Eiweißstrukturen, die in großer Zahl in den Hüllen der Sinneszellen auf der Zunge stecken. Einzelne Abschnitte der Gebilde sind als Andockstellen ausgebildet. Diese erkennen bestimmte Stoffe, die an der Zunge vorbeischwimmen, und verbinden sich mit ihnen. Klick – und die Zelle schickt das Signal „süß“ ans Gehirn! Der Rezeptor besitzt eine ganze Palette unterschiedlich gearteter Andockstellen. In eine davon passt unser Haushaltszucker, die Saccharose, während eine andere etwa den künstlichen Süßstoff Aspartam aufnimmt. Je nach Andockstelle scheint die Süßwahrnehmung schwächer oder stärker oder unterschiedlich auszufallen. Jene für den künstlichen Süßstoff Saccharin mag bei Reizüberflutung nicht mehr. Ab einer bestimmten Saccharinkonzentration blockiert sie die Signalleitung ins Gehirn. Dann schmeckt der Süßstoff in hohen Konzentrationen weniger süß als in niedrigen. Die Form der süßen Stoffe bewirkt auch, dass einige unter ihnen eine bittere Note haben. Sie setzen gleichzeitig mit dem Süßrezeptor auch diejenigen Rezeptoren in Gang, die dem Gehirn Bitteres melden: Zwei der rund dreißig Arten von Rezeptoren für Bitterstoffe, die der Mensch besitzt, erkennen Saccharin und Acesulfam-K (ebenfalls ein künstlicher Süßstoff). Isst man zum Beispiel Schokolade, ist man sich nicht bewusst, dass hinter der Identifizierung des Geschmacks als „süß“ ein komplizierter Prozess steht, der bislang nicht eindeutig entschlüsselt ist (zum Vorgang des „Süß“-Schmeckens vgl. Sütterlin 2006).
Entdeckt man eine neue Substanz, so gibt es nur wenige allgemeingültige Regeln für die physikalischen und chemischen Eigenschaften, die sie besitzen muss, damit sie eine bestimmte Qualität hat, d.h. einen bestimmten Geschmack auslöst. Eigentlich weiß man nur, dass der Stoff wasserlöslich sein muss – dann scheiden sich bereits die Geister.
Nicht nur Zucker löst den Geschmackseindruck süß aus. Auch einige Zuckerabkömmlinge, kleine oder große Eiweiße, Blei- und Berylliumsalze, große, komplex gebaute pflanzliche Zuckerersatzstoffe und Alkohole führen zur Sinnesempfindung „süß“. Süß schmeckende Eiweiße sind sehr zahlreich. Künstliche Süßstoffe bestehen zum Teil daraus, aber auch in der Natur kommen sehr viele vor. Der äußerst intensive süße Geschmack entsteht vermutlich dadurch, dass sich diese Eiweißstrukturen sehr fest an den Rezeptor für Süßes heften. Man merkt das an dem über Minuten bis Stunden anhaltenden Süßgeschmack. Zucker ist dagegen ein schlechter Signalstoff. Es erfordert um Zehnerpotenzen höhere Mengen, um ihn zu schmecken.
Auch die Größe und die räumliche Struktur beeinflussen den Geschmack nicht sonderlich. Mit anderen Worten: Man kann bisher im Labor nichts konstruieren, von dem man sagen kann, dass es süß schmecken wird – außer man kennt die Substanz bereits und baut sie nach. Auch wenn man in der Natur eine neue Substanz entdeckt, kann man nicht vorhersagen, ob sie aufgrund ihrer Struktur süß schmecken wird oder nicht. Daher sind Süßstoffe – ob natürlich oder künstlich – fast immer Zufallsfunde.
Süßstoffe sind fast immer Zufallsfunde.
Wenn Sie Zucker reduzieren wollen
Das Geschmacksempfinden für süße Speisen kann sich ändern, wenn man bewusst die Reizschwelle senkt. Nach einer Übergangszeit von einigen Tagen ohne Süßungsmittel löst eine gering gesüßte Speise das gleiche intensive Geschmackserlebnis aus wie zuvor eine höhere Süßkonzentration. Letztere wird dann häufig als übersüßt empfunden. Durch diese Maßnahme erreicht man eine deutlich reduzierte Aufnahme von isolierten Zuckern, wodurch der Genuss von Süßem ohne gesundheitliche Nachteile möglich wird.
© Petra Kress/pixelio.de