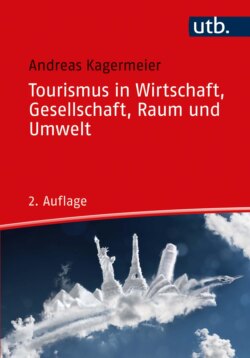Читать книгу Tourismus in Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt - Andreas Kagermeier - Страница 32
2.2.2 Wertewandel in der Phase der Postmoderne
ОглавлениеWertewandel Nachdem die lange Zeit relevanten sozio-demographischen Aspekte zur Analyse und Prognose der Reisemuster an Relevanz verloren haben und auch der Blick auf standardisiert erfasste Motive von Reisenden allein keinen ausreichenden Deutungsgehalt für die konkrete Gestaltung von Urlaubsangeboten besitzt, wird in den Tourismuswissenschaften in jüngerer Zeit verstärkt auf soziologische und sozialpsychologische Ansätze zurückgegriffen, die versuchen, den gesellschaftlichen und sozialen Wandel zu fassen.
Reisen als kulturelle Praxis verstehen bedeutet gleichzeitig auch, dass die gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen in Wechselbeziehungen mit dem konkreten touristischen Handeln stehen. Dementsprechend manifestiert sich der, Ende des 20. Jahrhunderts identifizierte Wechsel von der fordistisch geprägten Moderne hin zur Postmoderne auch im Bereich der Freizeit und des Tourismus. Die PostmodernePostmoderne zeichnet sich durch eine verstärkte Betonung des Diskurses kultureller Praktiken aus (vgl. LANZ 1999, S. 74), wobei Pluralisierung, Fragmentierung und Relationalität zentrale Motive darstellen. Während die Moderne von Metaerzählungen geprägt war, die gesellschaftliche Institutionen, politische Praktiken, Denkweisen und Ideologien legitimierten, geht in der Postmoderne dieser Konsens verloren. Es gibt damit keinen einheitlichen, in sich geschlossenen postmodernen Ansatz, sondern gerade die von Eklektizismus und Individualismus gekennzeichnete Postmoderne zeichnet sich durch eine Montage unterschiedlichster parallel existierender Ansätze aus (genauer bei HARVEY 1989, S 340f. und HELBRECHT 1994, S. 32). Die von HABERMAS (1985) vor dem Hintergrund der Krise des Sozialstaates und der Erschütterung der Sozialutopien des 19. und 20. Jahrhunderts formulierte „Neue Unübersichtlichkeit“ kann als Leitmotiv der Postmoderne angesehen werden. Frühere Ansätze und Leitideen werden teilweise ironisierend als Hommage in Form einer Pastiche aufgenommen und als sich kontinuierlich verändernde Heterotopien (FOUCAULT 2005) verstanden.
Diese gesellschaftliche Fragmentierung und Aufsplitterung als Folge eines Verlustes an gesamtgesellschaftlichen Konsens und dem Bedeutungsverlust von weltanschaulichen Ideologien (bzw. Sozialutopien) gegen Ende des 20. Jahrhunderts spiegelt sich auch in der Heterogenität und Vielfalt von unterschiedlichen Lebensentwürfen. Mit dem Verlust an klaren Orientierungsrastern und Normen verbunden ist die Herausforderung an das Individuum, seine eigene Identität „Jenseits von Stand und Klasse“ (BECK 1994) zu definieren und den gewagten, risikobehafteten Versuch zu unternehmen, im eigenen Erleben glücklich zu werden.
Die „protestantische Arbeitsethik“ (WEBER 2004), die in der Phase des Fordismus mit dem Primat der Orientierung auf das Arbeitsleben als zentralem Lebensinhalt einen wichtigen Leitwert darstellt, hat gegen Ende des 20. Jahrhunderts an Prägekraft verloren. Neue, nichtmaterielle Leitwerte prägen die Gesellschaft im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts. Von den verschiedenen Ansätzen der Kategorisierung der gesellschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden Phasen der touristischen Nachfrageausdifferenzierung ist in Abbildung 22 eine an QUACK (2011) angelehnte dargestellt.
Abb. 22:
Entwicklung der gesellschaftlichen Leitwerte (Quelle: eigener Entwurf, Phase 1 bis 4 nach QUACK 2011)