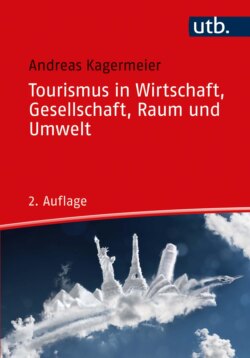Читать книгу Tourismus in Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt - Andreas Kagermeier - Страница 21
Erlebnisorientierung
ОглавлениеErlebnisorientierungIm Zusammenhang mit der nachfrageorientierten Gestaltung von touristischen Angeboten wird in den letzten Jahren dem Besuchererlebnis ein wachsendes Augenmerk gewidmet. Auch wenn retrospektiv seit der Zeit der Vaganten (vgl. Kap. 1.2.1) das persönliche Erlebnis als relevantes Motiv angesehen wird, ist dessen Operationalisierung, Erfassung und genauere Analyse erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts in den Fokus der sozialwissenschaftlichen Analyse gerückt. Dies hängt damit zusammen, dass in den letzten Jahrzehnten (vgl. auch die Ausführungen zu MASLOWS Bedürfnispyramide in diesem Kapitel) die individuelle Selbstverwirklichung und damit auch das individuelle Erlebnis an Bedeutung für die Individuen zugenommen haben.
Die zunehmende Bedeutung des individuellen Erlebnisses wurde von SCHULZE (1992) in seinem Buch über die Erlebnisgesellschaft auf einen Wandel der Lebensauffassungen zurückgeführt. Lange Zeit galt für den Großteil der Gesellschaft eine sog. außenorientierten Lebensauffassung, die in einer klar sozial strukturierten und geschichteten Gesellschaft externe Vorgabe von Zielen und Normen für das Individuum (z. B. Reproduktion der Arbeitskraft, Beschaffung von lebensnotwendigen Ressourcen, Aneignung von Qualifikationen, Altersvorsorge) bedeutete. Diese ist abgelöst worden von einer stärker innenorientierten Lebensauffassung, bei der die Gestaltungsidee eines „schönen, interessanten, subjektiv als lohnend empfundenen Lebens“ (SCHULZE 2005, S. 37) in den Vordergrund trat. Die damit verbundene Betonung des subjektiven Erlebnisses in weiten Teilen der Gesellschaft führt zu einer Ästhetisierung des Alltagslebens und einer Höherbewertung der Selbstverwirklichung.
Die Freizeit- und Erlebniswelten des ausgehenden 20. Jahrhunderts (vgl. z. B. STEINECKE 2000) haben genau diese subjektive Erlebnisorientierung angesprochen, indem Sie dem Individuum ein positives Erlebnis versprachen. Damit war dieses Versprechen von unverwechselbaren, einmaligen Erlebnissen als der zentrale Erfolgsfaktor für den im letzten Kapitel thematisierten Boom der Freizeit- und Erlebniswelten in den 1990er Jahren anzusehen.
KAGELMANN hat die Erfolgsfaktoren der Freizeit- und ErlebnisweltenFreizeit- und Erlebniswelten der 1990er Jahre wie folgt zusammengefasst:
1 die Tatsache, dass die Besucher in eine Kontrastwelt zur Alltagswelt eintauchen können,
2 eine größere Zahl von Erlebnissen auf hohem und verlässlichem Niveau vermittelt werden,
3 immer wieder neue Angebote mit wechselnden Attraktionen und Events geboten werden,
4 die professionelle Organisation auf einen perfekten ungestörten (Konsum-) Genuss ausgerichtet ist,
5 multifunktionale Angebote den multioptionalen Ansprüchen der Nachfrager entsprechen,
6 ein thematisches Leitmotiv, das idealerweise dem Grundprinzip des Storytellings folgt, und ein unverwechselbares Erlebnis verspricht (nach KAGELMANN 1998, S. 79ff.).
Dabei zeigte sich aber, dass der Erfolg von auf oberflächliches Erlebnis ausgerichteten Angeboten oftmals nur kurzfristig war. Ein einmal gemachtes Erlebnis kann bei der Wiederholung als nur noch begrenzt attraktiv empfunden werden. Diesem Abnutzungseffekt wurde lange Zeit über eine Intensivierung bzw. Erneuerung der gebotenen Effekte entgegengewirkt. OPASCHOWSKI (2000) prägte dabei den Begriff der „ErlebnisspiraleErlebnisspirale“, bei der immer ausgefeiltere Angebote nachgefragt werden. Das kontinuierliche „Nachrüsten“ in den Freizeitparks und Konsumwelten der 1990er Jahre kann als Anzeichen dafür angesehen, dass in Teilen des Marktes auch heute noch dem Leitbild des „schneller, höher, weiter“ gefolgt wird.
Auch wenn die 1990er Jahre von einer intensiven Beschäftigung mit den sog. Erlebniswelten geprägt waren, sind bis heute unsere Kenntnisse über die Erlebnisse induzierende und auslösende Aspekte sowie die unterschiedlichen Arten von Erlebnissen relativ überschaubar. Viele Ansätze beziehen sich auf die von PINE & GILMORE identifizierten Dimensionen der Besucheransprache.
PINE & GILMORE (1999) versuchen, bei der von ihnen ausgerufenen sog. „ErlebnisökonomieErlebnisökonomie“ neue Wege zur Ansprache der Kunden zu finden. Bei diesem in sich recht stimmigen und auch intensiv rezipierten Definitionsversuch wird die soziale Dimension der Interaktion nicht aufgeführt. PINE & GILMORE unterscheiden dabei zwei Dimensionen des Erlebnisses, die durch die beiden Achsen Passive-Aktive Teilnahme (Passive-Active Participation) und Aufnahme-Eintauchen (Absorption-Immersion) gekennzeichnet sind (vgl. Abb. 11). Traditionelle touristische Angebote sind stark auf die Aufnahme/Rezeption ausgerichtet. Im Bereich der klassischen Kultur- und Bildungsreise erfolgt diese durch eine aktive Beteiligung, während im Bereich der Freizeitparks eher passive Beteiligung dominiert. Als Zwischenform kann der Edutainment-Ansatz angesehen werden (teils aktiv, teils passiv).
Abb. 11:
Dimensionen der erlebnisorientierten Besucheransprache nach PINE & GILMORE (Quelle: eigene Darstellung nach PINE & GILMORE 1999, S. 32)
Mit den sich abzeichnenden Abnutzungs- und Ermüdungserscheinungen bei den klassischen Angeboten rückt der vierte von PINE & GILMORE formulierte Quadrant zur Generierung von Erlebnissen in den Fokus, der „Escapist“. Dieser zielt auf die aktive Einbeziehung und das Eintauchen in das Erlebnissetting ab. Neben den sportlichen Angeboten, bei denen dieser Aspekt schon immer eine wichtige Rolle spielte, wird nun versucht, die Aufbereitung von kulturellen Angeboten nicht nur durch eine aktive Einbeziehung der Besucher attraktiver zu gestalten, sondern auch auf das Eintauchen in das spezifische Setting ausgerichtete Inszenierungansätze zu verfolgen (genauer z. B. bei ARLETH & KAGERMEIER 2009). Auch GÜNTHER (2006, S. 57) betont die aktive Rolle des Besuchers bei der Aneignung von angebotenen Erlebnis-Settings und propagiert den Rollenwechsel vom Erlebnis-Konsumenten zum Erlebnis-Produzenten.
Eine theoretische Basis für die Rolle der Aktivierung im Zuge von Erlebnis-Settings bietet das Flow-KonzeptFlow-Konzept von CSIKSZENTMIHALYI (1990 & 1991). Als Flow wird ein mentaler Zustand verstanden, in dem die Person vollständig in die Aktivität eintaucht und in einer Tätigkeit aufgeht, die klare Ziele aufweist und dem Individuum eine unmittelbare Rückmeldung vermittelt. Zielsetzung touristischer Erlebnisinszenierungen ist daher oftmals die Erzeugung eines Flow-Gefühls bei den Gästen. Das als positiv empfundene Flow-Erlebnis stellt sich dann ein, wenn die gestellten Anforderungen in Einklang mit den Möglichkeiten des Individuums stehen, d. h. weder Über- noch Unterforderung besteht (vgl. Abb. 12). Traditionelle Urlaubsangebote zielten lange Zeit auf reine Entspannung (= Relaxation) ab. Demgegenüber war Kennzeichen der für das ausgehende 20. Jahrhunderts charakteristischen Freizeit- und Erlebniswelten die Generierung von Erlebnissen, die vor Allem einen kurzzeitigen „Nervenkitzel“ oder „Kick“ (= Arousal) erzeugten.
Unter dem Blickwinkel des Flow-Konzepts (vgl. Abb. 12) bedeutet dies, dass beim typischen Entspannungsurlaub, wie dem Badeurlaub, nur relativ geringe Anforderungen an die Urlauber gestellt werden. Für viele Angebote der „Erlebnis 1.0-Phase“ ist typisch, dass auf den Arousal-Effekt, d. h. Stimuli gesetzt wurde, die das Individuum stark fordern (egal ob mit dem sog. Roller-Coaster-Effekt, überwältigenden Sinneseindrücken in thematisierten Erlebniswelten bis hin zu den großen physischen oder psychischen Herausforderungen bei Extremsportarten). Grundprinzip des Flow-Ansatzes ist eine Ausgewogenheit zwischen den Fähigkeiten des Individuums und den durch die externen Stimuli gegebenen Heraus- und Anforderungen. Nicht Über- und nicht Unterforderung ist damit das Ziel. Weder Langeweile noch extreme Adrenalinkicks scheinen die Erlebnisangebote der 2. Generation zu Beginn des 21. Jahrhundert zu markieren (genauer bei KAGERMEIER 2013).
Abb. 12:
Flow als Ausgewogenheit von Anforderungen und Fähigkeiten (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an CSIKSZENTMIHALYI 1997, S. 31)
Allerdings können Erlebnisse aufgrund ihrer Individualität nicht wirklich produziert werden. Anbieter von touristischen Angeboten können lediglich versuchen, in Form eines spezifischen Settings günstige äußere Rahmenbedingungen zu schaffen. Letztendlich beschränken sich die von der Angebotsseite konzipierten Settings auf eine Kontextsteuerung, welche das Entstehen von Erlebnissen begünstigt und damit „Mood Management“ betreibt. In diesem Sinne stellt die Entsprechung von angebotsseitigen Rahmenbedingungen und den individuellen Erwartungen der Besucher eine Herausforderung dar, welche für den Erfolg von Erlebnisangeboten ausschlaggebend ist.
Zur Konstruktion touristischer Erlebnisse sind bislang kaum empirisch validierte Konzepte vorhanden. Ein – bislang noch nicht vollständig empirisch umgesetzter – umfassender Ansatz zur Erfassung der unterschiedlichen Erlebnisdimensionen im Sinne einer Synthese der vorliegenden konzeptionellen Komponenten zur Entstehung von Vorstellungsbildern über touristische Erlebnisse, der insbesondere der Wirkung erlebnisvermittelnder Settings nachspürt, müsste die in Abbildung 13 dargestellten Dimensionen beinhalten:
1 KognitionskomponenteKognitionskomponente: mit aktiver (Bildungsaspekt) und passiver Rezeption (Entertainmentaspekt)
2 EmotionskomponenteEmotionskomponente: sensorisch oder ästhetisierend induziert
3 Explorative Komponenteexplorative Komponente: kognitiv oder konativ ausgerichtet
4 Soziale Interaktionsoziale Interaktion zwischen Anbietern und Nachfragern bzw. soziales Miteinander unter den Nachfragern.
Die Qualität des Angebotes sowie der Grad der Nichtinszenierung (= Authentizität) bzw. Inszenierung (wobei das oberste Ziel der Inszenierung letztendlich die Generierung einer „Staged Authenticity“ darstellt) beeinflussen als Rahmenbedingungen des Settings die Art und die Ausprägung der jeweiligen Erlebniskomponenten. Diese werden bei der Perzeption durch die subjektive (situative) Disponiertheit und den Erfahrungshintergrund der Nachfrager, ebenso wie die daraus resultierenden Erwartungen und Images quasi „gefiltert“, sodass identische Stimuli und Settings zu individuell unterschiedlichen Erlebnissen führen (vgl. auch Kap. 2.3.2).
Insgesamt gesehen stehen die unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Ansätze zu Annäherung an das Konstrukt „Erlebnis“ aber trotz langjähriger Auseinandersetzung mit dem Phänomen immer noch in einem Stadium des nur sehr partiellen Verständnisses von Erlebnisgenerierung, auch im touristischen Kontext. Hier bestehen noch deutliche Forschungsdefizite.
Abb. 13:
Synopse der zentralen Dimensionen von Erlebnisgenerierung im touristischen Kontext (Quelle: eigener Entwurf)
Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde Tourismus als Phänomen eingeführt, das unterschiedliche Dimensionen berührt und daher von unterschiedlichen Disziplinen, die aktuell unter dem Überbegriff „Tourismuswissenschaften“ zusammengefasst werden, aus einer Vielzahl von Blickwinkeln analysiert wird. Die disziplinübergreifende, transdisziplinäre Herangehensweise ist eines der zentralen Charakteristika in diesem Arbeits- und Forschungsfeld.
Grundparadigma der tourismusgeographischen Herangehensweise ist eine integrative, übergeordnete Perspektive auf das Handeln der Menschen im Raum. Damit stellen die sozialwissenschaftlichen Ansätze zur Analyse und Deutung von menschlichem Handeln sowie das Wechselspiel desselben mit der räumlichen Umwelt die beiden Säulen der Tourismusgeographie dar.
Der Begriff Tourismus beschreibt ein Phänomen, zu dessen Grundcharakteristika Ortsveränderung, zeitliche Befristung und ein breites Spektrum an Zwecken/Motiven gehört. Die Motive für Reisen sind stark subjektiv geprägt und einem steten Wandel unterworfen.
Auch der Freizeitbegriff, verstanden als freie Dispositionszeit ist nicht vollständig intersubjektiv fassbar, sondern ebenfalls stark von subjektiven Perzeptionen der Individuen geprägt.
Die touristische Nachfrage kann als Resultat von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen angesehen werden. Dementsprechend handelt es sich um kein statisches Phänomen. Vielmehr ist die touristische Nachfrage in einem steten Wandel begriffen, sodass die Angebotsgestaltung einem permanenten Adaptions- und Innovationsdruck ausgesetzt ist, um die Nachfrage adäquat zu adressieren.
Für die Analyse der nachfrageseitigen Dispositionen wird auf eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Ansätzen, wie der Bedürfnispyramide von Maslow, dem Lebensstilkonzept zur Zielgruppensegmentierung oder den unterschiedlichen Ansätzen zur Deutung der Erlebnisorientierung zurückgegriffen.
Weiterführende Lesetipps
STEINECKE, Albrecht (2010): Populäre Irrtümer über Reisen und Tourismus. München
Einführung in den Tourismus der etwas anderen Art. Anhand von Stereotypen und Klischees über den Tourismusmarkt und deren Dekonstruktion wird scheinbar nebenbei und mehr indirekt eine Vielzahl an Grundlagen vermittelt. Gleichzeitig steht das Lesevergnügen im Mittelpunkt.
MUNDT, Jörn W. (2014): Thomas Cook – Pionier des Tourismus. Konstanz & München
Nicht nur eine Biographie eines der Pioniere des modernen Tourismus, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit einer Legende, die dann 2019 Insolvenz anmelden musste und von der aktuell nur mehr die Marke erhalten ist und von anderen Investoren weitergeführt wird.