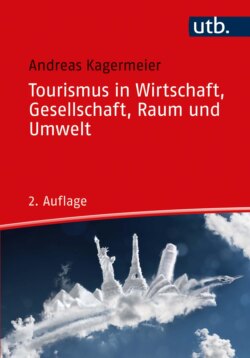Читать книгу Tourismus in Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt - Andreas Kagermeier - Страница 6
1.1 Einordnung, Definitionen und Ansatzpunkte der geographischen Freizeit- und Tourismusforschung 1.1.1 Tourismus als multidimensionales Phänomen
ОглавлениеFreizeit- und TourismusforschungDie Vielzahl der Aspekte, die vom Tourismus berührt werden und von denen die touristische Entwicklung beeinflusst wird, hat FREYER in sechs Dimensionen zusammengefasst (vgl. Abb. 1).
An vorderster Stelle sind dabei sicherlich die wirtschaftlichen Gegebenheitenwirtschaftliche Gegebenheiten zu nennen. Das wirtschaftliche Niveau einer Gesellschaft (und auch die Art der Verteilung der ökonomischen Potentiale) ist eine zentrale Stellgröße für den Umfang und die Ausgabevolumina der touristischen Nachfrage. Aber auch das Niveau der Angebotsqualität und die Möglichkeiten zur Ausdifferenzierung des Angebotes werden von den ökonomischen Möglichkeiten in den Destinationen mit beeinflusst. In den hochindustrialisierten Ländern sind die Möglichkeiten der Aufbereitung von touristischen Potentialen im Allgemeinen deutlich größer als in den sog. Entwicklungsländern (vgl. Kap. 7)Entwicklungsländer. Gleichzeitig wird eine touristische Inwertsetzung – insbesondere in peripheren Räumen – oftmals als Möglichkeit gesehen, volkswirtschaftliche Impulse zu setzen und mangels anderer wirtschaftlicher Aktivitäten durch den Tourismus positive Einkommenseffekte zu generieren.
Abb. 1:
Freizeit und Tourismus als interdependente Phänomene (Quelle: eigene Darstellung nach FREYER 2011a, S. 46)
Die Rahmenbedingungen für Reisemöglichkeiten werden durch das Feld der PolitikPolitik mit beeinflusst. Dies betrifft nicht nur die Frage von Reisebeschränkungen (z. B. durch eine entsprechende Visapolitik), sondern auch die Möglichkeiten zu grenzüberschreitenden Investitionen in Form von ausländischen Direktinvestitionen oder die Vergabe von Fördermitteln (wie z. B. die europäischen Interreg-Fördermittel) bzw. steuerliche Rahmenbedingungen (Mehrwertsteuersatz für touristische Leistungen, Kerosinsteuer) und Abgaben (Luftverkehrsabgabe). Neben den übergeordneten politischen Zielen (z. B. Sicherheitsbedürfnis, Terrorismusabwehr) einer politischen Einheit sind die direkt auf den Tourismus bezogenen Zielsetzungen im Grundsatz einerseits darauf gerichtet, die Rolle des Tourismus als Wirtschaftsfaktor positiv zu begleiten und andererseits negative Auswirkungen des Tourismus zu vermeiden. Tourismuspolitik ist damit oftmals als ambivalent anzusehen.
Der Blick auf das IndividuumIndividuum bedeutet, dass dessen soziale und psychologische Disponiertheit als relevant für Nachfragepräferenzen angesehen wird. Gleichzeitig spielen die subjektiven Aspekte aber auch auf der Angebotsseite eine relevante Rolle, wie etwa die Einstellungen gegenüber übergeordneten Nachhaltigkeitsaspekten oder der Grad der Risikobereitschaft bzw. die Innovationsbereitschaft oder Kreativität bei der Produktentwicklung.
Mit der Dimension RaumRaum wird einerseits der evidente Aspekt berührt, dass Tourismus immer auch mit Bewegungen im Raum verbunden ist, wenn sich Touristen aus den Quellmärkten in die Zielgebiete begeben. Die Frage nach Einzugsbereichen und der Bewältigung der Verkehrsströme sind damit offensichtlich relevant bei der Beschäftigung mit touristischen Phänomenen. Da touristische Angebote aber im Allgemeinen nicht abgelöst von den Destinationen als „Foot Loose Industry“ geschaffen werden, sondern an ganz konkrete räumlich verortete Potentiale gebunden sind, können aus der (intendierten oder realisierten) touristischen Inwertsetzung oder Nutzung auch Raumnutzungskonflikte mit anderen Nutzungsansprüchen (z. B. Landwirtschaft oder Wohnen) resultieren. Die kann die Ressource „Raum“ als Flächeninanspruchnahme genauso betreffen wie z. B. die Konkurrenz um die Ressource „Wasser“ (insbesondere in Gebieten mit prekären hydrologischen Regimen). Im positiven Sinne kann touristische Erschließung aber auch als Faktor der Regionalentwicklung gewünscht sein oder fungieren.
Der Bezug zwischen der ökologischenÖkologie Dimension und dem Tourismus besteht offensichtlich darin, dass die touristische Nutzung immer auch mit der Inanspruchnahme von Ressourcen bis hin zu deren ÜbernutzungÜbernutzung verbunden ist. Die sog. TragfähigkeitsgrenzeTragfähigkeitsgrenze (Carrying Capacity) kann damit auch einen limitierenden Faktor für die touristische Inwertsetzung darstellen. Dies betrifft nicht dabei nicht nur z. B. Trittschäden in sensiblen Ökosystemen oder die negativen Auswirkungen der Erschließung von alpinen Regionen für den Skitourismus. In einem weiteren sozial-ökologischen Sinn kann hierunter auch eine von den Einwohnern als negativ empfundene Konzentration von Touristen im städtischen Raum subsummiert werden (Crowding bzw. Overtourism). Das Verhindern des Überschreitens von physischen oder perzeptionellen Tragfähigkeitsgrenzen bzw. eine möglichst verträgliche Nutzung von natürlichen Ressourcen ist – im Wechselspiel mit der politischen Dimension – eines der Zielsetzungen von nachhaltigenNachhaltigkeit Tourismuskonzepten.
Gleichzeitig kann eine touristische Nutzung aber auch zum Schutz von Ökosystemen beitragen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn in den sog. Entwicklungsländern die touristische Nachfrage nach (Foto-)Safaris dazu führt, dass die lokale Bevölkerung den Wert des Schutzes von Wildtieren indirekt dadurch erkennt, dass diese eine Erwerbsgrundlage darstellen, weil Besuche internationaler Touristen Einkommen generieren. Aber auch die Kulturlandschaft mit traditionellen ökologisch angepassten landwirtschaftlichen Praktiken (Streuobstwiesen, Wacholderheiden oder bestimmte andere Sukzessionsstadien) wird teilweise aufgrund der touristischen Nachfrage geschützt, da diese einen Attraktivitätsfaktor z. B. für den Wandertouristen darstellt.
Dass die Normen einer GesellschaftGesellschaft die Wertigkeit von Freizeit im Verhältnis zur Arbeitsethik mit beeinflussen, ist ebenfalls offensichtlich. Die Bezeichnung Deutschland als „kollektiver Freizeitpark“ durch den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl bei seiner Regierungserklärung am 21. Oktober 1993 ist zum geflügelten Wort dafür geworden, dass aus seiner Sicht der Stellenwert der Freizeit in der Gesellschaft zu hoch sei und der Stellenwert der Erwerbsarbeit wieder gesteigert werden sollte. Fragen der Work-Life-Balance und der Stellenwert von freier Zeit schlagen sich nicht nur in konkreten Tarifvereinbarungen nieder, sondern beeinflussen auch den Umfang und die Art der Freizeitgestaltung. Gleichzeitig ist die gesellschaftspolitische Diskussion, welchen Stellenwert wir dem Schutz der natürlichen Umwelt oder Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit zumessen, auch eine relevante Größe. Aber auch die Frage, wie eine Gesellschaft mit dem (materiellen und immateriellen) kulturellen Erbe umgeht, kann durch die touristische Nutzung beeinflusst werden, sei es dadurch, dass materielles kulturelles Erbe (auch) aufgrund der touristischen Nachfrage erhalten oder restauriert wird, oder dass bestimmte Praktiken und Riten wegen ihrer Anziehungskraft auf Touristen gepflegt werden. Umgekehrt kann die touristische Nachfrage durch die Kommerzialisierung und Folklorisierung von gesellschaftlichen Praktiken aber auch zu deren Degradierung und Kommodifizierung beitragen. Gleiches gilt auch für soziale Normen und Verhaltensweisen. Insbesondere im Kontext des sog. „Entwicklungsländertourismus“ wird die Frage nach den negativen Auswirkungen der touristischen Erschließung auf traditionelle Normensysteme intensiv diskutiert.
Insgesamt gesehen handelt es sich beim Phänomen Tourismus um eine gesellschaftliche Praxis, die eine Vielzahl von Wechselbeziehungen mit unterschiedlichsten Feldern aufweist (die untereinander ebenfalls in Bezug stehen). Dementsprechend verwundert es nicht, dass sich eine Vielzahl unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Das Spektrum reicht dabei von Wirtschaftswissenschaften (mit dem betriebswirtschaftlichen und dem volkswirtschaftlichen Blickwinkel), der Soziologie und den Politikwissenschaften über die Pädagogik und Psychologie, die Ethnologie bzw. Kulturanthropologie bis hin zu Jura, Kunstgeschichte, Umweltwissenschaften und der Mobilitätsforschung. Dabei bringt jede (Mutter-)Disziplin ihre spezifischen Blickwinkel und Ansätze in die jeweilige Freizeitpädagogik oder Tourismussoziologie mit ein. Gleichzeitig stehen die unterschiedlichen Teildisziplinen in einem intensiven Wechselspiel und Austausch. Tourismus wird von einem Tourismussoziologen eben nicht nur aus rein soziologischer Sicht betrachtet und analysiert, sondern der tourismussoziologische Blickwinkel steht im Wechselspiel mit den spezifischen Analyseansätzen von Freizeitpädagogen, Tourismuspsychologen oder eben auch Tourismusgeographen. In der Tourismusforschung verschwimmen die traditionellen Disziplingrenzen, sodass von einem transdisziplinären Feld gesprochen werden kann. Ob sich aus diesem Konglomerat unterschiedlicher disziplinärer Ansätze der „Mutter-Disziplinen“, der aktuell mit dem Terminus „TourismuswissenschaftenTourismuswissenschaften“ beschrieben wird, mittelfristig eine eigenständige Disziplin, die Tourismuswissenschaft entwickeln oder ob das Phänomen Tourismus auch längerfristig als Gegenstand aus den „Mutter-Disziplinen“ heraus behandelt wird, ist eine offene Frage.