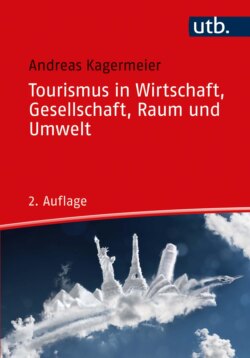Читать книгу Tourismus in Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt - Andreas Kagermeier - Страница 12
1.2.1 Historische Entwicklungslinien
ОглавлениеZiel dieses Abschnitts kann es nicht sein, eine Geschichte des Tourismus zu ersetzen. Hierzu sei der Leser z. B. auf das Grundlagenwerk von SPODE aus dem Jahr 1987 verwiesen. Anhand einiger weniger ausgewählter Blitzlichter sollen einerseits Grundprinzipien der Entwicklung dieses Phänomens beleuchtet und andererseits gleichzeitig ein Verständnis für das Nachwirken von historischen Grundlagen in heutigen Entwicklungen geweckt werden.
Freie, selbstbestimmte DispositionszeitDispositionszeit setzt voraus, dass das Individuum nicht nur mit der eigenen Subsistenz, d. h. der Sicherung des Lebensunterhaltes beschäftigt ist. Damit ist die Verfügbarkeit von freier Zeit auch mit der Entwicklung einer arbeitsteiligen, ausdifferenzierten Gesellschaft verbunden, bei der nicht wie auf der Entwicklungsstufe der Jäger und Sammler oder einer reinen Agrargesellschaft durch ein wirtschaftliches Produktionssystem Überschüsse erwirtschaftet werden, die es einem Teil der Gesellschaft ermöglichen, anderen Tätigkeiten nachzugehen. Damit wird der Beginn des Tourismus oftmals auf die (städtischen) Hochkulturen der griechischen und römischen Antike datiert, bei denen Reisen aus religiösen oder spirituellen Gründen und Motiven (z. B. Orakel von Delphi), aber auch zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit (z. B. Bäderkuren) dokumentiert sind. Bereits hier zeigt sich das enge Wechselspiel zwischen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung mit dem Phänomen Tourismus.
Im Mittelalter sind es wiederum gesellschaftliche Rahmenbedingungen und auch bereits biographische Gegebenheiten, bei der die sog. VagantenVaganten das Bild des Tourismus prägten. Zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert führte die Überproduktion von Theologen dazu, dass diese nicht alle sofort in Pfarrstellen unterkommen konnten. Demensprechend wurde das Studium – oder wie wir heute sagen würden, eine verlängerte Postadoleszenz – dazu genutzt, Studium und Wanderleben im mittelalterlichen Hochschulwesen zu verbinden. Bereits damals entstand der Nexus von Bildung und Reisen, aber auch die auf den persönlichen Genuss ausgerichtete – und bis heute wirksame – Konnotation von Tourismus.
Box 3 | Zeit der fahrenden Schüler Zeit der fahrenden Schüler
„Das subjektive Reiseerlebnissubjektives Reiseerlebnis wird zu einem Kennzeichen der beginnenden Neuzeit. Auf Reisen erlebt das eigene Ich seine Befreiung. Sesshaftigkeit und Stillstand werden verachtet, die Reiselust wird Teil einer neu erwachenden Lebenslust, die die sozialen und geistigen Fesseln des Mittelalters für immer sprengt“ (OPASCHOWSKI 2002, S. 31).
In der beginnenden Zeit der Renaissance, die nicht nur von der Wiederentdeckung antiker Vorbilder, sondern auch von humanistischen und auf das Individuum ausgerichteten Denkhaltungen geprägt ist, bestieg der italienische Dichter Francesco PETRARCA im April 1336 einer der westlichen Ausläufer der französischen Alpen, den über dem Rhonetal aufsteigenden Mont Ventoux: „Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht zu Unrecht Ventosus, ‚den Windigen‘, nennt, habe ich am heutigen Tag bestiegen, allein vom Drang beseelt, diesen außergewöhnlich hohen Ort zu sehen“ (PETRARCA 2014, S. 6). Damit wird Reisen dokumentiert, das keinen außerhalb des Individuums liegenden Zweck oder Sachzwang (wie z. B. die Geschäftsreisen der Kaufleute) kennt, sondern allein dem individuellen Erlebnis verpflichtet ist. Gleichzeitig gilt Petrarca mit der auf das Naturerlebnis ausgerichteten Besteigung des Mont Ventoux als Vorläufer des modernen Alpinismus.
Ebenfalls bis heute Nachwirkungen hat die sog. „Grand TourGrand Tour“, als die Reisen von jungen Adeligen im 16. und 17. Jahrhundert bezeichnet wurden. Als Teil des adeligen Erziehungsprogramms, in Begleitung eines Mentors (quasi eine Art Vorläufer von modernen Reiseleitern) durchgeführt, war es das Ziel, vor der Übernahme der Positionen des Erwachsenenlebens auf diese vorzubereiten, dabei auch gesellschaftliche Kontakte zu pflegen, durch das Kennenlernen von Praktiken an anderen Adelshöfen den Horizont zu erweitern und sich weiter zu bilden. In den heutigen Kultur- und Bildungsreisen lassen sich viele dieser Motive noch immer identifizieren. Dabei wurde aber auch – wie bereits bei den Vaganten und bis heute nachwirkend – das Recht auf Lebensgenuss mit verbunden. Dabei bildeten sich für die Grand Tour (mit den wichtigen europäischen Residenzen als Ankerpunkten) klare Hauptreiserouten heraus, die – auf der Suche nach den materiellen kulturellen Relikten der Antike – vor allem in die mittelitalienischen Städte führte (genauer bei FREYER 2011a, S. 11f.).
Anhand des Weiterwirkens der Grand Tour wird ein Grundprinzip des modernen Tourismus deutlich: Die Ausbreitung einer kulturellen Praxis von Innovatoren und deren Adaption durch breitere Gruppen. Das Zeitalter der Aufklärung ist vom Streben nach Selbständigkeit, dem Aufstiegswillen des Bürgertums einem Fortschrittsoptimismus gekennzeichnet, bei dem Bildung als Auseinandersetzung mit der Umwelt verstanden wurde. Gleichzeitig markiert die Französische Revolution (1789) den Beginn des Sturzes des, bis dahin dominierenden Feudalsystems und das Erstarken des Bürgertums. Die „Italienische Reise“ oder der Entwicklungsroman Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre von Goethe stehen stellvertretend für die Adaption der Reiseziele der adeligen Grand Tour durch das gehobene Bürgertum. Bis heute wird – verkürzt ausgedrückt durch den Slogan „Reisen bildet“ – Reisen als Mittel der Erziehung und Charakterbildung angesehen. Und bis heute begeben sich alljährlich Millionen bewusst oder unbewusst „auf die Spuren Goethes“, wenn Sie die materiellen Relikte der Antike im Mittelmeer – sei es auf einer organisierten oder individuellen „Studienreise“, als Ergänzung zu einem Badeurlaub, im Rahmen eines Wochenend-Städtereisen-Trip oder am Rande einer Konferenzreise – aufsuchen.
Gleichzeitig wird mit der Innovationsdiffusion bei den Kulturreisen deutlich, dass im 19. Jahrhundert das lange Zeit auf Adelige beschränkte Privileg, Reisen zu können, auf breitere Bevölkerungsgruppen ausgedehnt worden ist. Mit dem Erstarken der Arbeiterbewegung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wird auch das „Recht auf Urlaub“ nicht mehr nur als Privileg von kleineren Teilen der Gesellschaft, sondern als Recht für Jedermann angesehen und wurde im 20. Jahrhundert auch in den Tarifauseinandersetzungen über tägliche Arbeitszeit und Urlaubstage entsprechend vertreten bzw. durchgesetzt.
Box 4 | Das Recht auf Urlaub Recht auf Urlaub : Chemnitzer Handelskammer 1906
„Es geht viel zu weit, einen Erholungsurlaub für Leute einzuführen, die nur körperlich tätig sind und unter die Gesundheit nicht schädigenden Verhältnissen arbeiten.
Für Beamte, die geistig tätig sind (und häufig Überstunden arbeiten müssen; die auch keine körperliche Ausarbeitung bei ihrer Tätigkeit haben) erscheint die Erteilung von Erholungsurlaub gerechtfertigt.
Für Arbeiter ist ein solcher Urlaub in der Regel nicht erforderlich. Die Beschäftigung dieser Person ist eine gesunde“ (aus: SPODE 1987, S. 21).
Die mit der verstärkten Nachfrage nach einzelnen Tourismusformen oder auch Destinationen verbundene Banalisierung führt als Push-Faktor oftmals dazu, dass privilegierte Gruppen oder Innovatoren (ähnlich wie beim Verschieben der Pioniergrenze im Zuge der europäischen Besiedelung in Nordamerika) auf neue Produkte oder Reiseziele ausweichen. Parallel zur Aneignung der Kulturreisen im 19. Jahrhundert durch das gehobene Bürgertum erfolgte die Entdeckung von Badereisen durch den Adel. Um exklusiv und „unter Seinesgleichen“ zu sein, wurden einerseits im Binnenland Kurorte entwickelt und frequentiert. Andererseits entstanden an den Küsten (von der englischen Südküste bis zur Ostseeküste) Badeorte (wie z. B. die sog. „Kaiserbäder“ auf Usedom). Auch hier waren die zentralen Motive sowohl gesundheitliche Aspekte (als Vorläufer des heutigen Wellness-Tourismus; vgl. Kap. 6.5) und Geselligkeit sowie des repräsentativen Konsums (soziale Motive, die ebenfalls bis heute nachwirken). Die Kurorte fungierten als Bühnen des Adels und in der Nachfolge des (gehobenen) Bürgertums, bis sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu von den Sozialkassen finanzierten Kurorten für „Jedermann“ wurden.
Die Erweiterung der Reisemöglichkeiten für breitere Bevölkerungsgruppen in der zweiten Hälfte des 19. und dem 20. Jahrhundert wurde neben den gesellschaftlichen Entwicklungen auch von der technischen Entwicklung mit erleichtert. Mit der Erfindung der Eisenbahn, des Pkws und des Flugzeugs wurde Reisen nicht nur leichter und weniger zeitaufwändig, sondern auch erschwinglicher. Der durch den technischen Fortschritt im Zuge der industriellen Revolution mögliche Ausbau der Kapazitäten ging einher mit einer Verteilung des Wohlstands auf breitere Bevölkerungsgruppen. Das Wechselspiel von technischer Entwicklung und wirtschaftspolitischen Veränderungen führte dazu, dass Urlaub in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich vom Privileg kleinerer Gruppen zu einer sozialen Praxis des größten Teils der Bevölkerung in den hochindustrialisierten Ländern gewandelt hat.
Mit der Ausweitung des Volumens einher ging auch ein Wandel der Organisationsformen. Als Begründer der modernen Pauschalreise gilt – auch wenn MUNDT (2014) aufgezeigt hat, dass dessen Rolle ggf. etwas überinterpretiert wird – bis heute oftmals Thomas CookCook, Thomas. Ursprünglich ein britischer Baptistenprediger organisierte er 1841 eine Eisenbahnreise von Leicester nach Loughborough, bei der auch Verpflegung enthalten war. Ziel der Reise war die Teilnahme an einer Abstinenzlerveranstaltung. Auch wenn es sich bei dieser ersten Fahrt also um kein klassisches touristisches Motiv handelt und das Ziel des Veranstalters auch nicht im Gewinnerzielen lag, wird bis heute in den Tourismuswissenschaften als eine Art Mythos diese Fahrt als der Beginn der Pauschalreise angesehen. Diese Interpretation ist sicherlich davon geprägt, dass von Thomas Cook in der Folge ein – 2019 in die Insolvenz gegangenes – Reiseunternehmen gegründet wurde, das als Innovator im Bereich der Pauschalreisen gilt. Es bot Reisen aufs europäische Festland, in die USA oder nach Ägypten bis hin zu einer Weltreise als Komplettpaket für relativ günstige Preise an – ein Image, das der den Namen bis heute weiterführende Reisekonzern immer noch pflegt (vgl. Kap. 3.1.1).
Als ein Beispiel für den Ansatz, das Privileg von Urlaubsreisen – zumindest in der offiziellen Propaganda – auch für weitere Kreise der Arbeiterschaft zu öffnen, soll die NS-Organisation „Kraft durch FreudeKraft durch Freude (KdF)“ (KdF) genannt werden.
Mit dem Ziel der Bindung der „Volksgemeinschaft“ an das NS-Regime wurde nicht nur der KdF-Wagen als Pkw für breite Schichten der Bevölkerung proklamiert (der dann während des 2. Weltkrieges als Kübelwagen an unterschiedlichsten Kriegsschauplätzen eingesetzt wurde und nach dem Weltkrieg als VW Käfer seinen Beitrag zu einer breiten Motorisierung der Bevölkerung leistete), sondern von KdF auch Ferienreisen organisiert. Neben dem Bau von Kreuzfahrtschiffen (unter anderem der „Wilhelm Gustloff“, die dann während des 2. Weltkriegs als Lazarettschiff eingesetzt und 1945 während der Evakuierung Ostpreußens versenkt wurde) wurde auf Rügen zwischen Binz und Sassnitz mit dem Bau des Seebades Prora begonnen. Mit der geplanten Kapazität von 20.000 Betten und der kompakten Bauweise entlang der Strandlinie kann das Tourismus-Resort Prora bis zu einem gewissen Grad als Vorläufer der späteren Erschließung der italienischen und spanischen Mittelmeerküste angesehen werden. Gleichzeitig ist KdF ein extremes Beispiel für die ideologische Instrumentalisierung des Tourismus.
Box 5 | Kraft durch Freude (KdF) als Wegbereiter des Massentourismus Massentourismus und die politische Instrumentalisierung des Tourismus politische Instrumentalisierung des Tourismus
Ideologische Zielsetzung der NS-Organisation
„Alles das, was wir tun, dieses Kraft durch Freude, alles, alles, alles dient nur dem einen, unser Volk stark zu machen, damit wir diese brennendste Frage, dass wir zu wenig Land haben, lösen können. Wir fahren nicht in die Welt hinaus zum Spaße, ich habe nicht einen Reiseverein gegründet, das lehne ich ab (…) nein, damit sie Nerven bekommen, damit sie Kraft haben, dass, wenn der Führer einmal diese letzte Frage lösen wird, dann 80 Millionen in höchster Kraft hintreten vor ihn“ (Robert Ley, der Leiter der NS-Organisation „Deutsche Arbeitsfront“ (DAF) auf einem KdF-Schiff im Sommer 1938).
Seebad Prora auch als verdeckte Kriegsvorbereitung
„Die Idee des Seebades ist vom Führer selbst. Er sagte mir eines Tages, dass man nach seiner Meinung ein Riesenseebad bauen müsse, das Gewaltigste und Größte von allem bisher Dagewesenen … Es ist der Wunsch des Führers, dass in der Mitte ein großes Festhaus entsteht … Der Führer gab gleichzeitig an, dass das Bad 20.000 Betten haben müsse. Alles soll so eingerichtet sein, dass man das Ganze im Falle eines Krieges auch als Lazarett verwenden kann“ (Robert Ley 1935).
Textquelle: Dokumentationszentrum Prora (2010, Mappe C, Q68)
Während dem sog. „Kalten Kriegs“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der vom Wettstreit zwischen dem kapitalistischen und dem sozialistischen System geprägt war, wurden Reisen auch als Erfolgsindikator für die Überlegenheit der jeweiligen Systeme mit angesehen und insbesondere in den sozialistischen Ländern bewusst auch als Instrument zur Belohnung systemtreuer Personen eingesetzt.