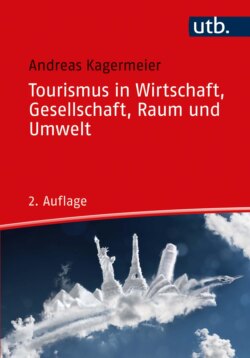Читать книгу Tourismus in Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt - Andreas Kagermeier - Страница 7
1.1.2 Einordnung der tourismusgeographischen Herangehensweise
ОглавлениеDie geographische Herangehensweise ist geprägt von der Orientierung auf das Wechselspiel von menschlichem Handeln und der räumlichen Umwelt. Je nachdem welche der beiden geographischen Hauptrichtungen, die Humangeographie oder die Physischen Geographie im Mittelpunkt stehen, ist der Fokus mehr auf die Analyse der naturräumlichen Gegebenheiten oder Prozesse (Physische Geographie) oder das Handeln des Menschen im Raum (Humangeographie) ausgerichtet. Auch wenn tourismusgeographische Aspekte mit einem physisch-geographischen Analyseansatz behandelt werden (insbesondere die Umweltwirklungen von touristischen Phänomenen wie z. B. die Erosion von Skipisten oder die Analyse der klimarelevanten tourismusbedingten Emissionen), liegen die Wurzeln der tourismusgeographischen Beschäftigung stärker im Bereich der Humangeographie (bzw. der Wirtschafts- und Sozialgeographie). Das Handeln des Menschen im Raum steht damit im Mittelpunkt. Motive und Hintergründe für menschliches Handeln, deren Differenzierung aber auch Beeinflussung sind damit genauso Gegenstand der Tourismusgeographie wie die Analyse der räumlichen Effekte dieses Handeln und eine dem Nachhaltigkeitsparadigma verpflichtete Gestaltung.
Charakteristikum der tourismusgeographischen Herangehensweise ist es damit, touristische Phänomene nicht nur isoliert aus dem Blickwinkel z. B. einer betriebswirtschaftlichen Optimierung oder einer sozialpsychologischen Deutung zu sehen. Vielmehr wird eine stärker integrative, übergreifende Perspektive angestrebt, die – auch in intensivem Austausch und mit Bezug auf die anderen „Tourismuswissenschaften“ – das Phänomen Tourismus stärker holistisch versteht. Gleichzeitig versteht sich Tourismusgeographie in weiten Teilen als anwendungsorientiert und gestaltungsbezogen. Nicht nur die in theoretisch-konzeptionellen Ansätzen wissenschaftlich fundierte Analyse, sondern auch der Anspruch, zur Lösung von Herausforderungen und der Optimierung von Gestaltungsansätzen beizutragen zeichnet tourismusgeographisches Arbeiten vielfach aus.
Box 1 | Von der Fremdenverkehrsgeographie Fremdenverkehrsgeographie zur Tourismusgeographie Tourismusgeographie
Die Tourismusgeographie ist keine statische wissenschaftliche Teildisziplin. Wie alle Wissenschaften hat sie im 20. Jahrhundert eine Reihe von Paradigmenwechseln erfahren, die einerseits den übergeordneten wissenschaftlichen und politischen Kontext spiegeln und andererseits von den Wandlungen in der (Human-)Geographie beeinflusst sind. Auch wenn es bereits frühere Ansätze zur Beschreibung des „Fremdenverkehrs“ – wie das heute als Tourismus beschriebene Phänomen bis in die 1980er Jahre im deutschsprachigen Raum oftmals genannt worden ist – gegeben hat, gilt die Arbeit von POSER aus dem Jahr 1939 als für die weitere Entwicklung der konzeptionellen Ansätze prägend. In seinem Werk „Geographische Studie über den Fremdenverkehr im Riesengebirge“ stehen – in der Tradition der damaligen Geographie – die physiognomisch wahrnehmbaren Veränderungen und Überprägungen in der Kulturlandschaft im Mittelpunkt. Die Fremdenverkehrsgeographie zielte auf die Beschreibung der als Fremdenverkehrslandschaften bezeichneten Zielgebiete ab und fokussierte damit vor allem auf die räumlichen Auswirkungen.
Die Weiterentwicklung zur „Geographie der Freizeit und des FremdenverkehrsGeographie der Freizeit und des Fremdenverkehrs“ wurde in den 1960er und 1970er Jahren geprägt von der „Münchner Schule der Sozialgeographie“ (vgl. RUPPERT 1962, MAIER 1970 oder RUPPERT & MAIER 1970). Deren Zielsetzung wird von KULINAT & STEINECKE rückblickend beschrieben als: „Analyse und Erklärung von Raumstrukturen …, die im Bereich des Freizeit- und Fremdenverkehrs durch sozialräumliche Verhaltensweisen und Umweltbewertungen, durch Standortbildung und (natur‑)geographische Standortfaktoren, durch Wirkungen der Freizeit- und Standortbildung sowie durch planerische Steuerung entstanden sind“ (1984, S. 4). Damit rückt das Individuum als aktiver Faktor im Wechselspiel mit der Umwelt stärker in den Mittelpunkt und gleichzeitig wird die zielorientierte planerische Gestaltung des Raumes explizit thematisiert.
In den späten 1980er Jahren setzt sich die Bezeichnung als „Geographie der Freizeit und des Tourismus“ oder „Freizeit- und Tourismusgeographie“ durch. Die Ersetzung des Begriffes „Fremdenverkehr“ durch den des „Tourismus“ signalisiert dabei nicht nur einen simplen Begriffswechsel zu dem international gebräuchlichen Terminus, der auch in anderen Kontexten vollzogen worden ist (so hat sich der ehemalige Deutsche Fremdenverkehrsverband als Bundesverband der regionalen Tourismusorganisationen 1999 in Deutscher Tourismusverband umbenannt). Vielmehr ist damit – wie auch in anderen Bereichen der Humangeographie – der Wandel von einer stärker deskriptiven Herangehensweise an räumliche Phänomene zu einer analytisch-erklärenden Zielsetzung, bei der die handelnden Individuen und Systeme in ihrem Wechselspiel mit der Umwelt im Mittelpunkt stehen, verbunden.
In diesem Band werden, dem weiten Verständnis von Tourismus (nicht nur auf mit Übernachtungen verbundene Aktivitäten) folgend (vgl. 1.1.3), die beiden Begriffe „Freizeit- und Tourismusgeographie“ sowie „Tourismusgeographie“ synonym verwendet.