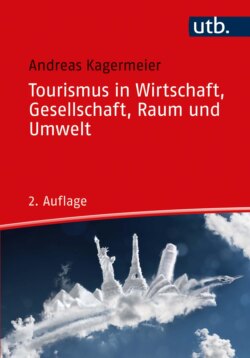Читать книгу Tourismus in Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt - Andreas Kagermeier - Страница 15
Theorie der Zentralen Orte von Christaller
ОглавлениеTheorie der Zentralen OrteDieZentrale Orte (Theorie) ursprüngliche Zielsetzung der Arbeit von Walter CHRISTALLER (1933/1968) war, eine systematische Erklärung für die unterschiedlichen Größen von Städten zu finden. Als zentrale Schlüsselgröße identifizierte er die Verteilung von Dienstleistungen. Für die Nachfrage nach Dienstleistungen sah er den Raumüberwindungsaufwand (aufgefasst als Zeit-Kosten-Mühe-Relation) als zentrale Größe an. Je weiter entfernt ein Angebot von den potentiellen Nachfragern ist, desto weniger häufig wird dieses nachgefragt (vgl. Abb. 4).
Abb. 4:
Idealschema einer NachfragekurveNachfragekurve (Quelle: eigener Entwurf)
Die Bereitschaft zur Raumüberwindung hängt dabei auch von der Wertigkeit der nachgefragten Dienstleistungen ab. Für eine des Öfteren nachgefragte Leistung, wie z. B. den Besuch eines Freibades oder eine Wanderung am Wochenende ist die Distanzüberwindungsbereitschaft geringer als z. B. für den Besuch einer Wellness-Therme oder eine mehrwöchige Trekking-Tour. Gleichzeitig gibt es Dienstleitungen, die von breiten Teilen einer Bevölkerung nachgefragt werden (z. B. Kinovorführung), und solche, die nur von Wenigen nachgefragt werden (z. B. Ballettaufführung). Grundprämisse von CHRISTALLER ist, dass sich Angebote so im Raum verteilen, dass möglichst wenig Konkurrenz besteht. Aus der Nachfragekurve (vgl. Abb. 4) ergeben sich kreisförmige Einzugsbereiche. Damit keine unterversorgten Gebiete von nebeneinander liegenden kreisförmigen Einzugsbereichen zurückbleiben, wird von CHRISTALLER ein hexagonales Wabenschema als sowohl Anbieter als auch Nachfrager zufrieden stellendes Verteilungsmuster von Einzugsbereichen entwickelt (vgl. Abb. 5).
Abb. 5:
Idealschema des Systems der Zentralen Orte (Quelle: eigener Entwurf nach CHRISTALLER 1968)
Unmittelbar einsichtig ist bei diesem Konzept auch, dass die technische Entwicklung von Verkehrsmitteln und deren Verfügbarkeit einen direkten Einfluss auf die Nachfrageorientierung besitzt. Jede technische Innovation, von der Eisenbahn über den privaten Pkw bis hin zum Flugzeug hat die Reichweite für Freizeitaktivitäten erhöht. Mit der weiten Verbreitung von privaten Pkws wurden die Aktionsradien genauso erweitert wie durch die Preisreduzierungen im Luftverkehr durch die sog. Low Cost Carrier (vgl. Kap. 3.1.3) in den 1990er Jahren. Der Einzugsbereich eines (freizeit-)touristischen Angebots ist damit keine feste kilometrische Größe sondern hängt auch von der für die Raumüberwindung aufzuwendenden Zeit, der damit verbundenen Mühe und den aufzubringenden Kosten ab. Als Faustformel wird z. B. bei Angeboten für Tagesausflüge davon ausgegangen, dass das Einzugsgebiet sich auf den Quellraum erstreckt, von dem aus das Angebot (z. B. ein Freizeitpark) innerhalb von zwei Stunden zu erreichen ist. Während vor der Verfügbarkeit von motorisierten Verkehrsmitteln für einen Tagesausflug nur wenige Kilometer zurückgelegt worden sind, ist es mit den Low Cost Carriern prinzipiell möglich für einen Tagesausflug auch nach Mallorca oder in eine der europäischen Metropolen zu fliegen.
Das ursprünglich als reines Analysekonzept entwickelte Zentrale Orte-Schema wurde seit den 1970er Jahren dann auch normativ gewendet und intensiv in der räumlichen Planung eingesetzt. Insbesondere im Bereich der Freizeitstättenplanung wurde von der öffentlichen Hand das Prinzip der Daseinsvorsorge auf den Grundlagen von Christaller umgesetzt. Aber auch bei privatwirtschaftlichen Investitionen (z. B. in Musical-Theater) wird auf die Überlegungen zu den Einzugsbereichen und der Mitbewerberanalyse zurückgegriffen.