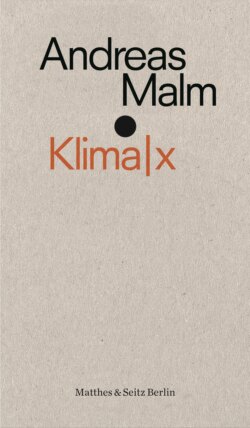Читать книгу Klima|x - Andreas Malm - Страница 4
I. Corona und Klima
ОглавлениеDie dritte Dekade des Jahrtausends begann mit der Unterzeichnung eines weiteren historischen Konjunkturpakets zur Förderung der dystopischen Vorstellungskraft. Buschfeuer fegten über Australien hinweg, äscherten ein Gebiet ein, das größer war als Österreich und Ungarn zusammengenommen, ließen Flammen 70 Meter in den Himmel aufschießen, verbrannten 34 Menschen und mehr als eine Milliarde Tiere, entsandten Rauchfahnen über den Pazifischen Ozean bis nach Argentinien und färbten den Schnee über den neuseeländischen Bergen braun, als ein Virus auf einem Lebensmittelmarkt in der chinesischen Stadt Wuhan ausbrach. Auf dem Markt wurden in der Wildnis gefangene Tiere verkauft. Es gab Wolfswelpen im Angebot, Bambusratten, Singzikaden, Stachelschweine, aber auch Eichhörnchen, Füchse, Zibetkatzen, Schildkröten, Salamander, Krokodile und Schlangen. Als Quelle des Virus nannten erste Studien jedoch Fledermäuse. Von diesem Wirt sei das Virus auf eine andere Spezies übergegangen – Schuppentiere galten als Hauptverdächtige – und dadurch auf den Markt von Wuhan gelangt, wo ihm der Sprung auf einige der an den Geschäften entlang Flanierenden gelungen sei. Schon bald suchten Patient*innen scharenweise die Krankenhäuser auf. Einer der ersten, ein abgesehen davon vollkommen gesunder 41-jähriger Mann, der auf dem Markt arbeitete, hütete eine Woche lang mit Fieber, Engegefühl in der Brust, trockenem Husten und anderweitigen Beschwerden das Bett, bevor er hastig auf die Intensivstation gebracht wurde. Zufälligerweise stiegen während dieser Woche auch die Temperaturen in den betroffenen australischen Bundesstaaten auf über 40 Grad Celsius.
Kurz danach breitete sich das Virus wie ein elektromagnetischer Impuls über die ganze Welt aus. Anfang Februar 2020 starben täglich rund 50 Menschen, meist an akuter Atemnot und -versagen; Anfang März lag die Zahl der Opfer weltweit bei 70 Menschen pro Tag; Anfang April, bei mittlerweile 5000 Toten täglich, stand die exponentielle Wachstumskurve beinahe senkrecht. Mit mindestens einem Infektionsfall in 182 von 202 Ländern hatte der tödliche Impuls jeden Ozean überquert und fegte von Belgien bis Ecuador durch die Straßen. Zur gleichen Zeit überzogen Heuschreckenschwärme – größer und dichter als je zuvor erinnert oder aufgezeichnet – Ostafrika und Westasien, bedeckten das Land, fraßen Pflanzen und Früchte und ließen kaum einen Flecken Grün zurück. Vergeblich versuchten die Bauern, sie von den Feldern zu vertreiben. Heuschreckenwolken verdunkelten den Himmel, und ihre Körper türmten sich in rauen Mengen auf, sobald die Insekten tot zu Boden fielen, dicht genug, dass selbst Züge vor ihnen haltmachen mussten. Ein einzelner lebender Schwarm in Kenia umfasste ein dreimal so großes Gebiet wie New York City; ein üblicheres Aufgebot bestünde aus einem Vierundzwanzigstel dieser Größe, das, bis zu acht Milliarden Lebewesen umfassend, immer noch in der Lage wäre, die gleiche Menge zu verschlingen wie vier Millionen Menschen an einem Tag. Unter normalen Bedingungen kommt es nur äußerst selten zu solch riesigen Schwärmen. Ginge es nach ihr selbst, würde die Heuschrecke an ihrem solitären Lebensstil in der Wüste festhalten. Doch 2018 und 2019 wurden ebendiese Wüsten von außergewöhnlichen Wirbelstürmen und sintflutartigen Regengüssen heimgesucht, die sich in einem derartigen Feuchtigkeitsüberschuss niederschlugen, dass die Zahl der Heuschreckeneier regelrecht explodierte und somit zur Gefahr für die Nahrungsmittelversorgung von zig Millionen Menschen erwuchs – und zwar in genau jenem Moment, in dem das Virus über die Welt hereinbrach.
Kein apokalyptischer Reiter sitzt allein zu Pferd. Seuchen tauchen nicht im Singular auf. Es hat ganz den Anschein, als müssten wir auch noch mit Geschwüren und Viehpest und stinkenden Flüssen und toten Fischen und Fröschen rechnen. Zum Zeitpunkt der Niederschrift, in den ersten Tagen des April 2020, kratzt die Gesamtzahl der während der Corona-Pandemie registrierten Fälle an der Schwelle von einer Million Infizierter, während die Zahl der Toten bereits die 50 000er-Marke überschritten hat, und niemand weiß, wie all das enden wird. Um Lenin zu paraphrasieren: Es ist, als ob Jahrzehnte in Wochen gepfercht worden wären, die Welt dreht sich mit immer größerer Geschwindigkeit, sodass jegliche Prognose Gefahr läuft, sich lächerlich zu machen. Sobald jedoch auch uns ein Teil des Dystopiekonjunkturpakets zufällt, werden wir problemlos in der Lage sein, uns einen fiebrigen Planeten vorzustellen, auf dem Menschen mit Fieber leben: Es wird dort globale Erwärmung und Pandemien geben, Slums, die im Meer versinken, und Menschen, die – beispielsweise in Mumbai – an einer Lungenentzündung sterben. Im Slum Dharavi wurde bereits der erste Fall einer Coronavirusinfektion gemeldet. Eine Million Menschen lebt dort auf engstem Raum, mit minimalem Zugang zu sanitären Einrichtungen; Sturmfluten mit riesigen Wassermassen brechen jedes Jahr über den Slum herein. Zudem wird es Flüchtlingslager geben, in denen sich Krankheitserreger wie an einer Zündschnur entlang durch dicht gedrängte Körper fressen. Es wird viel zu heiß und viel zu ansteckend sein, um nach draußen zu gehen. Felder werden unter der Sonne rissig werden, ohne dass jemand sie bestellt.
Dessen ungeachtet aber ging die Coronakrise von Anfang an mit dem Versprechen einher, man werde zur Normalität zurückkehren, und dieses Versprechen war ungewöhnlich laut und glaubwürdig, zumal dieses Übel dem gesellschaftlichen System weitaus fremder zu sein schien als etwa der Crash einer Investmentbank. Das Virus war der Inbegriff eines exogenen Schocks. Man nahm daher an, dass es schon im nächsten oder übernächsten Monat verpuffen werde. Möglicherweise würde es eine zweite Welle erleben, aber damit hätte sich die Angelegenheit auch erledigt. Spätestens ein Impfstoff würde den Keim der Pandemie ersticken. Insofern wurde jede Maßnahme, die zur Eindämmung des Virus ergriffen wurde, gleich einer Straßenabsperrung der Polizei lediglich als vorübergehend angepriesen, damit wir uns mühelos das Bild eines Planeten ausmalen konnten, der geradewegs in den Status quo ante zurückversetzt wird: Straßen, die sich wieder füllen. Einkäufer*innen, die erleichtert ihre Gesichtsmasken abstreifen und in die Einkaufszentren drängen. Und all jene, die den aufgestauten Drang verspüren, genau dort weiterzumachen, wo sie vor dem Virus die Arbeit niedergelegt hatten – sie werden sich geradezu begeistert diesem Bild hingeben: die Rückkehr der Flugzeuge am Firmament, der geradezu nachwinterlich sprießende Baldachin aus weißen Kondensstreifen. Privater Konsum, womöglich verlockender als je zuvor. Niemand, der sich nach alledem noch in einen vollbesetzten Bus oder Zug zwängen wollte. All die ungenutzten Kapazitäten der Auto-, Stahl- und Kohleindustrie, die sich wieder entfalten, all die Lagerbestände, die sich endlich wieder in die Lieferketten einspeisen lassen würden. Und außer Sichtweite: die Ölbohrungen, zurück in voller Funktion, eifrig hämmernd.
Doch bei genauerer Betrachtung stellen sich diese beiden scheinbar gegensätzlichen Zukunftsszenarien als ein und dasselbe heraus. Besteht also überhaupt noch die Möglichkeit eines Auswegs?