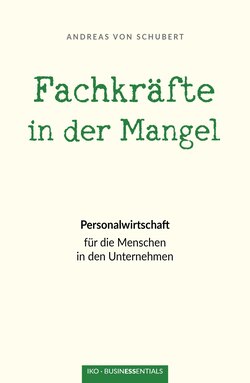Читать книгу Fachkräfte in der Mangel - Andreas von Schubert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Sozialgeschichte und Geschichte der Arbeit
In praktisch allen Unternehmen ist das Geschehen heutzutage geprägt von einer Philosophie der gegenseitigen Rücksichtnahme und des gegenseitigen Respekts. Rücksichtnahme nicht nur auf die Wünsche der Kunden des Unternehmens, sondern auch auf die der Mitarbeiter. Und Respekt für die Ziele der Mitarbeiter sowie dafür, dass ihre Ziele nicht unbedingt immer und zu jedem Zeitpunkt mit denen des Unternehmens, für das sie arbeiten, übereinstimmen müssen. Meistens ist es nicht weiter schwer, die Ziele der Mitarbeiter auch dann zu berücksichtigen, wenn sie nicht vollständig zu denen des Unternehmens passen. Denn Diskrepanzen sind eher zeitlicher Natur und daher auflösbar.
Sollten die Ziele des Unternehmens und die seiner Mitarbeiter aber doch einmal miteinander konkurrieren, dann steht ein breites Instrumentarium personalwirtschaftlicher Maßnahmen zur Verfügung, um die unternehmerischen Notwendigkeiten umzusetzen, ohne sie gegen die Interessen der Mitarbeiter durchsetzen zu müssen.
Die Überzeugung, dass ein Unternehmen nur dann erfolgreich ist, wenn auch seine Mitarbeiter sich selbst entsprechend ihrer persönlichen Wünsche und Bedürfnisse als erfolgreich betrachten können, ist zu einer allgemein gültigen Philosophie geworden; eine Philosophie, die zwar nicht immer und zu jedem Zeitpunkt auch umgesetzt wird, der jedoch grundsätzlich vermutlich alle Menschen, die in privatwirtschaftlichen Unternehmen beschäftigt sind, zustimmen würden. Und dennoch ist das Vorhandensein des heutigen personalwirtschaftlichen Instrumentariums keineswegs selbstverständlich. Immerhin hat seine Entwicklung fast zweihundert Jahre gedauert.
2.1 Die Entstehung der Industrialisierung
Die besondere Schwierigkeit lag darin, die in der Industrialisierung faktisch unbeschränkte Macht der vermögenden Fabrikbesitzer so zu begrenzen, dass die Humanität einer aufgeklärten Gesellschaft auch in Arbeitsverhältnissen, die von wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit gekennzeichnet sind, stets gewahrt bleibt. Denn da es die industrielle Welt heutigen Zuschnitts vor 1800 ganz einfach noch nicht gab1, fehlten auch Vorbilder zur Gestaltung der Veränderung in den Arbeitsprozessen von der Kleinstfertigung im Handwerk zur Massenfertigung industriellen Maßstabs.
Um zu verstehen, warum es solange gedauert hat, ein funktionierendes System von Einschränkungen persönlicher Handlungsfreiheiten im Interesse der Allgemeinheit zu etablieren, und warum die personalwirtschaftlichen Grundsätze in heutigen Unternehmen so aufgebaut sind, wie sie es sind, ist es wichtig, ihre Entstehungsgeschichte zu kennen. Vor allem aber ist es wichtig, sich mit der geschichtlichen Entwicklung der Arbeitsbeziehungen, mit der Geschichte der Arbeit also, und der damit unmittelbar zusammenhängenden Sozialgeschichte seit der frühen Industrialisierung zu beschäftigen. Denn nur das Wissen um vergangene Fehler kann zukünftige Fehler vermeiden.
Mechanisierung und Technisierung der Produktion
Mit der Erfindung der Dampfmaschine und der Eisenbahn sowie mit der Entwicklung mechanischer Produktionsverfahren waren die technischen Voraussetzungen für industrialisierte Produktionsverfahren zu erheblich geringeren Transaktionskosten für alle Marktteilnehmer gegeben. Menschliche Arbeitskraft konnte durch dampfgetriebene Maschinen ersetzt werden, standardisierte Massenproduktion konnte die Nachfrage zu erschwinglicheren Preisen befriedigen, und mithilfe der Eisenbahn wurden auch die Güter- und Handelsströme wesentlich vereinfacht.2 Dies in Verbindung mit der Möglichkeit zu freierem Handel und damit auch zu freierem Aufbau von privatem Vermögen führte in England bereits Mitte des 18. Jahrhunderts, und damit im Vergleich zu anderen europäischen Staaten relativ früh, zu industrialisierten Strukturen.
Der Vorteil der Mechanisierung und Technisierung der Produktion mit Hilfe der Dampfmaschine war die Möglichkeit, die Nachfrage der zu jener Zeit ebenfalls stark wachsenden Bevölkerung bedienen zu können.
Ein Zurück in die alte Ständegesellschaft war jedoch natürlich nicht mehr möglich.3 Es kam also fortan darauf an, diesen technischen Wandel und den damit einhergehenden Wandel der Arbeitsweisen und Arbeitsbedingungen zu gestalten; ein Wandel, der in kürzester Zeit von Zünften und Landwirtschaft zu industrieller Produktion führte.
Handwerkliche Zunftbetriebe waren kleine Betriebe, in denen Menschen in unmittelbarem und direktem persönlichem Kontakt gemeinsam an der Herstellung des kompletten Produktes arbeiteten. Die wenigen Personen in einem solchen Betrieb kannten sich untereinander sehr gut, und wenn es nicht gerade grundsätzliche Probleme gab, dann achtete man auch aufeinander und auf das Wohlergehen aller. Die Manufaktur fand im eigenen Haus oder in einem kleinen Betrieb statt. Die Arbeit wurde gemeinsam organisiert und aufgeteilt. Der großen Konkurrenz der mechanisierten und industrialisierten Massenproduktion zu minimalisierten Transaktionskosten hatten diese kleinen Handwerksbetriebe aber natürlich nichts entgegenzusetzen. Denn in der industriellen Produktion herrschte eine vollkommen andere Arbeitsorganisation.
Machtverteilung in industriellen Strukturen
Die industriellen Strukturen waren geprägt von einer sehr ungleichen Machtverteilung. Hier die wohlhabenden Besitzer des Produktivvermögens, also z.B. der Fabrikanlagen. Dort die schlecht bis gar nicht ausgebildeten Arbeitskräfte, die nichts anderes anzubieten hatten, als ihre physische Arbeitskraft. Weil die Arbeitskräfte durch sprunghaftes Bevölkerungswachstum und durch eine allgemeine Landflucht zudem auch noch in großer Zahl zur Verfügung standen, konnten die Fabriken bei minimalsten Arbeitskosten enorm effizient produzieren. Durch das Überangebot an Arbeitskräften und der daraus resultierenden Entlohnung nahe des Existenzminimums, verschärfte sich das Problem der ungleichen Machtverteilung natürlich weiter und mündete schließlich in einer erheblichen sozialen Schieflage.
Letztendlich bildete sich ein sogenannter »Vierter Stand« von Lohnarbeitern heraus, die tagtäglich bis zur Erschöpfung arbeiteten und dennoch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und der Landflucht jederzeit und sofort gegen andere Lohnarbeiter ausgetauscht werden konnten. Diese Menschen, die nur über ihre Arbeitskraft verfügten und sonst nichts anzubieten hatten, waren den Besitzern der Fabriken auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das führte gerade in den Hochburgen der Industrialisierung, wie zum Beispiel Manchester, so weit, dass die Menschen nach nur wenigen Jahren der Berufstätigkeit körperlich berufsunfähig wurden. Wenn man bedenkt, dass eine funktionierende Arbeitsschutzgesetzgebung praktisch nicht existent und Kinderarbeit zu dieser Zeit normal war, dann ist das schon eine katastrophale Entwicklung. Für diese Auswüchse der frühen Industrialisierung etablierte sich dann auch der Begriff des Manchester-Kapitalismus.
Natürlich gab es auch Ausnahmen. Robert Owen, der Besitzer der Fabrik in New Lanark bei Edinburgh, führte beispielsweise bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts für die damalige Zeit sehr weit reichende Arbeitsschutzregelungen für seine Mitarbeiter ein. So arbeiteten in seiner Fabrik beispielsweise keine kleinen Kinder. Für seine Arbeiter richtete er Abendschulen ein, damit diese sich fortbilden konnten. Außerdem organisierte er eine Einkaufskooperative für Lebensmittel sowie sonstige Utensilien des täglichen Bedarfs, und gab den Preisvorteil des Einkaufs in dem kleinen Laden auf seinem Fabrikgelände an seine Arbeiter weiter. All das war für die damalige Zeit ungewöhnlich fortschrittlich. Das grundlegende Problem blieb jedoch bestehen: die Arbeiter waren auch in diesem Fall dem Fabrikbesitzer persönlich und wirtschaftlich ausgeliefert und von dessen Wohlwollen abhängig. Die Arbeiter in New Lanark hatten zwar Glück, aber das allein ist natürlich keine ausreichende Basis für eine akzeptable personalwirtschaftliche Organisation eines Betriebs.
Das neue Denken als Voraussetzung für die Industrialisierung
Aber wie kam es eigentlich zu dieser plötzlichen Industrialisierung, die die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Menschen so grundlegend änderte, dass es für sie einen gerade schon revolutionären Charakter haben musste? Die Technisierung ist eine Erklärung. Ihr voran ging jedoch ein grundlegender Wandel im Denken der Menschen.
Mit der Aufklärung gewann das Vernunftprinzip als grundlegendes Denkmuster erheblich an Bedeutung, und mit ihm auch die Vorstellung von der Berechenbarkeit aller Dinge: Rationalismus genannt.
Das damit einhergehende positivistische Streben nach der Erforschung und möglichst exakten Feststellung von Tatsachen mündete schließlich in Pragmatismus und Utilitarismus: in dem Wunsch nach praktischer Anwendung des theoretischen Wissens und im Streben, daraus einen Nutzen zu ziehen.4
Diese neuen Denkmuster waren die vielleicht wichtigste Voraussetzung für den technischen Fortschritt und damit für die Industrialisierung. Dass es dabei nicht nur zur Industrialisierung der Gesellschaft, sondern zu einer regelrechten industriellen Revolution gekommen ist, hat sicherlich sehr viel mit dem Freiheitsbegriff zu tun, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowohl im politischen, als auch fast parallel dazu im ökonomischen Bereich Einzug in das Denken hielt.
2.2 Der Freiheitsbegriff in der Industrialisierung
Im Jahre 1762 formulierte Rousseau seine Vorstellung von einem Staat, der auf dem Vernunftprinzip aufbauend Freiheit und Gleichheit aller Menschen garantiert. Sein »Gesellschaftsvertrag« lautet:
»Da sich Menschen zur Erhaltung ihrer Freiheit und Gleichheit zum Staat zusammenschließen, ruht die Staatsgewalt beim Volk, die Regierenden sind seine Funktionäre, Gesetze bedürfen der Zustimmung aller; denn die Volkssouveränität ist absolut, unteilbar, unveräußerlich und bekundet sich in der Volonté générale (allgemeinen Wille der Nation), die auf das Beste aller abzielt, also immer richtig und mit dem Einzelwillen identisch ist.
Freiheit existiert nur in der Gleichheit, d.h. im Anerkennen des allgemeinen Willens. Dieser ist nicht identisch mit der Volonté de tous (Summe der egoistischen Einzelwillen), er kann auch von einer Minderheit für die Allgemeinheit vertreten werden.«5
Liberalismus nach Adam Smith
Nur vierzehn Jahre später, also praktisch zur selben Zeit, schrieb Adam Smith sein berühmt gewordenes Buch »der Wohlstand der Nationen«, in dem er als Ursache des Wohlstandes die Arbeit ausmachte und dann ebenfalls mit dem Begriff der Freiheit argumentierte. Nach Smith werden Güter aus natürlichem Selbstinteresse erzeugt und zu einem Marktpreis angeboten, der sich wie von selbst aus Angebot und Nachfrage ergibt.
Diese Eigenständigkeit des Marktes, der aus sich selbst heraus handelt, bezeichnet Smith sogar als »Naturgesetz«; als etwas also, dessen Richtigkeit sich aus einer natürlich Ordnung ergeben würde und daher nicht sinnvoll diskutiert oder sogar bezweifelt werden kann. Freie Konkurrenz und freier Handel auf einem freien Markt sorgen nach Smith für soziale Harmonie und Gerechtigkeit.6
Auch wenn dieser Klassiker der Wirtschaftswissenschaften damit sicherlich verkürzt wiedergegeben worden ist, wird doch aus seiner Grundthese, dass die Wirtschaftsteilnehmer die Freiheit haben sollten, im Markt tun und lassen zu können, was sie wollen, deutlich, wie es zu den sozialen Schieflagen in der Zeit der Industrialisierung kommen konnte. Denn die reine Marktfreiheit berücksichtigt in keiner Weise die unterschiedlichen Startbedingungen der Marktteilnehmer. Wie sollen die Angehörigen des vierten Standes, die jeden einzelnen Tag solange und so hart arbeiten müssen, dass ihnen tatsächlich keine Zeit bleibt, sich zu bilden, jemals aus ihrer prekären Situation herauskommen? Sie konnten ja noch nicht einmal dafür sorgen, dass es ihren Kindern in Zukunft besser geht. Denn auch diese mussten bereits von frühestem Kindesalter an täglich in den Fabriken arbeiten.
Dieser ökonomische Freiheitsbegriff, der die Freiheit des Marktes als natürliche und unantastbare Ordnung ansah, ist unter dem Begriff des Markt-Liberalismus bekannt geworden. Weil er für viele Generationen in einer ziemlich negativen Weise lebensbestimmend geworden ist, ist es notwendig, ihn im Folgenden noch ein wenig genauer zu betrachten.
Adam Smith schreibt im vierten Buch seines Werkes zum Wohlstand der Nationen über die Systeme der politischen Ökonomie:
»… So wird in jeder Wirtschaftsordnung, in der durch besondere Förderung mehr volkswirtschaftliches Kapital in einzelne Erwerbszweige gelenkt werden soll, als von selbst dorthin fließen würde oder durch außerordentliche Beschränkung Teile des Kapitals von Branchen ferngehalten werden, in denen sie sonst investiert worden wären, in Wirklichkeit das Hauptziel unterlaufen, das man zu fördern vermeint. Sie verzögert den Fortschritt des Landes zu Wohlstand und Größe, anstatt ihn zu beschleunigen, und sie verringert den wirklichen Wert des Jahresprodukts aus Boden und Arbeit, statt ihn zu vergrößern. Gibt man daher alle Systeme der Begünstigung und Beschränkung auf, so stellt sich ganz von selbst das einsichtige und einfache System der natürlichen Freiheit her. Solange der Einzelne nicht die Gesetze verletzt, lässt man ihm völlige Freiheit, damit er das eigene Interesse auf seine Weise verfolgen kann und seinen Erwerbsfleiß und sein Kapital im Wettbewerb mit jedem anderen oder einem anderen Stand entwickeln oder einsetzen kann. Der Herrscher wird dadurch vollständig von einer Pflicht entbunden, bei deren Ausübung er stets unzähligen Täuschungen ausgesetzt sein muss und zu deren Erfüllung keine menschliche Weisheit oder Kenntnis jemals ausreichen könnte, nämlich der Pflicht oder Aufgabe, den Erwerb privater Leute zu überwachen und ihn in Wirtschaftszweige zu lenken, die für das Land am nützlichsten sind.
Im System der natürlichen Freiheit hat der Souverän lediglich drei Aufgaben zu erfüllen, die sicherlich von höchster Wichtigkeit sind, aber einfach und dem normalen Verstand zugänglich: Erstens die Pflicht, das Land gegen Gewalttätigkeit und Angriff anderer unabhängiger Staaten zu schützen, zweitens die Aufgabe, jedes Mitglied der Gesellschaft soweit wie möglich vor Ungerechtigkeit oder Unterdrückung durch einen Mitbürger in Schutz zu nehmen oder ein zuverlässiges Justizwesen einzurichten, und drittens die Pflicht, bestimmte öffentliche Anstalten und Einrichtungen zu gründen und zu unterhalten, die ein einzelner oder eine kleine Gruppe aus eigenem Interesse nicht betreiben kann, weil der Gewinn ihre Kosten niemals decken könnte, obwohl er häufig höher sein mag als die Kosten für das ganze Gemeinwesen.« 7
Die beiden wesentlichen Passagen in diesem Text von Adam Smith sind der Hinweis auf die völlige Freiheit des Einzelnen, das eigene Interesse zu realisieren, solange er nicht Gesetze verletzt. Und als Zweites die Beschreibung der Aufgabe des Staates, »jedes Mitglied der Gesellschaft so weit wie möglich vor Ungerechtigkeiten oder Unterdrückung durch einen Mitbürger in Schutz zu nehmen«. Im Prinzip ist damit für alle gesorgt. Die völlige Freiheit des Einzelnen sorgt dafür, dass die Besitzer des Produktivvermögens und die gut ausgebildeten Leistungsträger bereit sind, sich in der Gesellschaft und für die Gesellschaft zu engagieren. Und auf der anderen Seite sorgt der Staat mit seiner Gesetzgebung für das notwendige Maß an Gerechtigkeit.
Auswirkungen der ökonomischen Freiheit
Diese Koexistenz von Freiheit und Gerechtigkeit setzt allerdings voraus, dass die existierenden Gesetze die Menschen auch tatsächlich vor Ungerechtigkeiten und Unterdrückung schützen. Und zwar auch im Arbeitsleben.
Das war allerdings damals nicht der Fall. Und so kam es, dass mehr als einhundertfünzig Jahre lang der eigentlich gut gemeinte Freiheitsbegriff in der ökonomischen Welt zu Ausbeutung und zu fast schon menschenverachtenden sozialen Schieflagen geführt hat, wie die folgenden Fotos vom Anfang des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll und zugleich bedrückend dokumentieren.
Abbildung 11: Kinderarbeit
»Jerald Schaitberger of 416 W. 57th St. N.Y. who helps an older boy sell papers until 10 P.M. on Columbus Circle. 7 yrs. old. 9: 30 P.M., October 8, 1910. Location: New York, New York (State).« Lewis W. Hine, Library of Congress, Prints & Fotographs Division, National Child Labor Committee Collection, Repr.Nr. LC-DIG-nclc-03620, no known restrictions on publication.
Abbildung 12: Kinderarbeit
»A young doffer working in Central Mills. Location: Sylacauga, Alabama.« Lewis W. Hine, Library of Congress, Prints & Fotographs Division, National Child Labor Committee Collection, Repr.Nr. LC-DIG-nclc-01956, no known restrictions on publication.
Abbildung 13: Kinderarbeit
»Trapper Boy, Turkey Knob Mine, Macdonald, W. Va. Boy had to stoop on account of low roof, Foto taken more than a mile inside the mine. Witness E. N. Clopper. Location: MacDonald, West Virginia.« Lewis W. Hine, Library of Congress, Prints & Fotographs Division, National Child Labor Committee Collection, Repr.Nr. LC-DIG-nclc-01070, no known restrictions on publication.
Abbildung 14: Kinderarbeit
»Rhodes Mfg. Co., Lincolnton, N.C. Spinner. A moments glimpse of the outer world Said she was 10 years old. Been working over a year. Location: Lincolnton, North Carolina.« Lewis W. Hine, Library of Congress, Prints & Fotographs Division, National Child Labor Committee Collection, Repr.Nr. LC-DIG-nclc-01345, no known restrictions on publication.
Abbildung 15: Kinderarbeit
»Fourteen year old spinner in a Brazos Valley Cotton Mill at West. Matty Lott runs six sides.« Lewis W. Hine, Library of Congress, Prints & Fotographs Division, National Child Labor Committee Collection, Repr.Nr. LC-DIG-nclc-02873, no known restrictions on publication.
Abbildung 16: Kinderarbeit
»›Teaching the young idea.‹ The Boss (who began at 10 years of age, and has been at it for 30 years) showing a beginner (who is apparently 9 or 10). Location: Morgantown, West Virginia.« Lewis W. Hine, Library of Congress, Prints & Fotographs Division, National Child Labor Committee Collection, Repr.Nr. LC-DIG-nclc-01198, no known restrictions on publication.
Abbildung 17: Kinderarbeit
»A little spinner in the Mollohan Mills, Newberry, S.C. She was tending her ›sides‹ like a veteran, but after I took the Foto, the overseer came up and said in an apologetic tone that was pathetic, ›She just happened in.‹ Then a moment later he repeated the information. The mills appear to be full of youngsters that ›just happened in,‹ or ›are helping sister.‹ Dec. 3, 08. Witness Sara R. Hine. Location: Newberry, South Carolina.« Lewis W. Hine, Library of Congress, Prints & Fotographs Division, National Child Labor Committee Collection, Repr.Nr. LC-DIG-nclc-01451, no known restrictions on publication.
Auf Abbildung 11, einem Foto aus dem Jahre 1910, kann man sehen, wie ein siebenjähriger Junge abends um halb zehn in New York auf der Straße Zeitungen verkauft. Er hilft einem älteren Jungen aus und steht dort immer bis abends um 10:00 Uhr. Das Foto stammt aus einer ganzen Reihe von Aufnahmen des Fotografen Lewis Hine über Kinderarbeit in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es zeigt die äußerst prekäre Lage vieler Kinder in einer Zeit, in der die fast absolute ökonomische Freiheit maßgeblich war. Mit Sicherheit entsprach die nach Adam Smith mit der Freiheit korrespondierende Gerechtigkeit der Gesetzeslage. Aber sie ließ eben auch Kinderarbeit bereits ab dem frühesten Kindesalter zu. Diese war sogar normaler Bestandteil des alltäglichen Straßenbildes, wie man hier sehen kann. Vermutlich ist diese Arbeit nicht allzu schwer, und auch heute tragen Jugendliche schon mal Zeitungen aus, um ihr Taschengeld aufzubessern. Und könnte man in Bezug auf die späte Abendzeit nicht auch mal ein Auge zudrücken? Nun, wenn ja, wie wäre es dann mit dem folgenden Beispiel von Kinderarbeit?
Das Foto aus Abbildung 12 wurde im November 1910 aufgenommen und zeigt ein Kind, das am Webstuhl in einer Textilfabrik arbeitet. Auch dieses Bild stammt von Lewis Hine, der im Auftrag des Nationalen Komitees für Kinderarbeit in den USA dokumentierte, wie Kinder im ganz regulären Produktionsablauf in Fabriken tagtäglich und von morgens bis abends schuften mussten. Kinder arbeiteten aber nicht nur auf der Straße und in Fabriken, sondern sehr oft auch in Bergwerken. Für den Arbeitsablauf in Bergwerken haben Kinder nämlich einen großen Vorteil: weil sie noch nicht so groß sind, passen sie problemloser auch durch niedrigere Stollen.
So wie das in Abbildung 13 portraitierte Kind beispielsweise, das im Oktober 1908 in einer Mine in West Virginia fotografiert wurde – übrigens nicht am Mineneingang, sondern etwa eineinhalb Kilometer tief im Inneren der Mine. Auf dem Foto kann man sehen, wie niedrig der Stollen ist. Selbst das Kind muss sich bücken und steht deswegen etwas nach vorne gelehnt, wie Lewis Hine sein Foto beschreibt.
Abbildung 14 zeigt ein Mädchen, das in einer Textilfabrik arbeitet. Lewis Hine hat es überschrieben mit: ein flüchtiger Blick in die Welt da draußen. Das Mädchen sagte ihm, dass es 10 Jahre alt sei und bereits seit einem Jahr in der Textilfabrik arbeite.
In Abbildung 15 ist ein vierzehnjähriges Mädchen zu sehen, das gleich sechs Textilmaschinen bedient. Gerade die Arbeit in Fabriken war zudem auch noch alles andere als ungefährlich. Insbesondere die Lederriemen, die die Maschinen antrieben, bargen ein hohes Verletzungsrisiko. Im Vordergrund dieses Fotos kann man einen solchen Lederriemen sehen, der selbst wiederum von Lederriemen und Übertragungsrollen unter der Decke der Maschinenhalle angetrieben wird. Alle Riemen bewegten sich schnell und standen unter hoher Spannung. Wenn einer davon riss, dann konnten die Verletzungen schwer und der folgende Verdienstausfall angesichts mangelhafter Vorsorgesysteme existenzbedrohend sein. Das Bild wurde im November 1913 aufgenommen.
Das Foto in Abbildung 16 vom Oktober 1908 trägt den Titel: den Jüngeren etwas beibringen. Es zeigt ein etwa neun bis zehn Jahre altes Kind, dem der Chef der Glasbläserei die Technik des Glasblasens beibringt. Der Chef ist übrigens bereits seit 30 Jahren Glasbläser und hat selbst im Alter von etwa 10 Jahren damit angefangen, wie Lewis Hine notierte. Dieses Bild ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich bei Kinderarbeit tatsächlich um ein viele Generationen umfassendes Problem handelte, aus dem es für die Betroffenen kaum eine Möglichkeit des Entkommens gab. Denn weil sie bereits als Kinder tagtäglich unter teils extremen Bedingungen, wie zum Beispiel in der Bergmine oder auch hier in dem körperlich anstrengenden Beruf des Glasbläsers, arbeiten mussten, hatten sie keine Zeit, zur Schule zu gehen, und damit auch keine Möglichkeit, sich aus diesen prekären Arbeitsverhältnissen heraus zu qualifizieren.
Und in Abbildung 17 noch abschließend ein kleines Mädchen, das »seine« Maschinen bedient wie ein alter Hase, wie Lewis Hine berichtet, der das Foto am 3. Dezember 1908 aufgenommen hat. Er schildert weiter, dass gerade als er das Foto machte, ein Aufseher vorbeikam, der in einem entschuldigenden und pathetischen Tonfall sagte, dass dieses Mädchen nur zufällig gerade vorbeigekommen sei.
Lewis Hine schreibt weiter, dass die Textilfabriken ganz offenbar voll von kleinen Kindern seien, die nur gerade »zufällig vorbei gekommen seien«, oder nur gerade »ihrer Schwester helfen«. Und Hine kann sogar Zeugen benennen, die die Situation ebenfalls beobachtet haben.
Kinderarbeit war normaler Bestandteil des öffentlichen Lebens; und das über sehr viele Generationen.
Neoliberalismus nach Alexander Rüstow
Die Verlagerung des Denkens auf das Vernunftprinzip, die rasant voranschreitende Technisierung durch das Interesse an der Wissenschaft, daran wie etwas funktioniert und wozu man es nutzen kann, ermöglichten eine erhebliche Steigerung der Effizienz in der Produktion von Gütern. Die langsame und ineffiziente Werkstattfertigung eines Handwerkers wurde von effizienter Produktion im industriellen Maßstab abgelöst. Die Überwindung absolutistischer Herrschaftsordnungen und die damit einhergehende Freiheit des Handels ermöglichten Wohlstand auch für Bevölkerungsschichten, die davon bisher ausgeschlossen waren. Die wirtschaftliche Freiheit ermöglichte es jedem, der über entsprechende wirtschaftliche Ressourcen verfügte, dass er »das eigene Interesse auf seine Weise verfolgen kann und seinen Erwerbsfleiß und sein Kapital im Wettbewerb mit jedem anderen oder einem anderen Stand entwickeln oder einsetzen kann« – wie es Adam Smith ausdrückte. Allen anderen drohte jedoch ein unentrinnbares Prekariat. Denn die damaligen Gesetze reichten ganz offenbar nicht aus, die Freiheit des Einzelnen so zu lenken, dass andere nicht unter dieser Freiheit leiden müssen.
Die alles entscheidenden Fragen sind also erstens, wie weit die Freiheit des Einzelnen begrenzt werden muss, um Schaden von der Allgemeinheit abzuwenden. Und zweitens, wer das tun kann. Die damalige Lösung war, es dem weitestgehend liberalisierten Markt zu überlassen. Das Ergebnis kann man auf den gerade gesehenen Bildern studieren.
Wir wissen heute aus den Erfahrungen mit der Industrialisierung, dass sich auch bei vorhandener Freiheit die notwendige Gerechtigkeit nicht automatisch einstellt.. Denn jeder Marktteilnehmer ist selbstverständlich vor allem von dem eigenen Nutzen getrieben, den er durch seine Marktteilnahme realisieren möchte. Und im Zweifelsfall hat der eigene Nutzen eben höhere Priorität als der Anderer.
Freiheit führt zu Macht, wenn sie mit der Konzentration wirtschaftlicher Ressourcen in einer Hand gekoppelt ist. Daher ist die Gesellschaft in der Verantwortung, die Möglichkeit zur Ausübung dieser Macht so weit zu begrenzen, dass sie anderen, schwächeren Marktteilnehmern nicht zum Schaden gereicht. Das ist eine der großen, zentralen und wirklich wichtigen Erfahrungen aus den hundertfünfzig Jahren Industrialisierung seit Adam Smith. Denn es darf nicht sein, dass weite Teile der Bevölkerung aufgrund fehlenden materiellen Besitzes ihr gesamtes Leben über selbst bei höchstem Intellekt und Leistungswillen keine Möglichkeit haben, sich aus diesen prekären Verhältnissen hoch zu arbeiten und zu befreien. Eine Gesellschaft darf diese fehlende Gerechtigkeit aus falsch verstandener Freiheit nicht zulassen. Denn beides ist gleichermaßen schützenswert: die Freiheit des Einzelnen, sein persönliches Vermögen und seinen Besitz nach eigenem Dafürhalten und zum eigenen Vorteil einzusetzen. Aber eben auch die Gerechtigkeit, die allen Menschen unabhängig von ihrer Ausgangssituation die Chance einräumt, sich mit entsprechendem Leistungswillen weiter zu entwickeln. Der reine Wirtschaftsliberalismus, wie er sich über die Jahrhunderte letztlich aus den Ideen von Adam Smith entwickelte, erwies sich dafür als untauglich. Diese Erkenntnis formulierte Alexander Rüstow, einer der Gründungsväter der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, auf einer Konferenz des Vereins für Sozialpolitik in Dresden am 28. September 1932 unter dem Titel: »freie Marktwirtschaft – starker Staat (die staatspolitischen Voraussetzungen des wirtschaftspolitischen Liberalismus)« folgendermaßen:
»Der neue Liberalismus jedenfalls, der heute vertretbar ist, und den ich mit meinen Freunden vertrete, fordert einen starken Staat, einen Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er hingehört. Und mit diesem Bekenntnis zum starken Staat im Interesse liberaler Wirtschaftspolitik und zu liberaler Wirtschaftspolitik im Interesse eines starken Staates – denn das bedingt sich gegenseitig, mit diesem Bekenntnis lassen Sie mich schließen.«8
Rüstow forderte einen gesetzlich vorgegebenen ordnungspolitischen Rahmen, um den ansonsten selbstverständlich freien Markt soweit – und nur soweit – zu begrenzen, wie es zum Schutz der schwächeren Marktteilnehmer vor Ausnutzung notwendig ist. Es ging ihm dabei nicht darum, den freien Markt als solchen abzuschaffen. Denn die Freiheit von Marktteilnehmern, ihre Mittel nach eigenen Vorstellungen zu verwenden, ist eine wichtige und absolut notwendige Grundvoraussetzung dafür, dass sie überhaupt bereit sind, sich einzusetzen und sich zu engagieren. Die Freiheit des Einzelnen endet nur eben dort, wo sie die Entwicklungschancen anderer begrenzt.
Bei der Begrenzung der Freiheit einzelner Marktteilnehmer durch einen ordnungspolitischen Rahmen darf es jedoch niemals um Gleichheit gehen. Das Ziel einer solchen Maße muss stets Gerechtigkeit und nicht Gleichheit sein. Gleichheit der Marktteilnehmer hieße, dass alle über die gleichen ökonomischen Mittel verfügen sollten. Das kann kein Ziel sinnvoller Wirtschaftspolitik sein. Denn die gleichmäßige Verteilung von Mitteln würde bedeuten, dass diejenigen, die mehr besitzen, von ihrem Besitz abgeben müssten, ohne dafür eine für sie interessante Gegenleistung zu bekommen. Dieses Ansinnen würde jegliche Leistungsbereitschaft und jeglichen Einsatzwillen der Betroffenen zunichte machen. Denn warum sollte man sich einsetzen, wenn man nichts davon hat? Das Ziel der Etablierung eines ordnungspolitischen Rahmens oberhalb des ansonsten freien Marktes kann also nicht Gleichheit, sondern nur Gerechtigkeit sein. Und zwar eine Gerechtigkeit, bei der nach John Rawls‹ zweitem Gerechtigkeitsgrundsatz soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeiten nur dann akzeptabel sind, wenn diese »den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen« und wenn Ämter und Positionen »allen gemäß fairer Chancengleichheit offen stehen«9.
Um die für die Leistungsbereitschaft notwendige Freiheit zu erhalten und zugleich aber auch die Chancen der wirtschaftlich Benachteiligten zu gewährleisten, forderte Rüstow einen neuen Liberalismus: den Neo-Liberalismus.
Dieser Begriff steht im heutigen Sprachgebrauch leider für das, was wir als Gesellschaft nicht wollen: den reinen Markt-Liberalismus, bei dem alle Markt-Teilnehmer sich selbst überlassen sind. Ursprünglich ist der Begriff »Neo-Liberalismus« aber für das genaue Gegenteil dessen eingeführt worden: für eine Ordnungs- und Sozialpolitik, die die Marktfreiheit gewährleistet und dennoch für das notwendige Maß an Gerechtigkeit sorgt. Man kann sich immer darüber unterhalten, wie weit sich der Staat und damit die Gesellschaft in das Marktgeschehen einmischen sollte und wo sich der Staat besser heraushält. Aber darüber, dass die schwächeren Marktteilnehmer vor Ausbeutung geschützt werden müssen, besteht Einvernehmen. Und für dieses Einvernehmen stand ursprünglich der Begriff »Neo-Liberalismus«.
Natürlich kann sich die Verwendung und Interpretation von Begriffen im Lauf der Zeit verändern. Das ist ein normaler Vorgang. Problematisch ist nur, dass wir durch diese vermutlich aus Unwissenheit entstandene Uminterpretationen des Begriffes »Neoliberalismus« nun keinen Begriff mehr für das haben, was wir als Gesellschaft eigentlich anstreben: Leistung fördernde Handlungs- und Entscheidungsfreiheit bei gleichzeitiger Chancen-Gerechtigkeit.
2.3 Erfahrungen aus der Industrialisierung für die globalisierte Welt
Die Freiheit der Wirtschaftsmärkte ist ein hohes Gut. Die Ausgestaltung des Spannungsfeldes zwischen Freiheit und Gerechtigkeit ist daher eine umso herausforderndere Aufgabe; heute noch genauso wie damals zu Zeiten der Industrialisierung. Denn auch heute existieren noch ganz ähnliche Strukturen wie damals zu Zeiten der Industrialisierung in Europa und Nordamerika. Die International Labour Organization der Vereinten Nationen schätzt, dass über 151 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren (oder fast 10% aller Kinder weltweit in nicht akzeptabler Kinderarbeit tätig sind; mehr als 72 Millionen Kinden davon in gefährlicher Arbeit, die ihre Gesundheit, Sicherheit und persönliche Entwicklung unmittelbar gefährdet.11
Abbildung 18: Kinder in unterschiedlichen Formen ökonomischer Aktivität
Quelle: Zahlen aus ILO (2017), S. 9
In Abbildung 18 ist die nach der Definition der International Labour Organization akzeptable Kinderarbeit weiß dargestellt, zwar nicht akzeptable, aber zumindest ungefährliche Kinderarbeit hellgrau, und gefährliche Kinderarbeit, die auch die unbestreitbar schlimmsten Formen von Kinderarbeit beinhaltet, dunkelgrau. Die genauen Definitionen dieser verschiedenen Formen von Kinderarbeit sind in der angegebenen Quelle nachlesbar. Die grau eingefärbten Bereiche der Grafik sollten nach Einschätzungen der International Labour Organisation allesamt abgeschafft werden.
Wie man auch auf den folgenden Fotos heutiger Kinderarbeit sehen kann, ist das Problem im Laufe der letzten Jahrzehnte keineswegs unbedeutender geworden.
Abbildung 19: »Teppichkinder« und »Müllkinder« in Indien
Quelle: © Benjamin Pütter/MISEREOR (mit freundlicher Genehmigung)
So schreibt Misereor auf ihrer Homepage zum Projekt »Kinderarbeit wirksam bekämpfen«:
»Wo Kinder zur Arbeit gezwungen werden, sind die Folgen für sie meist fatal: körperliche, nicht selten auch seelische Schäden, Analphabetismus – und keinerlei Chance, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. (…) Am weitesten verbreitet ist Kinderarbeit in Asien und im Pazifikraum: Hier müssen rund 122 Millionen Jungen und Mädchen arbeiten, nicht selten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Welche Folgen dies haben kann, weiß Pater Deepak. Er leitet das Übergangszentrum für befreite Kindersklaven der MISEREOR-Partnerorganisation DDWS in der Nähe von Allahabad, im indischen Teppichgürtel. Hier kümmert er sich um Jungen, die u.a. aus Sklavenarbeit in den Teppichknüpfereien befreit wurden. ›Oft sind ihre Hände deformiert – das kommt von dem stundenlangen, ermüdenden Knüpfen. Viele leiden durch das ständige Einatmen von Staub an schweren Lungen-, Magen und Darmkrankheiten. Auch das Rückgrat ist häufig geschädigt‹, erzählt er.« 12
Als Menschen und als Gesellschaft sind wir auch heute noch aufgerufen, den Wirtschaftsliberalismus ständig neu zu definieren: und zwar sowohl freiheitlich, als auch gerecht. Aber wie kann es überhaupt zu solchen Strukturen kommen, und vor allem: was kann man, was können wir als mittlerweile globalisierte Gesellschaft dagegen tun?
Zum Reflektieren
Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, und versuchen Sie, entsprechende Argumente zu formulieren: Ist es für die Größe des Problems relevant, wie viele Kinder von unakzeptablen Formen der Arbeitstätigkeit betroffen sind? Sicherlich nicht. Warum sind dann aber gerade die hohen Zahlen so bedrückend?
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen gerechteren, für einen neuen Liberalismus ist Transparenz. Denn das Streben nach Gerechtigkeit innerhalb einer freiheitlichen Grundordnung setzt voraus, dass etwaige Ungerechtigkeiten überhaupt erst einmal bekannt werden. In der heutigen Zeit tragen Kunden, die ungerecht (unfair) hergestellte Produkte kaufen, eine erhebliche Mitschuld an den Verhältnissen in den Produktionsstätten. Denn das Wissen um die Produktionsbedingungen in vielen Teilen der Welt ist vorhanden. Nicht zuletzt durch Reporte wie die der International Labour Organization der Vereinten Nationen, aber auch durch diverse Dokumentationen in den Medien. Allerdings werden trotz dieses Wissens weiterhin Produkte gekauft, die unter unwürdigen Bedingungen und teils sogar von Kindern hergestellt wurden. Die Freiheit zu solchen Kaufentscheidungen ist selbstverständlich unantastbar. Die Freiheit als solche ist jedoch heute ebenso wenig das Problem wie damals zu Zeiten der Industrialisierung.
Die Frage ist vielmehr, wie man mit wirtschaftlicher Freiheit umgeht; auch als Kunde. Denn nicht nur als Besitzer von Produktivvermögen, sondern auch als Kunde führt ökonomische Entscheidungsfreiheit gleichzeitig zu einem beträchtlichen Maß an Macht über Menschen, die abhängig beschäftigt dafür arbeiten.
Es kommt also nach wie vor nicht auf die Freiheit selbst an, sondern darauf, wie diese Freiheit ausgestaltet wird und wie die aus der Freiheit resultierende Macht im Sinne eines sozialen Liberalismus begrenzt werden muss, um Ungerechtigkeiten, Willkür und Schaden für die schwächeren Marktteilnehmer zu vermeiden; heute allerdings weltweit.
Zum Reflektieren
Die Frage ist, wie wir die Errungenschaften der aus der Industrialisierung hervorgegangenen sozialen Marktwirtschaft in Zeiten der Globalisierung erhalten können.
Die Freiheit der Kunden, sich für das eine oder andere Produkt zu entscheiden, kann nicht durch einen ordnungspolitischen Rahmen gesetzlich reglementiert werden. Das unterscheidet die heutigen, weltweiten Herausforderungen von denen während des Übergangs vom reinen Marktliberalismus zur sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Die Entscheidungsfreiheit der Kunden bleibt, und damit auch ihre ökonomische Macht. Das einzige Regulativ ist das persönliche Wertesystem und die persönliche Ethik jedes Einzelnen. Eine große Verantwortung. Für uns alle.
2.4 Zusammenfassung
Die Zeit der Industrialisierung war geprägt von äußerst prekären Arbeitsverhältnissen für einen Großteil der Bevölkerung. Ausbeutung und Kinderarbeit waren an der Tagesordnung. Und es bildete sich ein sogenannter vierter Stand heraus, bestehend aus Menschen, die nichts weiter anzubieten hatten, als ihre physische Arbeitskraft. Aufgrund nahezu unkontrollierter Arbeitsbedingungen mussten sie fast ununterbrochen arbeiten und hatten so faktisch keine Zeit, sich auszubilden. Im Ergebnis waren sie über Generationen in diesen prekären Arbeitsverhältnissen gefangen; und das bereits von frühester Kindheit an.
Dabei war der Grundgedanke der Industrialisierung durchaus positiv. Die Aufklärung führte zu einem neuen Interesse an Wissenschaften: an Zusammenhängen, dem Funktionieren der Dinge und auch an deren Nutzen. Mit dem technischen Fortschritt war dann die Möglichkeit zu höherer Effizienz und Effektivität der Produktion gegeben. Fast zeitgleich mit der zunehmenden geistigen Freiheit kamen auch gesellschaftspolitische und ökonomische Freiheitsbestrebungen. Der Grundgedanke der Freiheit war in beiden Fällen, dass der Mensch als Individuum frei in seiner Entscheidung sein sollte.
Die Ausgestaltung dieser individuellen Freiheit als wirtschaftliche Freiheit der Marktteilnehmer erwies sich jedoch als problematisch. Denn die ökonomische Freiheit, die eigenen Finanzmittel nach Gutdünken einzusetzen, war eben nicht an ein gesellschaftspolitisches Versprechen gekoppelt, dies nur zum Wohle aller zu tun. Und so blieb es beispielsweise den Fabrikbesitzern mehr oder weniger selbst überlassen, inwieweit sie sich um das Wohl ihrer Belegschaft kümmerten. Eine funktionierende Arbeitsgesetzgebung war nicht wirklich existent. Aus diesen Erfahrungen mit den negativen Begleiterscheinungen des Liberalismus entwickelte sich schließlich der Gedanke des Neoliberalismus und mit ihm die soziale Marktwirtschaft. Nun kommt es darauf an, diese laufend weiter zu verbessern und an neue Beschäftigungsformen anzupassen: nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Denn wir stehen heute noch vor den gleichen Herausforderungen wie zu Zeiten der Industrialisierung, nur dass es diesmal um erheblich mehr Menschen geht.