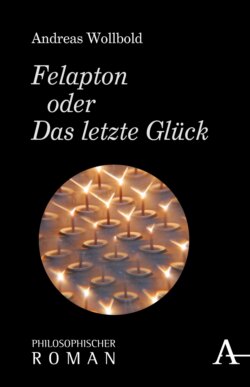Читать книгу Felapton oder Das letzte Glück - Andreas Wollbold - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDrittes Kapitel Worin Jens in einem noblen Forschungszentrum spioniert und mehr findet, als er gesucht hat
Als Jens Deschwitz am Nachmittag desselben Tages den U- Bahnhof am Rotkreuzplatz verließ, regnete es. Sein rechter Schuh war nicht mehr ganz wasserdicht, aber er war nicht zimperlich. »Aschermittwoch muss wohl grau sein wie Asche«, dachte er. Als Fotograf liebte er nassen Asphalt, regenverschleierte Hintergründe, Schatten ohne Sonne. Nach vier Jahren als Industriefotograf in Bitterfeld und Zwickau war er 1991 arbeitslos geworden. Die nächsten Jahre hatte er sich als freier Mitarbeiter in Werbeagenturen versucht. Dabei bildete sich seine fotografische Handschrift aus, die Liebe zu den Zwischentönen. So lichtete er die neuen Westprodukte in Nieselregen, Nebel, nächtlicher Dämmerung oder unter moosigen Brückenbögen ab. Anfangs mit nicht wenig Erfolg. »Wir Ossis können uns noch nicht der prallen Sonne des Wohlstands aussetzen«, begründete er, ganz Philosoph, seine ungewöhnliche Vorgehensweise. Die Ergebnisse gaben ihm recht. Knallgelb wurde kastanienbraun, aufreizendes Rot ein samtenes Bordeaux. Eben ohne die schreienden Farben, die man im Westen aus Werbung, Schaufenstern und Verpackung gewohnt war. Ein Bremer Galerist war auf ihn aufmerksam geworden und hatte ihm eine Ausstellung organisiert. Drei Feuilletons hatten eine Randnotiz dazu gebracht, ein Kulturkanal hatte ein zwanzigsekündiges Interview gesendet, doch das war es auch schon gewesen. Ein bloßer Moment des Erfolgs, wirklich keine pralle Sonne. Bald gingen die Aufträge zurück. Er arbeitete einfach zu langsam und war miserabel in der Selbstvermarktung. Andere hatten seine Art imitiert, nur viel effizienter. Immerhin hatte diese Periode ihm einen gewissen Namen als kreativer Sonderling eingebracht.
Danach stieß Jens für einige Jahre mit Bewerbungsfotos für gehobene Ansprüche auf eine Goldader. Seine einzige Schwäche: Mitgefühl. Am meisten taten ihm die Fünfzigjährigen leid. Von ihren missglückten Posen vor der Kamera hatte er bald ein Album voll mit Ausschuss. Angestrengt hatten all diese Wende-Verlierer sich bemüht, ein Gewinner-Lächeln aufzusetzen. »American smile«, nannte er diese Sammlung. Aus seiner Langsamkeit bei den Regenbildern hatte er zwar seine Lehren gezogen und lieferte seinen Kunden nun pünktlich perfekte Fotos ab. Doch zur gleichen Zeit entwickelte Jens eine Passion für »das wahre Antlitz eines Menschen« – einen Halbsatz lang konnte er schon einmal richtig feierlich werden. Dabei experimentierte er. Zuerst führte er seine Kamera extrem nahe an die Gesichter heran, entwickelte eine eigene Beleuchtungstechnik, vor der sich kein Quadratzentimeter Haut verstecken konnte, und suchte eine Scharfeinstellung, die sich auf die problematischen Gesichtspartien konzentrierte und auf diese Weise unwiderlegbar jeden falschen Schein dieser Person entlarvte. Fettige Poren, Pickelnarben, ein Schnitt infolge einer zu hastigen Rasur, eine Krümmung der Nase, ein Hautfetzen an der Lippe und dann natürlich die Augen – die Lider zu weit aufgerissen, blinzelnd, zusammengekniffen, erschreckt wandernde Pupillen, gerötete Bindehaut, querliegende Wimpernhärchen, Sandmännchens Mitbringsel, ein Gerstenkorn oder natürlich Augenringe in jeder Größe. »Du bist ja ein Protestant ohne Taufe«, meinte ein Kollege zu ihm. »So wenig duldest du Lügen, und dabei ruhst du nicht, bis du jeden Makel bei einem Menschen entdeckt hast.« Diese Bemerkung hatte ihn geärgert, gerade weil sie zur Hälfte zutraf. Lug und Trug, aufgesetztes Gebaren und Schauspielerei hasste er nicht erst, seitdem sie Westen waren. In diesem Punkt würde er niemals über seinen Schatten springen, und damit hatte er sein Schicksal selbst besiegelt. In der neuen Zeit würde er immer nur in irgendwelchen Nischen überleben können. Das wahre Antlitz eines Menschen, schön muss es sein, damit sich der Blick nicht von ihm abwendet – das zu wissen war er Fotograf genug. Nur Makel zeigen und sonst nichts, das wäre ekelig. Jens lernte Barmherzigkeit und veränderte seine Technik. »The line of grace and beauty«, diesen Ausdruck hatte er irgendwo gelesen, und so forschte er fortan nach der Gesichtspartie, die jemanden unverwechselbar machte, oder besser … liebenswert. Irgendwann war dann aber Kassensturz: Von der Portraitfotografie allein konnte er unmöglich leben. Seine Suche nach dem Stein der Weisen darin war ohnehin nur brotlose Kunst. So begann er 1998 als freier Bildjournalist, neben den Portraits seine Haupteinnahmequelle bis heute.
Als Jens den U-Bahnhof verließ, regnete es also. Dennoch ging er zu Fuß weiter zum Nymphenburger Schloss, immer den Kanal entlang. Südliche oder Nördliche Auffahrtsallee? Der Norden lag ihm schon immer näher. Das graugrüne Wasser verriet nicht, ob es stand oder floss. Links und rechts davon mehrten sich die Villen. Allein die Steigerung des Marktwertes in den letzten Jahren von einer von ihnen hätte mir genügt, mir mein Traumstudio zuhause leisten zu können, tropfte ihm ein Gedanke ins Bewusstsein, zerplatzte aber gleich darauf schon wieder. Er war nicht neidisch. Vielleicht hatte diesen Gedanken nur das schlechte Gewissen darüber ausgelöst, dass er die Bilder der fünf Toten an Jack verkauft hatte.
Jetzt gab der Weg entlang des Kanals den Blick auf das weit ausgreifende Areal des Schlosses frei. Der langgezogene Strich des Wassers verbreiterte sich vasenartig zu einem Teich, umgeben von einem gewaltigen Platz, der die Fassade des Schlosses selbst mehr als wirkungsvoll zur Geltung brachte. Genau in der Mitte des Schlossprospektes wurde der Palast durchsichtig. Auf beiden Seiten befanden sich hohe Fenster, und so war das Tageslicht von der anderen Seite zu sehen. So viel Aufwand, ein ganzer Prunkpalast, nur um am Ende nichts anderes zu sehen als das reine Licht!
In einem links vorgelagerten Gebäude, eher selbst schon einem kleinen Barockschloss, befand sich das Institut für logische Grundlagenforschung der Universität. Wem der Präsident der Uni eine solche Nobeladresse verschafft, der muss schon ganz oben in seiner Gunst stehen, setzte der Zwickauer seine Betrachtung fort.
An diesem Ort war Robert Schönherrs Arbeitsplatz, zuerst als Assistent und danach im Rahmen eines gut dotierten Forschungsprojektes. Vielleicht konnte ihm hier ja jemand über den Verschollenen Auskunft geben. Jens musste es herausfinden, musste alles wissen. Er war ja der erste Zeuge. Seine Fotos vom Geschehen waren nicht manipuliert. Sie zeigten genau das, was er gesehen hatte – mit angehaltenem Atem, verstört und doch von dem Anblick so berührt, dass er sich erst eine halbe Stunde nach dem letzten Foto wieder nach oben vor das Kloster begeben, die Bilder an den Day ’n’ Nite gesendet und dann erst die Polizei alarmiert hatte. War das Recht oder Unrecht? Auf jeden Fall, wenn alles gut ging, wäre er mit diesen einzigartigen Fotodokumenten in Kürze um zwanzigtausend Euro reicher, und er könnte sich endlich zu Hause in Zwickau seinen Traum verwirklichen: ein Tausend-Quadratmeter- Studio in einer leerstehenden Fabrikhalle. Reichte ihm diese Aussicht nicht? Was suchte er dann noch hier an diesem Ort? Sensationelle Aufnahmen waren beim Herumschnüffeln an einem Institut der Universität sicher nicht zu erwarten, und noch mehr Geld würde mit Sicherheit nicht fließen – wenn Jack, dieser großspurige Heute-so- morgen-so-Typ nicht ohnehin nur leere Versprechungen gemacht hatte. Nein, es ging ihm um etwas anderes. Er hatte es gesehen, das wahre Antlitz des Menschen. Die Toten, »die Fünf«, wie sie in Presse und Internet nur noch genannt wurden, zeigten es. Um es bezeugen zu können, musste er verstehen, was dahinter stand. Nachdem die Fünf tot waren, konnte nur einer ihm dabei helfen, Robert Schönherr. Auch war dort unten im Keller des Klosters noch etwas anderes anwesend gewesen: nicht nur diese Seligkeit, dieser Friede auf ihren Gesichtern, sondern in den Raum war der Tod getreten, der plötzliche, unbarmherzige, allgewaltige Tod. Ja, er hatte ihn erschüttert, und Jens wartete auf den Moment, da er, diese Bilder vor Augen, in Tränen ausbrechen müsste. Aber der Tod, war er nicht selbst der Traurigste von allen? Kein lustvoller Sensenmann, dem die Ernte nicht schnell genug eingebracht werden konnte, eher der unterste Henkersknecht, den jeder Auftrag von denen da oben von neuem erschreckt. Ja, der Tod war traurig.
Die Seligkeit, der Tod, machte das nicht das Maß an Gefühlsstürmen übervoll? Und doch war noch etwas Drittes in diesem Keller zugegen gewesen, versteckt, in die Wände verkrochen, unsichtbar, ungreifbar und gerade so allgegenwärtig: eine Bedrohung. Nein, das war doch Unsinn, es war niemand anderes im Raum gewesen. Jens hatte Robert Schönherr in der letzten Zeit kennengelernt, aber er blieb ihm ein Rätsel. Warum etwa war Robert geflohen? Wovor? Vor einem Nichts? Nein, Jens war sich sicher, nicht Schuldgefühl hatte ihn getrieben, sondern weil diese böse Macht den Raum beherrschte.
Durch ein schmiedeeisernes Tor trat Jens in die großzügige Parkanlage, die die Institutsvilla vor der Welt abschirmte. Ein zentraler Erker und davor eine links und rechts um ihn geschwungene Freitreppe luden den Besucher dazu ein, sich in das Herrengeschoss nach oben zu begeben. Die Fassade, auf die der Weg durch den Park zulief, hob durch reich ornamentierte Stuckatur diesen Mittelbau hervor. Am oberen Ende der Treppe befand sich ein bauchig nach vorne gewölbter Balkon, wie geschaffen für den Auftritt eines Auserwählten vor einer unten versammelten Menge. Die Seiten des Baus waren durch zwei Mauerblenden markiert. Um das Ganze wanden sich Zierbänder mit Engelsköpfen. Jüngst hatte man alles herausgeputzt, tadellos und zu neuem Glanz bestimmt: sorgfältig aufgefrischte Farben in Weiß und Beige und grüne Fensterläden. Das war der große Anspruch des Nymphenburger Schlosses, hier allerdings gewissermaßen auf demokratische Maße zurechtgestutzt: Umso mehr befremdete Jens ein hässlicher Fleck auf der Fassade. Offensichtlich war die Abflussrinne eines Erkers verstopft.
Neben dem Eingang des Instituts hing das Klingelschild aus Porzellan – ein erstes Motiv für seine Kamera. Verschnörkelte blaue Buchstaben verhießen den Eingang zu einer fernen alten Zeit, die es liebte, das zu Sagende zu umspielen. So leicht es auch daherflatterte, war es doch von einem wuchtigen goldenen Rahmen eingefasst, ja bedrängt. Eher zu einer gutgehenden Anwaltskanzlei hätte ein solches Schild gepasst, zumindest machte es dadurch jedem Eintretenden schon beim Herannahen klar, dass die hier gepflegte Wissenschaft alles andere als uneinträglich ist. Das hier ist ein großes Theater, meinte er zu sich. Bin gespannt, was die Stars mir vorspielen werden.
Die Tür im Erdgeschoss war geschlossen, für eine öffentliche Hochschuleinrichtung selbst am Aschermittwoch auffällig. Ohne viel Zuversicht klingelte Jens und starrte in das Fischauge des Türöffners. Er wollte sich schon hinter das Gebäude begeben, um vielleicht dort einen offenen Nebeneingang ausfindig zu machen, da summte die Tür und sprang auf. Vorsichtig schlich er ins Innere. Vor seinen Augen öffnete sich die Eingangshalle, die nach hinten in einen zweiten, inwendigen Treppenaufgang ins Hauptgebäude überging. Auch das war wie das große Schloss im Kleinen: eine prachtvolle Bühne für ein großes Welttheater. Hatten die oberen Zehntausend des Barocks nichts anderes zu tun, als die Stufen herunterzurauschen und sich dabei von unten bestaunen zu lassen? Repräsentation als Lebensinhalt. Oder vielleicht doch gerade so: Sie lebten, um alles zur Leichtigkeit ihrer Lebensweise emporzuziehen, zu dieser fürstlichen Existenz, die sich im Obergeschoss abspielte. Überwölbt war der Raum von einer Kuppel, aus der das Tageslicht ohne Schatten nach unten fiel. Auf halber Höhe der Eingangshalle umschloss ein breiter Umgang das Oval und weitete sich vorne vor der Glastür zum Balkon der Fassade zu einer Art Rondell. Jens stellte sich dort oben eine Rokokodame in Korsett und Reifrock vor, die drinnen im Hauptgebäude, noch verborgen hinter dem Bühneneingang, prüfend an sich herunterblickte, bevor sich die Tür zur Treppe vor ihr öffnete und sie im Abschreiten des Ovals ihres Amtes der Schönheit waltete, das keiner Worte bedurfte.
Vor kurzem, vielleicht erst als das Institut diese neue Bleibe zugewiesen bekommen hatte, hatte man in diese perfekte Architektur radikal eingegriffen. Stockgerade führte eine brandneue Brücke, eng wie ein Laufsteg, vom hinteren Teil des Gebäudes zum Rondell und Balkon. Dieser Verbindungssteg sollte Zeit sparen, vielleicht auch nur den Umgang vor allzu vielen Tritten bewahren, vielleicht gar vor den unvermeidlichen Kritzeleien an der Wand. Metallene Geländer an ihren beiden Seiten mochten allen Sicherheitsvorschriften genügen, erinnerten aber in ihrer reinen Funktionalität an die Tabellenspalten eines Computers und ließen vor der Berührung unwillkürlich zurückschrecken. Ihr graues Metall konnte man sich nicht anders als eiskalt vorstellen. Wie hatten sie dafür nur den Denkmalschutz aushebeln können?
Das Staccato oben herbeieilender Schritte holte Jens aus seinem gedankenverlorenen Sinnieren. Aha, Vorhang auf. Es beginnt der erste Akt: Auftritt des Fräulein von S., Wespentaille über dem gewaltigen Rock und mit gepuderter Perücke, der Gegenstand einer turbulenten Verwechslungskomödie. Oder ist es bloß ein Vorspiel? Eine Nebenfigur, das Stubenmädchen mit dem Staubwedel? Und Jens, war er noch Zuschauer oder bereits Mitspieler? Er trat einen Schritt im Eingangsbereich unter der Loggia zurück, damit er im Halbdunkel nicht zu bemerken war. Eben war noch bloß das Klacken der Schuhe auf dem Flur hinter der Bühne zu vernehmen, da flog schon die Türe auf und aus dem Halbdunkel trat … eine Studentin in Jeans und Pulli, wirklich kein Fräulein von S. Welchen Weg würde sie wählen – den breiten Umgang im Oval oder den Stahlsteg? Ohne zu zögern, betrat sie den Steg – natürlich, sie war ein moderner Mensch. Warum Zeit vergeuden, wenn man ans Ziel gelangen will? Und vor allem: Warum eine Randfigur bleiben, wenn man die Mitte einnehmen kann?
Leichtfüßig bewegte sich die Unbekannte auf dem Steg, sie wehte in den Raum hinein, schwerelos erhoben, beinahe schwebend und fernab jeder Mühsal. Gleich würde sie die Mitte erreichen. Die Magie des Raumes wirkte selbst hier. Jede graue Maus, die auf diesem Weg bloß einen Ordner vom Büro nach draußen getragen hätte, hätte an dieser Stelle alle Blicke auf sich gezogen, vom Licht ohne Schatten aus der Laterne der Kuppel oben besser gekleidet als jede Königin – für einen Augenblick nur, bevor sie dann die Arbeit wieder weggezogen hätte. Ob diese Pulli-und-Jeans-Studentin auch nur ahnte, was auf diesen wenigen Schritten mit ihr geschehen würde? Wirklich, sie verlangsamte ihren Schritt und schaute nach oben, nicht nach unten, so als würde ihr sonst schwindelig, sie schloss die Augen und blieb auf diesem Mittelpunkt stehen. Jens’ unbestechlicher Blick erkannte in diesem Bild, wie begründet sein Unbehagen an dieser Brücke war. Die da in der Höhe befand sich so sehr in der Mitte, in der Mitte nicht nur eines Platzes, sondern auch vertikal eines Raumes, das war zu viel für einen einzelnen Menschen. Durfte man bestimmte Wege nicht bahnen, bestimmte Punkte nicht berühren? Aber was dachte er da? Eben noch hatte sie es genossen, hatte ihren Auftritt zelebriert, als wären die Wände ein großes Publikum. Dann aber schüttelte sie den Kopf, ihre Haare flogen hin und her, als sollten sie etwas abwerfen, und im Nu verwandelte sie sich wieder in eine hübsche Unbekannte. Dann machte sie kehrt und ging vorsichtig ins Hauptgebäude zurück, woher sie gekommen war.
Nach dieser Szene hielt es Jens noch einige Zeit unten im Foyer, bis ihn ein zweites, langanhaltendes Summen an der Tür daran erinnerte, dass jemand im Institut ihn bereits erwartete. Dessen Räume, so las er auf einer Tafel, lagen im ersten Stock. Natürlich, im Herrengeschoss! Wo denn sonst?, dachte er. Er ging die Treppe hinauf und betrat das Hauptgebäude, aus dem die Studentin eben hervorgekommen war. Die Flure waren mit Läufern ausgelegt, darunter lag makelloses Parkett, also alles andere als das, was er sich unter dem Zuhause für ein Orchideenfach wie die Logik vorgestellt hatte. Nachdenklich hielt Jens es auf einigen Bildern fest. Vor ihm stand die Tür zu einem Seminarraum offen. Drinnen sah er die Reste einer Faschingsparty, alles andere als die Noblesse des Flures: auf den Tischen eine Handvoll Gläser, Sektkübel, zertretene Chips, Luftschlangen und eine Maske, die auf einen Flaschenhals gesetzt worden war. Haben sie den Tod der Fünf gefeiert?, kam ihm der Gedanke, ohne zu wissen warum. Robert Schönherrs Arbeitskollegen! Plötzlich war er wieder da, der Augenblick, als er die fünf Toten entdeckt hatte. Gerade erst acht Stunden war es her. Jens, der Nüchterne, hart im Nehmen und im Bildjournalismus an vieles gewöhnt, hatte sich für Minuten an die Wand anlehnen müssen. Dabei hatte er erst die Gesichter der Toten bemerkt. Je mehr er sich traute sie anzuschauen, umso mehr wich die Beklemmung einer Gelassenheit, die ihn seitdem nicht verlassen hatte. Alles war vollkommen still. Mit einem Mal hatte er gemeint, sie riefen ihm etwas zu. Aber was? Er verstand ihre Sprache nicht.
Jens zwang sich zurück ins Hier und Jetzt. Einige Aufnahmen des Durcheinanders im Seminarraum würden ihn ablenken. Da schnaubte es aus einem angrenzenden Raum verärgert. Er trat in die Tür und erblickte ein Büro vom Feinsten: Schränke und Tische aus rotbraunem Kirschholz, ein abstraktes Ölbild, übergroß über die Wand erstreckt, endlose Reihen ledergebundener Bände in den Regalen und auf einem Schränkchen eine Espressomaschine der Nobelklasse. Jens fühlte sich erneut an ein Anwaltsbüro erinnert. Ob die sich überhaupt noch mit normalen Studenten abgeben? Oh nein, dachte er, hier geht es nicht um den gewöhnlichen Studienbetrieb, sicher nicht. Ein Schreibtisch stand mitten im Raum. Ein älterer, sorgfältig gekleideter Herr mit grau meliertem, sanft gewelltem Haar arbeitete am PC. Er widmete Jens scheinbar keine Aufmerksamkeit. Aber er wusste doch, dass Besuch kam. Niemand anderes als er hatte ihm doch unten die Tür geöffnet. Unbeirrt gab er sich mit dem Computer beschäftigt. Jens schätzte ihn auf siebzig Jahre und musterte sein gepflegtes Äußeres, Anzug, Schuhe und Brille von anderen Marken als die seiner Werbeaufnahmen damals, zudem trug er als Blickfang eine Taschenuhr. Langgestreckt hing er im Schreibtischstuhl, nur den Kopf etwas nach vorne gereckt, um den mit fremdartigen Symbolen überdeckten Bildschirm zu beobachten. Neben der Tastatur standen einige gestern wohl nicht restlos geleerte Flaschen mit abgestandenem Sekt. Offenkundig waren sie eben erst aus dem Kühlschrank genommen worden, denn sie waren unten beschlagen. Daneben stand eine Kaffeetasse, die als Glas herhalten musste. Nachdem dieser Herr dem Besucher weiterhin keine Aufmerksamkeit schenken wollte, schnaufte er noch einmal, nahm einen Schluck, drehte sich dann aber abrupt um und redete Jens in einem Ton an, wie man Angestellten im Weiterarbeiten einige Instruktionen erteilt: »Sie haben geklingelt. Sie wissen, hier in der Spitzenforschung haben wir es mit äußerst komplexen Zusammenhängen zu tun. Das Denken muss sich bis zu siebzehn Operationen gleichzeitig vergegenwärtigen können, um zu Schlussfolgerungen zu gelangen. Manche Kollegen haben vor diesem Komplexitätspostulat schon kapituliert, haben sich in merkwürdige Gebilde wie diese …« – er hüstelte beinahe echt – »… diese Fuzzy-Logik geflüchtet. Sie beherrschen eben alle ihre Mathematik nicht mehr. Nun ja, hier haben wir stets seriöse Wissenschaft gepflegt, zumindest unter meiner Institutsleitung. Professor Werner Rautloff mein Name übrigens, er muss Ihnen nichts sagen. Ich weiß, wir Logiker sind die verkanntesten unter den Wissenschaftlern, sozusagen ihre Kartäuser, wenn jemand aus Ihrer Generation damit überhaupt noch etwas anfangen kann. Aber wie ein Logiker sehen Sie ja ohnehin nicht aus. Ja, ich habe Sie sehr wohl bereits betrachtet, auch wenn das nicht den Anschein hatte. Eine meiner siebzehn Operationen war für Sie noch frei, Sie verstehen? Und so unpraktisch ist mein Alter auch nicht. Aber nun frischauf, junger Mann! Ihr Anliegen, klar und knapp! Sie wissen ja, Logik ist die hohe Schule geistiger Präzision.« Bei diesen Worten musterte der Professor Jens unverhohlen und versuchte ihn einzuschätzen.
»Jens Deschwitz, ich recherchiere als Bildjournalist über Robert Schönherr. Ich darf hier doch ein paar Bilder schießen?« Rautloff blickte ihn scharf an. »Robert …? Was wissen Sie von ihm? Für Leute wie Sie gibt es da überhaupt nichts zu recherchieren. Er hat nichts mit diesen … Todesfällen zu tun. Ich, ja ich muss ihm einen Vorwurf machen: Er hat seine enorme Begabung und seine akademische Zukunft versaufen gelassen. Ja, versaufen, ich muss so drastisch werden. In elender Frömmelei, in Illuminatism und Adeptentum, wie Kant sagen würde.« Mit heftigem Schwung wandte Rautloff sich wieder dem Bildschirm zu. Dabei stieß sein linker Ellbogen an eine Flasche, die dadurch ins Wanken geriet. Er wollte sie auffangen, stieß dabei aber nur zwei weitere an, die schäumend ihren Inhalt auf die Schreibtischplatte und den Boden ergossen. Rasch trat Jens hinzu, um zu helfen, aber Rautloff hatte schon sein Taschentuch hervorgezogen und versuchte, die Lache wegzuwischen. »Dieser Unsinn hier sollte am besten ganz verschwinden«, knirschte er. Das Tuch verteilte die Spuren seines Malheurs aber nur gleichmäßiger auf der Tischplatte, und so fuhr er Jens an: »Warten Sie, gleich habe ich wieder alles im Griff.« Das gezwungene Lächeln des Professors hätte Jens’ Passion für Gesichter Nahrung gegeben, dieser plötzliche Durchbruch von etwas ganz anderem hinter der Fassade. Aber er suchte hier ja anderes, noch Wichtigeres. Mit einem Mal kam ihm die Studentin auf dem Steg wieder in den Sinn. Das Chaos nach der Party hatte sie doch sicher auch gesehen. Was hatte sie sich dabei gedacht? Und wen gesprochen? Die Putzfrau, die nun die Kleinigkeit wieder in Ordnung bringen musste, damit ab morgen wieder die reine Wissenschaft herrschen konnte? Rautloff war schon an den Schrank geeilt, um eine Rolle Küchenpapier zu suchen. Er musste hinter einem Stapel herumwühlen, bis er sie gefunden hatte. »Ach, selbst das ist nicht mehr auf seinem Platz! Warten Sie, ich bin gleich bei Ihnen. Einen kleinen Moment noch, ich muss nur den Rechner sperren, mit Kennwort, Sie verstehen? Wenn wir länger als fünf Minuten nicht an einer Datei arbeiten, löscht sie sich sonst von selbst. Ist alles schon passiert, aber immer noch besser, als einem Unbefugten einen Zugang zu eröffnen. Der Neid unter Kollegen ist groß, Sie verstehen?«
Langsam schloss Rautloff den Schrank, wischte die Flüssigkeit weg und wandte sich wieder dem PC zu. In diesem Augenblick tat Jens etwas, wofür er später nie den Grund angeben konnte: Unauffällig schaltete er die Videoeinstellung seiner Kamera ein und richtete sie mit einer geübten Drehung des Handrückens unauffällig auf die Tastatur: Das Kennwort, jetzt war es sein.
Der Professor hatte nichts davon bemerkt. »So, jetzt ist die Arbeit gesperrt. Ja, hier herrscht neuerdings der Sicherheitswahn, dem sich auch der Emeritus beugen muss. Das papierlose Büro, Sie verstehen? Alle Daten, alle Vorgänge, alle Geheimnisse« – er kicherte, so als wäre ihm diese Einsicht erst in diesem Moment gekommen –, »einfach alles ist im Intranet des Instituts abgespeichert. Der allwissende Gott, da haben wir ihn endlich: Er thront auf der Cloud, und aus dem Füllhorn seines Wissens gibt er jedem am Institut seinen Anteil. Ganz entsprechend seiner Verdienste und streng hierarchisch. Sie sehen, nicht jeder Fortschritt ist gleichmacherisch. Robert mit seinem katholischen Fundamentalismus hätte daran seine helle Freude haben müssen.« Schrill lachte er auf, nur um sich gleich wieder zu fangen. Endlich bot er seinem Besucher einen Platz an und begann zu reden, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, die Ellbogen breit über die Armlehnen ausgestreckt und die Augen abwechselnd auf Jens gerichtet und über die Schränke schweifend: »Über meinen Robert wollen Sie also etwas wissen? Da haben Sie gut daran getan, ausgesprochen gut, auf meine Person zuzukommen. Ich, das darf ich doch sagen, ich habe ihn entdeckt, habe ihn gefördert und … dieses schreckliche Unglück wäre nie geschehen, wenn er unter den Fittichen seines Doktorvaters geblieben wäre. Ja, Fittiche hat er dauerhaft gebraucht. Robert ist ein Genie, aber leider auch ein Autist, oder medizinisch genauer, er weist ein Asperger-Syndrom auf – zum Glück nur in einer minder heftigen Form und infolge früher Fördermaßnahmen für nicht Eingeweihte kaum mehr erkennbar. Wissen Sie Bescheid über Autisten? Ach was, ich muss ja zum Glück keine Prüfungsfragen mehr stellen. Womöglich werden Sie mir ohnehin nur das antworten, was ewiggestrige Halbgescheite immer noch meinen: Ein Autist hat eine Mutter, kalt wie ein Kühlschrank, ihm fehlt es in der frühen Kindheit an Zuwendung und so weiter. Deshalb zieht er sich immer mehr in seinen Elfenbeinturm zurück. Manche verblöden dabei, einzelne Wenige bringen es zu Spitzenleistungen oder schreiben Gedichte aus dem Nirgendwo der Seele. Nicht wahr, so etwas Ähnliches schwebt Ihnen doch vor?«
Der alte Professor richtete sich auf und spazierte durch den Raum. Schließlich baute er sich vor Jens auf, gestikulierte, als wollte er seine siebzehn Denkoperationen sichtbar machen, und trat wieder vor ein Regal, um die ledergebundenen Buchrücken prüfend durchzugehen und einen Band herauszuziehen. Jens bemerkte nur vorsichtig: »Ich habe Ihnen ja gesagt, ich fotografiere hier. Ich darf doch mit Ihnen beginnen? Bitte, reden Sie einfach weiter und stören Sie sich nicht daran, dass ich mich währenddessen umherbewege und meine Aufnahmen mache. Für einen Autisten müssen Sie mich ja nicht gleich halten, ich höre Ihnen schon zu.«
Rautloff gefiel es sichtlich, dass Jens seiner Person die ersten Fotos in dieser Reportage widmete: »Nein doch, ich habe Ihnen nur die krudesten Vorurteile über Autismus vorgetragen. Wir Logiker sind von einer Welt aus Vorurteilen umgeben. Wie auch immer, die Wahrheit über diese Behinderung ist viel einfacher – ich habe mich da eingehend kundig gemacht. Nichts da mit Erziehung und Milieu! Es fehlen nur weiße Gehirnzellen. Das sind sozusagen die Straßen zwischen den eigentlichen Teilen des Gehirns, den grauen Zellen. Ja, lachen Sie nur, die grauen Zellen von Hercule Poirot gibt es wirklich. Als Autist weiß man viel, bringt aber seine Vorstellungen nicht zu einem Ganzen zusammen. Sie verstehen? Zum Beispiel kennen sie mehr einzelne Worte als andere Menschen, verstehen aber nur notdürftig die daraus zusammengesetzten Sätze. Sie bekommen deshalb alles mit, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Oder sie entdecken Wortbedeutungen, die sie aber nicht mehr mit den einzelnen Wörtern verbinden können. Wörter und Bedeutungen leben in getrennten Häusern, und dazwischen liegt sozusagen nur Morast. Ich spreche jetzt natürlich nur von den Autisten mit normalem oder überdurchschnittlichem IQ. Leider gibt es daneben noch andere mit kollateralen Hirnschäden und oft schwersten zusätzlichen Behinderungen.«
Trotz Jens’ Beschwichtigung, ihm während des Fotografierens gut zuzuhören, erschien er dem Professor doch wie ein Student, den die langen Exkurse seines Lehrers nur langweilen, und beherrscht und barsch zugleich fuhr er fort: »Aber Robert Schönherr, natürlich, Sie sollen etwas über Robert erfahren. Meine Informationen sind allerdings ausschließlich für Sie bestimmt, bloß als Hintergrund, damit Sie wissen, welche Objekte Sie hier ablichten müssen, Sie verstehen? Wie also ging es zu, als ich Robert entdeckte? Es war vor acht Jahren, am Ende des Wintersemesters, gerade so wie jetzt. Geschichte der Logik, diese Vorlesung war gerade an der Reihe. Das ist hier unsere Spezialität, Sie verstehen? Ich war schon am Ende, Entschuldigung, wollte sagen, ich hatte den Stoff schon weitgehend abgeschlossen. Es fehlte nur noch jenes schwierige Stück von den vierundsechzig möglichen Schlussarten, den Syllogismen. Sie verstehen, Obersatz, Untersatz und Schlusssatz:
Alle Menschen sind sterblich.
Sokrates ist ein Mensch.
Also ist Sokrates sterblich.
Bei jedem dieser Sätze können Sie Aussagen treffen nach dem Muster: alle, keiner, einige oder einige nicht. Diese vier Muster hoch drei Sätze macht vierundsechzig. Sie können also die drei Sätze eines Syllogismus rein mathematisch auf vierundsechzig Arten miteinander kombinieren. Mal vier Figuren nach der Stellung der Begriffe, denn es besteht ein Unterschied zwischen ›Alle Menschen sind sterblich‹ und ›Alle Sterblichen sind Menschen‹. Macht 256 mögliche Syllogismen. Die Sache hat nur einen teuflischen Haken: 237 Spielarten davon erzeugen nur Unsinn. Das heißt, bei diesen 237 reden Sie gescheit daher, produzieren aber erkennbar bloßen Schwachsinn. Bleiben also nicht mehr als neunzehn gültige Schlüsse. Neunzehn gültige zu 237 ungültigen, keine gute Relation! Kein Wunder, dass beim Denken der meisten Menschen nichts Gescheites herauskommt. Jetzt aber aufgepasst! Von den neunzehn gibt es nochmals vier, die sind vollkommen gültig, nur an einer Stelle spielen sie plötzlich verrückt. Vier Normalos mit einer einzigen, verheerenden Neurose sozusagen. Darapti, Felapton, Bamalip und Fesapo, das sind unsere Namen für diese vier Schlussarten. Keine Angst, die brauchen Sie sich nicht zu merken. Diese vier Schlüsse funktionieren nämlich an einer einzigen Stelle nicht mehr: bei nicht-existenten Gegebenheiten, also z. B. bei einem Einhorn, dem Schlaraffenland oder dem Himmelreich, wie geschaffen für metaphysische Zaubertricks, Sie verstehen? Also zum Beispiel Bamalip:
Jedes Einhorn ist pelzig.
Jedes pelzige Ding ist kuschelig.
Darum ist manches Kuschelige ein Einhorn.
So scheint Bamalip die Existenz von Einhörnern zu beweisen. Das ist natürlich barer Unsinn! Wenn Sie nun einen der 237 ungültigen Schlüsse anwenden, dann ist das bloß ein dummer Betrug, sozusagen Lüge als Billigware. Daneben gibt es aber eben auch diese vier neurotischen Normalos, und wenn Sie damit Ihr Spiel treiben, so ist das Markenware, also der exzellente Betrug, die grandiose Lüge mit Köpfchen. Jede Weltrevolution braucht sie, denn sie braucht die Lüge, die wie die Wahrheit aussieht. So lautet etwa der Bamalip des Marxismus:
Der erfolgreiche Klassenkampf verhilft den Proletariern zu ihrem Recht.
Was den Proletariern zu ihrem Recht verhilft, beendet die Klassenherrschaft.
Darum gehört zum Ende der Klassenherrschaft der erfolgreiche Klassenkampf.
Einfacher gesagt: Der Klassenkampf ist unvermeidlich. Damit haben Sie auch die proletarische Revolution, und zwar nicht bloß als blindwütige Empörung der Unterdrückten, sondern als mit kühlem Verstand inszenierten Sprung der Weltgeschichte – denken Sie nur an Lenin. An dieser Stelle in meiner Vorlesung wies ich dann immer nach, warum auch diese Markenware Pfusch ist. Aber die Studenten verstehen das einfach nicht. Die geborenen Herdentiere sind sie, und das wollen Philosophen sein!«
Jens mochte ein solches Schwadronieren nicht und blickte nach draußen in den Schlosspark. Trotz des anhaltenden Regens fanden sich draußen einige Spaziergänger mit Hund, unverdrossene Jogger und sogar zwei ältere Herren, die sich auf einer Parkbank niedergelassen hatten. Sie alle wussten, was sie wollten, ohne von Bamalip auch nur gehört zu haben. Doch unbeirrt fuhr Rautloff fort: »Während ich also vor meinen Studenten dozierte, begann plötzlich einer aus der ersten Reihe laut zu reden, mitten in meinen Satz hinein. Er unterbrach mich nicht eigentlich, es wirkte eher so, wie wenn man in ein anderes Radioprogramm springt. Er sprach einfach, ohne sich auch nur von seinem Sitz zu erheben. Aber was er sagte, mein Gott, das hatte es in sich. Offensichtlich ohne ihn von langer Hand vorbereitet zu haben, trug er einen vierzehnteiligen Syllogismus vor, nach dem der Angriff auf Darapti, Felapton, Bamalip und Fesapo sich selbst widerlegt. Einfach gesagt, schmuggelt er die Aussage ›Das gibt es‹ in rein gedankliche Annahmen ein. Ich erinnere mich noch genau, Robert stellte das anhand dieses Beispiels bloß:
Keine Zauberei verläuft entsprechend den Naturgesetzen.
Jede Zauberei ist eine menschliche Handlung.
Also verlaufen einige menschliche Handlungen nicht entsprechend den Naturgesetzen.
Er wies also nach, dass da eine zusätzliche Prämisse stillschweigend vorausgesetzt wird, nämlich dass es wirklich Zauberei gibt. Im Bereich der reinen Annahmen ist der Schluss dagegen vollkommen gültig – also etwa in einem Harry Potter-Roman. Also nichts da mit einer Neurose. Roberts Darlegung war brillant, unwiderlegbar und zugleich vollkommen schön. Kein Wort zu viel. Die Studenten waren konsterniert. Ich habe sie einfach entlassen, sie konnten das sowieso nicht nachvollziehen. Dann trat ich auf ihn zu und wollte ihm gratulieren. Seine Hand aber rührte sich nicht. Vielmehr stellte er sich mit langsamer, ganz gleichmäßiger Stimme vor: ›Ich heiße Robert Schönherr. Mein Verhalten wird Sie befremden. Bitte, erlauben Sie sich daraus keine Rückschlüsse. Sie wären sicher falsch.‹
Er sprach monoton, beinahe mechanisch, so als wären die Worte einstudiert und schon dutzende Male vorgebracht worden. Dabei sprangen seine Augen ständig hin und her. Mitten in einem Satz schnellte er empor und rannte zur Tafel. Genauer gesagt, es hingen dort zwei Tafeln an der Wand, die man beide hoch und herunter ziehen kann. Dass nun die eine nur halb hinter der anderen verschwunden war, diese banale Tatsache löste doch einen jähen Schrecken in ihm aus. Er gab einen Schrei von sich und zog die obere und die untere Tafel auf genau die gleiche Höhe. Augenblicklich verwandelte er sich in die Ruhe selbst, und als wäre nichts geschehen, griff er nach dem Stift und ergänzte mein Tafelbild. Im ersten Moment dachte ich, er wollte es nach seinen eigenen Darlegungen ergänzen. Nichts, er zog nur alle Striche kerzengerade nach. Später wusste ich, dass bei ihm eine Überwahrnehmung der Umwelt dazu führt, dass er sich nur in ganz geordneten, geraden Verhältnissen wohlfühlt. Und was sein mechanisches Sprechen angeht, das verdankt er einem harten Verhaltenstraining. Ohne es wäre er völlig in sich verschlossen. Uns selbstverständliche Handlungen wie Zuhören, Rücksichtnahme und Einfühlung musste er sich sozusagen aus dem Vakuum heraus beibringen, ohne dass dazu im Gehirn schon entsprechende Funktionen bereitlagen. Nichts davon war ihm selbstverständlich. In jahrelangem intensivem Training hat er es gelernt, gelernt und gelernt. Irgendwie begriff er schon als Kind, dass das der Preis dafür sein würde, um nicht irgendwann als Menschenwrack zu enden. Zum Glück wurde seine Krankheit auch schon früh diagnostiziert und sofort therapiert. Oder eigentlich nicht ganz sofort, sondern erst, nachdem die Ehe seiner Eltern an Roberts Behinderung zerbrochen war. Sein Vater hielt es nicht mehr aus, dass sein einziger Sohn alle Aufmerksamkeit der Mutter in Anspruch nahm. Dabei wirkte Robert ihr gegenüber doch auch fast immer gleichgültig oder sogar abweisend, nicht anders als bei allen anderen. Ich habe seine Mutter nie kennengelernt, aber nach allem, was ich von ihr weiß, ist sie eine bemerkenswerte Frau. Sie trug ihren Sohn förmlich über seine Möglichkeiten hinaus. ›Gib niemals auf und suche immer einen Ausweg!‹, mit diesem ihrem Lieblingswort hat sie ihm ihr Herz vermacht.
Aber keine Sentimentalitäten! Was musste er als Asperger-Kind lernen? Zum Beispiel, dass ein Pullover Fusseln bilden darf, auch wenn dadurch sein gleichmäßiges Muster gestört wird. Oder dass ein Auto manchmal nach rechts und manchmal nach links abbiegt, ohne dass man es vorhersehen kann. Er brauchte immer ein System. Alles sollte vorstellbar ablaufen, nur dann war er glücklich. Löcher, Türen, Klavierdeckel, Trommeln von Waschmaschinen, sie musste er unverzüglich erforschen. Jetzt verstehen Sie auch, woher seine enorme Begabung für Mathematik und Logik rührte. Was für andere nicht zu schaffen ist, war ihm am einfachsten, nämlich Dinge in die kompliziertesten Zusammenhänge einzuordnen. Am schwierigsten war für ihn dagegen die Einfühlung in andere. Sie müssen sich vorstellen, andere Menschen sind für Autisten und Asperger- Patienten wie Zufallsgeneratoren. Erst als Jugendlicher gelang es ihm, sich ein System von einigen hundert typischen Verhaltensmustern einzuprägen. Stufe um Stufe erkämpfte er sich dabei, und schließlich brachte er es vor acht Jahren bis zu uns hier in die Logik. Seinen ersten denkwürdigen Auftritt habe ich Ihnen ja eben beschrieben. Ja, ich muss schon sagen, von diesem Tag an war er mein Lieblingsschüler. Viel mehr als Frederic Brescher, der es mit seinem immensen Geschick vor drei Jahren bis zu meiner Nachfolge gebracht hat.«
»Aber dann war er doch als Student bei Ihnen immer noch ein … Problemfall?« Jens zögerte bei seinem letzten Wort. Augenblicklich verbesserte ihn der Professor: »Problemfall? Robert ein Problemfall? Nein, allenfalls in den ersten zwei, drei Semestern noch. Zuvor hatte er an einer kleinen, familiären Hochschule studiert. Dorthin war er gekommen, weil es dort ein Wohnheim gab, das genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten war. Aus irgendwelchen Gründen wechselte er dann zu uns und wagte den Sprung ins kalte Wasser. Die Studentenmassen an der Uni, das ungeordnete Leben und vor allem die Tatsache, dass er zum ersten Mal ganz für sich alleine lebte, machten ihm natürlich zu schaffen. Aber es dauerte nicht lange, dann waren alle Probleme verschwunden. Sein einziges Ziel war es zu lernen. Sie verstehen, andere passen sich einfach an ihre neue Umgebung an, reagieren auf Gewohnheiten, Erwartungen, Zielvorgaben. Aber sich anpassen, das konnte Robert einfach nicht. Alles musste er verstehen, es sich vorstellen können und im eigenen Kopf rekonstruieren. So registrierte er alles, ordnete es dem Bekannten zu und orientierte daraus sein Handeln. Anfangs gab es noch ein paar Aussetzer, und man konnte hinter seinem Gefühlspanzer deutlich erkennen, wie sehr ihn ein solcher Misserfolg traf. Einmal gab ich ihm hier in meinem Büro mit der Hand ein Zeichen zum Setzen, gerade so wie Sie jetzt hier sitzen, aber er meinte, ich wollte ihn fortschicken. Trotz solcher Rückschläge war er unheimlich zäh und begabt zugleich. Sie glauben gar nicht, wie sehr ein Mensch lernen kann, wenn ihm gar nichts anderes übrigbleibt.«
Wie ausgiebig hatte sich Rautloff mit Robert Schönherr beschäftigt! War es seine Bewunderung für dessen Genie, war es Hilfsbereitschaft gegenüber jemandem, der sich tapfer ins Leben vorkämpfte, war es Vertrautheit, die schüchtern hinter all der Gelehrsamkeit keimt und die sich ihrer selbst erst dann bewusst wird, wenn der andere schon wieder verloren ist? Jens dankte dem Alkohol, Rautloffs Zunge gelöst zu haben. »Und die Promotion? Die Arbeit hier am Institut?«, fragte er weiter.
»Sie war der logisch nächste Schritt. Bereits in seinem fünften Semester hatte Robert Latein gelernt, mit Blick auf eine spätere Promotion bei mir. Sie wissen, wir arbeiten hier historisch, zumindest war das so unter meiner Ägide. Diese ganze formale Logik heute, ihre eigene Mathematik und Mengenlehre, das ist ja alles schön und gut, aber eben doch rein formal. Sehen Sie, noch bis zur berühmten Logik oder die Kunst des Denkens aus Port-Royal vor dreihundertfünfzig Jahren beschäftigte man sich mit der Logik, um gut zu denken, man dachte gut, um gut zu leben, und man lebte gut, um das Ziel des Lebens nicht zu verfehlen. Das ist übrigens ein Sorites, ein verkürzter Kettenschluss. Wie auch immer, manche hielten also unser Institut für logische Grundlagenforschung für hoffnungslos vorgestrig, weil wir nicht unter all diese Jahrhunderte Logikgeschichte einen dicken Strich zogen und darunterschrieben: vorwissenschaftlich. Da staunten die Herren Kollegen nicht schlecht, als wir unsere dreiundzwanzig Bände Corpus inquisitionum logicarum edierten. Es enthält ausschließlich unveröffentlichte Traktate zu den verschiedensten Fragen der Logik aus sieben Jahrhunderten. Dort hinten im Schrank sehen Sie das Opus. Wenigstens das haben sie noch stehen lassen.« Er deutete auf eine Buchreihe, und Jens nutzte die Pause, ihn zu ermuntern, zu Roberts Dissertation zurückzukommen.
»Die Promotion, natürlich, aber Professoren reden gerne immer genau fünfundvierzig Minuten lang, daran müssen Sie sich gewöhnen. Also kurz und knapp, wie es sich für Logiker gehört, der Titel seiner Inaugural-Dissertation: Systembildungsfehler in den logischen Werken Alberts des Großen. Das sagt Ihnen natürlich nichts. Wie sollte es auch? Das Thema wäre für jeden anderen zu anspruchsvoll gewesen. Ihm traute ich es zu, so gut konnte ich mich auf seine Begabung verlassen. Einfach gesprochen, ging es bei diesem Thema um einige auffällige und geradezu stümperhafte Patzer in der ansonsten meisterlichen Beherrschung der Logik durch den großen Scholastiker. Ich hatte längst vermutet, dass Albertus bei diesen seltsamen Aussetzern das Opfer einer mangelhaften Übersetzung der Topik des Aristoteles geworden war. 1997 habe ich dazu schon einmal einen Aufsatz veröffentlicht, eigentlich eher eine bloße Problemanzeige. Seitdem wartete ich auf einen Nachwuchswissenschaftler, dem ich dieses schwierige Thema anvertrauen könnte. Robert bestätigte meine Vermutung auf der ganzen Linie, und das bereits im ersten Jahr. Da hätte er seine Arbeit abgeben sollen. Aber dann geschah es. Anstatt seine Dissertation rasch abzuschließen, verfiel er ins Spekulieren – immer schon der beste Weg ins philosophische Niemandsland. Robert ging von der einfachen Beobachtung aus: Diese Patzer passen überhaupt nicht zu Albertus. Und Sie verstehen ja inzwischen aus Roberts Charakter, dass ihn solche Brüche beunruhigten. Als ich ihn warnte, sich nicht in Spekulationen zu verlieren, war es bereits zu spät. Er hatte sich in Phantastereien verrannt, und im Nachhinein muss ich sagen, damit fing sein Abstieg an. Was reimte er sich da zusammen? Albertus sah in den logischen Brüchen die Spuren Gottes, der in das Weltgeschehen eingreift. Das war zweifellos ein Rückfall in gröbste Mythologie. Warum hat sich dieser Hochscholastiker nicht auf die schlichte Leistung der Logik beschränkt, die Menschen vor voreiligen Schlüssen zu bewahren? Als Dominikaner war er nicht verheiratet, da war ihm wohl mangels Ehefrau die Gefahr voreiliger Schlüsse nicht so vertraut. Nun ja, Scherz beiseite! Stattdessen ein naheliegendes Beispiel. Sehen Sie, Sie sind Fotograf. Da wandern Ihre Augen schon die ganze Zeit auf Motivsuche umher. Ja, denken Sie nicht, ich würde das nicht bemerken, nur weil ich ein Emeritus bin! Nein, denken Sie überhaupt nicht so schnell. Also ziehen Sie hier etwa nicht den Schluss: Die Sektflaschen sind halb leer, also hat dieser Rautloff schon kräftig gebechert. Fehlschluss: nacheinander, also wegen einander! Post hoc, ergo propter hoc! Vielleicht habe ich die Flaschen bereits leer vorgefunden. Vielleicht haben diese betrunkenen Hilfskräfte gestern Abend sie ja auch um den Computer herumgestellt, so wie sie selbst ihren neuen Professor anhimmeln. Oder vielleicht … Sicher meinen Sie, etwas ist logisch, wenn jedes Kind es einsieht. Aber nein, logisch kann etwas sein, was jeder Anschauung widerspricht – denken Sie daran, wie lange sich die besten Geister dagegen gesträubt haben, einzusehen, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt.«
Während er redete, ging er die Buchreihen im Regal durch, strich mit dem Zeigefinger über die Buchrücken, stutzte, griff ein Exemplar heraus, stellte es aber sogleich unmutig wieder an seinen Platz: »Eigenartig, das Fakultätsexemplar seiner Dissertation ist nicht an seinem Platz. Sie verstehen, das ist die Fassung, die ein Promovend zur Begutachtung einreicht. Sie war in seinem Fall viel ausführlicher als das Buch, das er später veröffentlicht hat. Und welch ein Vorwort! Ich habe es sicher ein dutzend Mal gelesen, und jedes Mal bekam ich feuchte Augen. Ja, schauen Sie mich nicht so ungläubig an, den Menschen als Maschine gibt es nur bei La Mettrie. Viel ausführlicher, als es bei wissenschaftlichen Werken üblich ist, aber in seinem Fall mehr als verständlich, hat Robert auf den ersten Seiten seinen Werdegang rekapituliert und nach allen Seiten hin seinen Dank ausgesprochen. Natürlich zuerst mir – und mit welchen Worten! Dann sein Dank an Frederic Brescher – eindeutig ziemlich übertrieben. Damals war Robert meinem zweiten Assistenten völlig ergeben, richtig hörig. Ich dachte zuerst schon … Nicht dass ich Vorurteile hätte, ganz im Gegenteil. Aber ein bisschen unnatürlich war das schon. Die enge Freundschaft der beiden hat ja auch nach der Promotion nicht mehr lange gehalten. Brescher – ich will ja nichts Nachteilhaftes über meinen Nachfolger sagen –, Brescher war ein bisschen zu karrierebewusst, darunter musste die Freundschaft über kurz oder lang leiden. Vergleichen Sie daraufhin dieses Vorwort mit dem in der späteren Buchfassung! Kein Wort mehr von Frederic Brescher! Den Dank an mich hat er dagegen unverändert übernommen. Sie verstehen, das will doch etwas heißen, oder? In der kurzen Zeit ist etwas in die Brüche gegangen zwischen den beiden. Und jetzt ist ausgerechnet das Fakultätsexemplar verschwunden. Seltsam, seltsam! Wir leihen die am Lehrstuhl erstellten Arbeiten doch nicht aus. Die Ordnung fängt im Kleinen an, ein Logiker sollte das wissen. Ich verstehe wirklich nicht, wieso mein geschätzter Nachfolger mit seiner Nachlässigkeit so viel Erfolg hat. Es ist eben die Zeit der wissenschaftlichen Schaumschläger. Projekte, Kongresse, Drittmittel, was für ein aufgeblasenes ABC! Nun gut, aber das mit der Doktorarbeit interessiert mich jetzt doch selbst. Sie kann sich nur noch im Archivraum des Kellers befinden. Der Schlüssel dazu …« Der Professor im Ruhestand fand ihn in einer Schublade, sperrte den Rechner ein zweites Mal und verschwand.
Jens zögerte keinen Moment. Er spielte sich die Videosequenz von eben auf dem Display seiner Kamera vor. Das Bild war zunächst viel zu klein, doch mit der Zoomfunktion gelang es ihm, Rautloffs Finger bei der Eingabe überlebensgroß wiederzugeben. Die Buchstabenfolge war nun zweifelsfrei zu erkennen, zumal der Professor aus seiner nach hinten gebeugten Position die Tasten nur mit ausgestreckten Fingerspitzen berührt und so den Blick nicht verdeckt hatte. B – A – R – B – A – R – A, entzifferte Jens. Barbara? Der Name der Sekretärin, der Starassistentin, der …? Das war herauszufinden. Jens horchte noch einmal nach draußen. Der Professor holte eben erst den Aufzug, er brauchte für alles viel Zeit. Er klickte ein beliebiges Icon an, erhielt aber nur die Meldung »Passwort eingeben«. Er brach ab und besah sich die Icons genauer. Elf Mitarbeiter mit Namen und Bild waren über das Bildschirmfeld verteilt, darunter ganz unten auch Robert. Jemand hatte ihm einen Heiligenschein verpasst. Rautloff dagegen war nicht vorhanden, konnte also eben wohl auch keinen eigenen Ordner geöffnet haben. So vermutete Jens aufs Geratewohl, Rautloff habe den seines Nachfolgers Brescher bearbeitet, wählte ihn an und gab auf Anfrage »Barbara« ein. Das Gesicht des jungen Professors erschien auf dem Bildschirm, abweisend und mit einer Sprechblase aus dem Mund: »Fuck you, damn you!« Falsch kombiniert! Jens überflog die Namen der elf Mitarbeiter noch einmal. Für wen sollte sich Rautloff interessiert haben? Am Aschermittwoch, am Morgen nach der Lehrstuhl-Party, von dessen Amüsements er wohl als Einziger ausgeschlossen geblieben war? Die Zeit lief ihm davon. Wenn nicht Brescher, dann vielleicht Schönherr? Er rief Roberts Ordner auf, buchstabierte »Barbara« als Passwort und erwartete ein zweites Mal die nicht sehr akademische Sprechblase Breschers.
Es gelang. Der Inhalt von Roberts Ordner beschränkte sich allerdings auf drei Dateien: Dissertation, Lebenslauf und … Widerlegung. Rautloff hatte also ganz und gar nicht über seiner eigenen Forschung gesessen, sondern über der Tätigkeit Roberts. Und die vielen Formeln, die vorhin den Monitor bedeckt hatten? Stammten sie womöglich aus Roberts Doktorarbeit? Er klickte die Datei »Dissertation« an. Das Inhaltsverzeichnis zeigte zweihundertfünfzig Seiten an. Er blätterte in das Vorwort. Es war genauso, wie Rautloff es eben beschrieben hatte, nur dass der Dank Roberts an Rautloff als Doktorvater eigentlich eher förmlich wirkte. Umso auffälliger waren die überschwänglichen Worte über Frederic Brescher, damals noch sein Mitassistent. Das war also die ominöse Fakultätsfassung. Und wer war Barbara? Der Aufzug rührte sich wieder. Jens blieb nur eines. Jens klickte nach der »Dissertation« die »Widerlegung« an. Aber das war ja nur eine Backup- Datei! Er schaute im Papierkorb des PCs. Exakt, da fand sich noch das Original. Er mailte sie sich zusammen mit den anderen beiden Dateien zu. Rasch kamen die Schritte auf dem Flur näher. Hastig löschte er die Mail im Ordner »Gesendet«. Er wusste, das verwischte nur seine Spuren, beseitigte sie aber nicht. Er konnte den PC gerade noch sperren, ans Fenster springen und zur Verschleierung seines Tuns mit der Kamera irgendein Objekt hinter der Villa fixieren.
»Nicht zu finden«, begann Rautloff schon im Hereinkommen. »Eigenartig, völlig unerklärlich und natürlich gegen die Regeln. Aber so ist das inzwischen hier. Unbeschreibliche Zustände! Die Universitätsleitung und das Ministerium lassen sich nur von den eingeworbenen Drittmitteln blenden. Zu dumm, aber hier auf dem PC ist die Fakultätsfassung auch nicht.« Jens blickte Rautloff nach dieser offensichtlichen und zudem noch überflüssigen Lüge in die Augen. Dieser wandte seinen Blick gleich nach draußen und hatte es jetzt auch sehr eilig. »Nun gut, dann kann ich wohl auch nichts mehr für Sie tun. Schicken Sie mir eine Kopie Ihres Berichtes für die … Sie arbeiten doch für die Zeitung, oder? Ist ja auch gleich. Hier meine Karte, schicken Sie eine Kopie unbedingt zu mir nach Hause. Ich habe noch eine Menge Arbeit hier, Sie verstehen.« Bei dieser hastigen Verabschiedung wusste Jens, dass das Institut für logische Grundlagenforschung noch längst nicht alles preisgegeben hatte.
In seinem Beruf kam Jens ja an viele verwunderliche Orte. Aber Logik? Dass etwas Derartiges es überhaupt bis zur Wissenschaft gebracht hatte, die man ein Leben lang erforschen konnte, dass es jetzt unter Breschers Ägide sogar einflussreiche Förderer gab, die dem Institut das feinste Gebäude der ganzen Universität reserviert hatten, und dass es auch noch potente Geldgeber gab, die für diese Forschung elf Mitarbeiter finanzierten, das schien ihm einfach … unlogisch. Selbstverständlich, sauber zu denken, dafür war sein nüchterner Geist durchaus zu haben. Aber dazu brauchte man doch keinen Tross von Logikern. Entweder war etwas wahr oder es war falsch. Und dieses Etwas musste etwas Handfestes sein wie die Banane in der Hand eines Schimpansen, etwas Materielles eben, für diese Voraussetzung war er noch alter DDR-Bürger genug, alles andere war weder wahr noch falsch, sondern idiotisch. Waren diese Uni-Logiker also allesamt Idioten? Aber Prunk, Jobs und Geld, das waren sehr handfeste materielle Werte, und wenigstens so viel hatte er in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten nach der Mauer gelernt, dass in der schönen neuen Welt nicht das Gute zählte, sondern das, was gut schien.
Inzwischen hatte Jens das Ende des Flurs erreicht. Er stieß die Tür zur Eingangshalle auf. Ihre Pracht wirkte jetzt fremd, der Gegensatz zwischen Stuck und Stahlsteg sprang nur umso mehr in die Augen. Vorsichtig betrat Jens den Steg und ging bis zur Mitte vor. Der magischen Mitte, hoch über dem Foyer und eingehüllt in das schattenlose Licht aus der Laterne von oben. Nein, er war noch nicht so weit und lief zurück. Langsam stieg er die Treppe zum Foyer hinab, Stufe für Stufe, bis ins Halbdunkel, genau an die Stelle, an der er sich vorhin vor der Studentin verborgen gehalten hatte. Ja, so viel war klar, zwischen Brescher und Schönherr war irgendetwas faul. Die Geschichte mit den zwei Vorworten seiner Dissertation sprach da eine zu klare Sprache. Frederic Brescher, zuerst Roberts bester Freund, dann sein bester Feind – da hatte sich ein Drama abgespielt. Aber was war seine Handlung? Hatte Brescher Roberts Asperger-Syndrom als seine Chance erkannt, um dessen Intelligenz anzuzapfen und ihn dann fallenzulassen? Nein, der Umschwung in der Beziehung beider ging von Robert aus. Ohne Anlass und einfach so, als Stimmungswandel eines Menschen, dem es ohnehin schwerfiel, Beziehungen aufzubauen? Das war unwahrscheinlich; jemand so Rationales wie Robert würde nie ohne einen Grund handeln. Da war dann natürlich auch noch Barbara. War sie der Schlüssel zu allem? Oder nur ein Phantom? Einzelheiten, Andeutungen, Hinweise – was war damit anzufangen? Bei seinen Nachforschungen war Jens an diesem Ort keinen Millimeter weitergekommen. Also noch einmal: Es galt nicht, einfach alles Mögliche über Robert Schönherr herauszufinden, sondern … sondern was? Die Logik begann offensichtlich bereits in ihm ihre Wirkung zu entfalten. Er durfte sich nicht auf die bloßen Fakten konzentrieren, sondern auf deren Zusammenhänge. Wie also war das alles abgelaufen? Robert Schönherr kam vor acht Jahren an diese Universität, nachdem er vier Semester bereits anderswo verbracht hatte. Am hiesigen Ort schrieb er sich in Philosophie ein, spezialisierte sich in Logik und arbeitete bald auch als Hilfskraft an diesem Institut. Vor fünf Jahren schloss er sein Studium ab und begann die Promotion, bewundert und gefördert von Rautloff, der ihn auch zu seinem ersten Assistenten machte. Moment, gibt es das eigentlich, erster, zweiter, dritter Assistent? Oder beschreibt es die Herzensnähe zum Professor? Und noch vorher: Wieso wechselte er von der familiären Kleinhochschule mit spezialisiertem Wohnheim nach München? Dann wäre er jetzt also vielleicht achtundzwanzig Jahre alt. Warum aber dieser Wechsel? Wollte er ins kalte Wasser springen? Oder musste er es? Rautloff, Brescher, Barbara und sie alle am Institut, er scheint sie erst hier kennengelernt zu haben. Und dann der heißeste Punkt, diese Freundschaft mit Frederic Brescher und ihr plötzlicher Bruch. Wie hatte Rautloff Roberts Haltung bezeichnet? Er sei Brescher völlig ergeben gewesen, richtig hörig. Und dann auf einmal Eiszeit. Wann war was? Offenbar kurz nach der Annahme seiner Dissertation, also vor drei Jahren. Jemanden im Vorwort gar nicht mehr beim Dank zu erwähnen, das spricht von einer tiefen Verletzung. Eine der üblichen Beziehungskisten? Nein, nicht bei Robert. Da ist etwas, und es ist heftig, sonst hätte es nicht zum Bruch geführt. Genau an dieser Stelle fehlt der Zusammenhang, und alles Weitere kommt über vage Vermutungen nicht hinaus. Gleichzeitig machte Brescher Karriere, beängstigend schnell, und Robert wurde fromm. Ein so jäher Umschwung muss eine heftige Ursache haben. Entschlossen drückte er den Griff der Tür nach außen herunter.