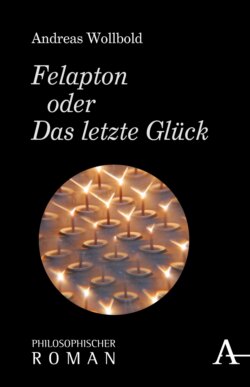Читать книгу Felapton oder Das letzte Glück - Andreas Wollbold - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеViertes Kapitel Worin Jens und Julia erstaunlich unverdächtig ins Gespräch kommen
Draußen vor der Villa knöpfte sich Jens die Jacke zu und zog die Fototasche über die Schulter. Da huschte eine junge Frau an ihm vorbei die Stufen zum Eingang hinauf und verschwand drinnen. War das nicht die Jeans-und-Pulli-Studentin, die er vorhin auf der stählernen Brücke gesehen hatte? Offensichtlich hatte sie zwischenzeitlich das Gebäude verlassen. Warum betrat sie es jetzt wieder in solcher Eile? Nur eine Sekunde lang hatte er ihr Gesicht erblickt, glühend. Vor Erregung, Anspannung, Vorfreude? Etwas von allem und noch viel mehr, sagte ihm ihre Miene. Ja, die unerschöpfliche Sprache des wahren Antlitzes des Menschen! Gleichzeitig wirkte sie auch übermütig. Selbst damit war ihr Gesichtsausdruck noch nicht erschöpft. Anderes lag noch darin, etwas Tieferes. Er wollte es ergründen. Was war es? Natürlich, sie war hübsch und herzerfrischend, aber sonst? Ein dunkelbrauner Pferdeschwanz fiel ihr auf die Schulter, und vom Regen waren ihre Haare feucht. Ihre Ohren standen ein wenig ab, aber eine straff darüber gelegte Strähne verdeckte, was sie beim Blick in den Spiegel ärgern mochte. Umso liebenswerter waren ihr Züge. Selbst im Audimax würden die über die Hörerschaft wandernden Blicke eines Professors unweigerlich von ihnen angezogen.
Das Bild eines Augenblicks, sicher, nichts weiter. Doch noch etwas geschah. Zum zweiten Mal innerhalb einer Stunde traf Jens eine Entscheidung, ebenso weitreichend wie sein Ausspionieren von Rautloffs Passwort, aber ganz ohne Überlegung, nur aus dem Moment heraus: Er müsste sie offen auf ihre Absichten ansprechen. Ist sie vielleicht Barbara?, spekulierte er. Er musste es herausfinden. Lautlos hielt er die Eingangstür kurz vor dem Einschnappen ins Schloss fest, sodass er die Villa jederzeit wieder betreten könnte. Durch ein Glasfenster sah er noch, dass sie sich zur Toilette rechts im Foyer begeben hatte. Unmöglich konnte er jetzt selbst einige Minuten im Eingangsbereich auf und ab gehen, um sie dann gleich neben der Toilettentür anzufallen: »Sind Sie Barbara? Was wissen Sie von Robert?« Nein, er musste aus ihrem Gesichtskreis verschwinden und die Villa und ihren Park verlassen, ohne sie jedoch aus den Augen zu verlieren.
An diesem wintertrüben Tag war der weite Vorplatz des Nymphenburger Schlosses beinahe menschenleer. Jens sah sich um. Nur gut zwanzig Meter entfernt befand sich ein schmuckloses Gebäude mit einer dunklen Toreinfahrt. Der ideale Beobachtungsposten, wie geschaffen für ihn. Von hier aus war im Obergeschoss das Büro des Instituts zu sehen ebenso wie der Eingang der Villa. Rautloffs Getue dort oben und Barbaras Verlassen der Villa könnte er problemlos registrieren. Jens richtete sein Teleobjektiv auf das Fenster des Institutsbüros. Der Emeritus machte es ihm leicht und hatte das Licht eingeschaltet. Gerade griff er nach einem Ordner in der obersten Reihe des Aktenschrankes und trat an den Kopierer. Jens’ Kamera hielt alles fest. Danach verschwand er aus dem Raum, betrat ihn aber bald wieder mit einer blau gebundenen Arbeit in der Hand. Roberts Dissertation? Er trug sie zur Gartenseite des Raumes hin, sodass er aus dem Blickfeld verschwand. Jens wollte schon aufgeben, da erschien er ein zweites Mal am Kopierer und legte ein einzelnes Blatt auf. Danach verschwand er wieder im Hintergrund. Irgendwann wurde das Licht gelöscht, aber Rautloff erschien nicht in der Eingangstür. Trank er jetzt wieder?
Jens erschrak. Das Portal des Instituts war mittlerweile ins Schloss gefallen, daran ließ ein Blick durch sein Teleobjektiv keinen Zweifel. Leise hatte es irgendjemand zugedrückt, während er nach oben gestarrt hatte. Barbara? Der Professor? Sonst jemand aus dem Gebäude? Die Villa besaß zum Garten hin einen weiteren Ausgang, wie ihm vorhin beim Hinausschauen aus dem Bürofenster aufgefallen war. Wenn er das Haus umschritt, könnte er vielleicht die Hintertür offen finden? Er raffte seine Tasche vom Boden auf und ging an der Mauer des Gebäudes entlang. Er eilte, rannte, wusste nicht weshalb, es war alles wichtig, er durfte nichts verpassen. Nichts mehr. Der Hintereingang war verschlossen. Wohin? Noch außer Atem, schaute er sich unschlüssig um. Nichts. Er trottete zurück. War er vielleicht einem Irrtum aufgesessen? Ein Windstoß konnte das Haupttor zugedrückt haben, oder irgendein anderer konnte eingetreten sein. Langsam entfernte er sich von der Villa. Da hinten bog die Straßenbahn um die Ecke. Da, die Studentin! Aus dem Unterstand trat sie hervor, löste mit abgezähltem Geld aus dem Automaten eine Fahrkarte und stieg durch die hintere Tür ein. Er hatte keine Zeit zu verlieren, überquerte die Straße und gab dem Fahrer ein Zeichen zu warten. »Wir nehmen auch noch den letzten verbummelten Hallodri mit«, wurde er eingelassen. Hallodri? Wirkte er so heruntergekommen? Im hinteren Wagenteil erspähte er die Studentin. Sie saß auf der linken Seite gegen die Fahrtrichtung und starrte auf die Toreinfahrt, die ihm noch vor wenigen Minuten Sichtschutz gewährt hatte. Er spionierte im Institut herum, soviel wusste sie nun sicher. Im nächsten Moment erhob sie sich schon wieder, trat bei der nächsten Station zum Ausgang und verließ die Bahn. Jens setzte ihr nach, nur dass er vorne ausstieg. Sofort wechselte er auf die andere Straßenseite und suchte Schutz hinter einem Lieferwagen. Er spähte hervor. Nichts, sie war verschwunden. Auf offener Straße. Respekt, Mädchen! Jetzt stand er alleine da. Nein, er taugte nicht zum Agenten. In Zukunft fotografiere ich nur noch Stillleben, dachte er. Er trottete los, versuchte, sich auf Rautloff, Brescher, das Institut und die drei Dateien Roberts zu konzentrieren. Diese Ausbeute war immerhin schon ansehnlich, und das Mädchen würde ihm irgendwann schon noch einmal über den Weg laufen.
»Warum verfolgen Sie mich?« Die scharfe Stimme hinter ihm ließ ihn zusammenfahren. Die Studentin hatte ihm selbst hinter einem Wagen aufgelauert.
»Ich verfolge Sie?« Er hatte sich wieder gefasst. »Ich glaube, Sie verwechseln da was. Immerhin fallen Sie einen Passanten auf offener Straße an und beschuldigen ihn mir nichts, dir nichts.«
»Was haben Sie mit der Klostergeschichte zu tun?«, attackierte sie ihn jedoch weiter.
Das war zu direkt. Der Meister des tastenden Blicks verstummte und erforschte ihr Gesicht. Als erstes sprang ihn daraus der Zorn an, auch der kaum überwundene Schrecken darüber, verfolgt zu werden. Noch etwas anderes lauerte darin, so als wollte sie ihn vor sich warnen. Währenddessen gingen Jens’ kleine dunkle Augen bereits auf ihr Mienenspiel ein.
»Jens Deschwitz, freischaffender Fotograf«, stellte er sich vor. »Ich bin es, der die fünf Toten im Kloster gefunden und die Polizei alarmiert hat. Jetzt gehe ich einer Spur nach, die in dieses Institut da drüben führt. Aber nicht dass Sie denken, ich tue das im Auftrag irgendeiner Zeitung. Ich recherchiere auf eigene Faust. Also, dieser Schönherr hat in diesem Institut einige Jahre als Assistent gearbeitet.« Erwartungsvoll schaute er sie mit weit geöffneten Augen an, und sie erwiderte seinen Blick mit jener Spur von Überraschung, mit der nur ein junger Mensch ein außergewöhnliches Vorkommnis als die gewöhnliche Sprache des Lebens verstehen kann. Er blickte sie an und wünschte sich, dass sie sich nicht schon im nächsten Moment wieder abwenden würde.
»Fotograf sind Sie? Na, wie James Bond sehen Sie ja wirklich nicht aus. Bestimmt sind Sie in die Geschichte nur zufällig so hineingestolpert.« So war er denn für sie nur eine kleine Portion, ein Stolperer durchs Leben ohne Plan und Ziel? Doch ihr Ton war so ehrlich, dass alles andere bloß Heuchelei gewesen wäre. Doch dann fügte sie noch einen Satz hinzu, einen entscheidenden Satz: »Sie waren sicher ganz selig beim Anblick dieser Gesichter im Kloster – genau wie ich.«
Ihnen beiden war also das Gleiche zugestoßen, der Anblick von Seligen. Da war es doch nicht so wichtig, dass sie ihn behäbig fand. Wie von ihrem letzten Satz aufgestachelt, löste sich seine Trägheit auf, und seine alte Entschlossenheit regte sich wieder. »Genau wie ich? Sie meinen, Sie waren ebenfalls in diesem Keller? Meine Fotos können Sie ja noch nicht zu Gesicht bekommen haben.«
»Ganz recht, ich war heute vielleicht nur eine Stunde nach Ihnen am Ort. Ich absolviere derzeit ein Praktikum bei der Gerichtsmedizin. Mein Studium, mein Physikum … Nein, ich will Ihnen nicht gleich alle meine Katastrophen verraten. Oder doch? Dem, der wie ich diese Gesichter gesehen hat? Selig sind die Toten. Meine Großmutter ist vor drei Jahren gestorben, und da stand dieser Satz auf ihrem Totenbildchen.« Themen und Erinnerungen überschlugen sich bei ihr, so erregt war sie noch. »Jedenfalls bin ich vorhin in der Villa herumgelungert, aufs Geratewohl. Auf irgendeinen Hinweis würde ich schon stoßen: ein Hausmeister beim Wechseln einer Leuchtstoffröhre, eine indische Putzfrau mit ihrem Wägelchen – sie war so klein, dass ich sie zuerst gar nicht dahinter entdeckt habe – und ein Student, der auf seine Nachholprüfung wartete. Mit ihnen habe ich ein bisschen geplaudert und dabei so manches erfahren. Die ewige Frauenmethode! Ach, was für zusammenhangloses Zeug erzähle ich Ihnen da! Sie halten mich sicher für eine überdrehte Schnepfe. Zuerst meine Spionage in dieser Villa, dann dieses Ein- und Aussteigen in der Straßenbahn und jetzt diese wirren Geschichten.«
»Ach nein, machen Sie sich doch nicht selbst schlecht! Sie haben recherchiert und beobachtet, und obendrein besitzen Sie noch die Gabe, nur so zufällig durchs Leben stolpernde Fotografen aus der Reserve zu locken.«
»Oh, Herr Deschwitz!« Wiederum lachte sie, sehr natürlich, sogar mit ein wenig Anmut. Warum blieb sie ihm gegenüber nicht misstrauischer? Musste dieser fünffache Tod ihr nicht als grausames Verbrechen erscheinen? Und darum die Welt voller Verdächtiger, darunter Jens, der Wildfremde, als Hauptverdächtiger? Da müssten bei ihr doch alle Alarmglocken läuten. Aber umgekehrt, warum brachte er nicht wenigstens den Willen zu eben diesem Misstrauen ihr gegenüber auf? Stattdessen ließ er sich von etwas so Irrationalem wie Gesichtern benebeln – zuerst von diesen fünf Seligen und jetzt auf ganz andere Weise auch von ihr? Erst recht in diesem Augenblick konnte er dieser Unbekannten nichts Böses zutrauen, und dabei kannte er noch nicht einmal ihren Namen. Schon machte sie ihm einen Vorschlag: »Ich sehe, wir haben uns einiges mitzuteilen. Ich besitze ein paar interessante Puzzleteile, habe aber noch keine Ahnung vom Bild. Sie haben drüben in der Villa ein paar andere Teile erkundet, vielleicht passen sie ja zu meinen. Also, keine Widerrede! Das Café dort drüben hat geöffnet. Da legen wir alle unsere Teile auf den Tisch. Alle, sage ich, also keines wird unter dem Tisch gehalten. Keine Täuschung, keine Tricks, alles muss stimmen. Ja, ja, zwei, die sich gegenseitig verfolgen – wir sind schon filmreif.«
Das Café war nicht mehr als ein Backshop mit einigen Tischen im Nebenraum. Es genügte. Nun saßen sie einander gegenüber. Die Studentin wirkte unversehens verlegen, so als habe sie mit der Jacke auch ihre Angriffslust abgelegt. Sie vertiefte sich in die kaum nennenswerte Speisekarte. Unvermittelt warf sie den Kopf in den Nacken. Aus ihrem Blick sprachen Neugier und – das traf den Fotografen schmerzlich – Mitleid. Aber nein, sie wollte sich damit nur selbst starkmachen. Oh ja, das wahre Antlitz des Menschen, es war schwerer zu verstehen als Ungarisch oder Finnisch! In Wirklichkeit schien sie von Selbstzweifeln geplagt: Was tue ich eigentlich hier? Einmal gestellt, wurde diese Frage zu einem Gespinst von Gefühlen, sodass sie sich nur durch einen gedankenverlorenen Blick aus dem Fenster retten konnte. Jens tat vorsichtshalber das Gleiche. Passanten, Fahrzeuge und wenige Fahrräder zogen von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links, konturlose Schatten im Regengrau, sodass das Hin und Her einem Daumenkino glich, das vorwärts und rückwärts läuft. Vor diesen Schemen spiegelte sich ihre eigene Gestalt im Fenster, reglos, feststeckend zwischen eng gestellten Tischen und Stühlen, dabei jedoch von guter Figur, klugem Gesicht, blühend in ihrer Jugend und sicher von Haus aus verwöhnt. Alle Wege standen ihr offen, niemals hatte sie etwas anderes erfahren. Ja, schnurstracks war sie auf dem Stahlsteg bis zur Mitte des Raumes vorgeprescht. Und dann? Dann hatte sie etwas erfasst, das hatte die Macht, ihren Gang anzuhalten. War es das Licht von oben aus der Laterne der Kuppel gewesen? Zögernd hatte sie sich wieder zurückgezogen, immer weiter zurück bis zu diesem öden Ort hier, dessen größte Verlockung der Coffee-to-go war, und vertrieb sich die Zeit mit ihm, dem Fremden, einem Schweiger und geborenen Randsiedler des Lebens.
»Womit fangen wir an?«, fragte sie schließlich in das Schweigen hinein und wandte ihm ihr Gesicht wieder zu, indem sie die Gespenster im Kopf mit einer raschen Drehung des Kopfes zu verscheuchen suchte. Jens’ dunkles Timbre hatte sie für ihn eingenommen.
»Beginnen wir doch mit Ihrem Namen. Ich weiß ja nicht einmal, wer Sie sind.« Jens fasste sich ein Herz, um die Initiative wiederzugewinnen.
»Ein guter Anfang, wirklich. Julia Obersieder heiße ich und bin dreiundzwanzig Jahre alt – über mein Alter haben Sie ja sicher schon die ganze Zeit herumgegrübelt. Eine Bedingung: Keine Fragen zu dem, was ich in diesen dreiundzwanzig Jahren bisher gemacht habe! Dann gibt’s nur: Und tschüss!« Schon wieder blitzte diese Schärfe auf. Vor Jens’ Augen baute sich ein Phantasiebild auf: Julia Obersieder saß zwischen Stapeln von Fotos und Dokumenten. In ihnen war jeder einzelne Tag ihres bisherigen Lebens festgehalten. Jens stand daneben und zog in ahnungsloser Neugierde ein an einer Ecke herausragendes Bild hervor. Im gleichen Augenblick stürzten die Berge des Geschehenen über ihr zusammen. Jens schloss seine Augen und sinnierte: Leben wir so lange, bis der Turm unserer Erinnerungsbilder über uns zusammenbricht? Mit allem, was war? Oder leben wir sogar höchstens so lange? Still betrachtete er das Mädchen, und sein Schweigen tat ihr gut. Es war nicht von der Art, sie zu verletzen.
Schließlich begann sie: »Wenigstens so viel dürfen Sie von mir wissen. Mein Studium habe ich vor kurzem erst mal geschmissen. Medizin. Vor dem Physikum. Bin einfach nicht mehr zur Prüfung gegangen. Das Warum ist aber tabu, verstanden? Das Beste, was ich eben in meinen dreiundzwanzig Jahren gelernt habe, ist, ein Pferd so in die Seite zu zwicken, dass es mich beim Ausschlagen nicht mit den Hufen trifft. Und einen Klavierdeckel so zuzuschlagen, dass drinnen alle Saiten dröhnen. Jedenfalls bin ich jetzt mit einem Verlegenheitspraktikum in der Gerichtsmedizin gelandet. Da wollte eben keiner hin. Fast so schlimm wie Anatomie. Meine Eltern haben mich ziemlich lange bearbeitet, überhaupt noch etwas zu machen, aber eine Medizinerin ohne Zwischenprüfung kommt gar nicht erst an die begehrteren Praktikumsstellen heran. So, das genügt. Und jetzt Sie! Aber nuscheln Sie nicht so in Ihren Bart hinein, als würden Sie eine Tüte aufblasen, das mag ich nicht.«
Jens lächelte. Er liebte eine solche Art, flink ein Netz aus Kommandos, Regeln und Abmachungen zu knüpfen. Vielleicht weil es eine längst verlorengegangene Ordnung der Welt nachahmte. »Ich akzeptiere alles!«
Von neuem lachte sie: »Von Ihnen hätte ich auch gar nichts anderes erwartet. Und jetzt los, wie sind Sie überhaupt in dieses Kloster gekommen? Sie waren da doch nicht zum ersten Mal, oder?« »Da« sagte sie dezent, und Jens schätzte das.
»Oh, es fing an mit diesen beiden Klosterschwestern. Religiös gebunden bin ich ja nicht. Ich komme aus dem Osten, aus Zwickau, da ist das eben so. Aber vor vier Wochen erzählte mir ein Freund von einem Kloster, in dem nur noch zwei alte Nonnen in einem riesigen Haus auf ihr Ende warten. Diese Betschwestern wissen genau: Wenn sie sterben, dann stirbt auch ihre Welt. Noch aber leben sie und lassen sich da nicht hinausdrängen. Nicht aus dem Kloster und nicht aus dem Leben. Keine Lust auf ein sanftes Sterben, auf Sterbehilfe soft. So verbringen sie weiterhin jeden Tag fünf Stunden in der Kirche. Ganz schön viel, nicht? Meistens singen sie da, mit dünnen, aber deutlichen Stimmen, immer auf dem gleichen Ton. Einmal singt die eine, dann wieder die andere und manchmal auch beide zusammen. Das ist die einzige Abwechslung. Es ist endlos, will gar nicht mehr aufhören. Sehen kann man sie nicht, sie befinden sich in einem von der Kirche rechtwinklig abgespreizten Nebenraum. Beim ersten Besuch habe ich mich erst einmal eine halbe Stunde lang still in die Bank gesetzt. Da kam mir die eigenartige Frage: Verändert dieses ewige Singen den Raum? Kann man das den Steinen ansehen? Eine kauzige Fotografenfrage, ich weiß, eine Frage von jemandem, der sich gerne hinter seinem Bart versteckt. Aber ob Sie es glauben oder nicht, irgendwann gab es keinen Zweifel mehr: Es ist dem Raum anzusehen. Meine Fotos enttäuschten mich dann allerdings. Nichts von dieser geheimnisvollen Verwandlung war darauf zu erkennen. Ich kam wieder. Beim dritten Mal, als ich gerade die Lichtverhältnisse prüfte, trat Robert Schönherr auf mich zu. Er lebte ja mit seinen Fünf in einem Trakt des Klosters.«
»Robert Schönherr, wie war er? Wie wirkte er?« Julia beugte sich vor, ihre Augen weiteten sich, sie neigte ihren Kopf zur Seite, bis ihr eine Strähne in die Stirn fiel.
»Wie Robert war? Jemandem wie ihm bin ich noch nie begegnet. Es war vom ersten Moment an zu spüren, nichts, was er sagte, dachte und tat, lief gedankenlos ab, bloß aus Gewohnheit, aus Anpassung, als Weg des geringsten Widerstands. Alles geschah nur, wenn er wusste, dass es richtig ist.«
»Oh je, Sie reden jetzt so schrecklich aus der Distanz, als würden Sie die Welt nur aus Ihren schwarzen Tüchern heraus anschauen, die ihr Fotografen doch früher an euren Riesenapparaten über den Kopf gezogen habt. Bitte nicht, ich will mir Robert Schönherr richtig vorstellen können. Hat er Sie sofort angesprochen oder Ihnen erst einmal die Hand auf die Schulter gelegt? Schaute er Ihnen in die Augen oder wanderte sein Blick ständig umher? Mochte er Sie?«
Jens ließ sich nicht gern unterbrechen und noch weniger korrigieren. Wenn er überhaupt einmal ins Sprechen kam, dann dozierte er am liebsten. Doch Julias Einwurf verstimmte ihn nicht. Sie wollte ja einfach etwas mehr aus ihm herauslocken, und dafür war er kein leichter Fall. Ein besonderer Fall für ihn war aber auch sie: Schlicht gesagt, er mochte sie. »Dann lassen Sie mich mal aus meinen schwarzen Tüchern hervorkriechen. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Das erste, was ich an Robert Schönherr bemerkenswert fand, war seine Aussprache. Er sprach ganz bedächtig, ich dachte zuerst, er sei ein Ausländer. Jede Silbe war fein artikuliert, aber wie in einem Sprechgesang, immer auf der gleichen Tonhöhe.«
»Also ein Singsang wie bei diesen Schwestern, bei ihrem Gebet, von dem Sie so begeistert waren?«
»Tatsächlich, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Erst später habe ich begriffen, so zu sprechen, ist bei ihm das Ergebnis eines langen Trainings. Von seiner Krankheit wissen Sie ja wohl schon?«
»Asperger, ja, das habe ich heute Morgen schon bei den Ermittlungen im Kloster aufgeschnappt. So hat man jedenfalls vermutet. Als verhinderte Medizinerin könnte ich Ihnen jetzt die ganzen Symptome herunterbeten. Ich weiß auch, dass dabei in den ersten Lebensjahren ganz oft falsch diagnostiziert wird und ein Kind dadurch ein Leben lang abgestempelt ist.«
»Asperger, genau. Der alte Professor Rautloff hat es mir eben lang und breit erklärt.«
»Dabei aber hoffentlich nicht vergessen hat, zu erwähnen, dass ein Asperger-Syndrom sich zwar ähnlich wie Autismus äußert, aber ganz anders zu behandeln ist. Da werden große Fehler gemacht. Und wenn da die Verwechslungsgefahr nicht schon groß genug wäre, gibt es daneben auch noch die frühkindliche Depression. Vor allem depressive Begleitsymptome sind viel häufiger als Autismus, soziale Kontaktstörungen noch mehr, etwa Trennungsangst von der Mutter und eine daraus folgende Kitaphobie. Das hat etwa jedes zwanzigste Kind, bei mehr als der Hälfte noch verschlimmert durch eine Angsterkrankung der Eltern, die sie ihrem Kind vererbt haben und durch ihren Erziehungsstil auch noch verstärken. Außerdem ist Asperger wahrscheinlich gar nicht eine einzelne Krankheit oder Behinderung, sondern es gibt ganz unterschiedliche Auslöser und Symptome. Neuerdings etwa Antibiotika in der frühen Kindheit und eine infolgedessen gestörte Darmflora. All das fassen unsere Herren Doktoren dann hilflos unter einem Etikett zusammen. Ganz unterschiedliche Diagnosen also, aber nach außen hin ein ganz ähnliches Bild: ein zurückgezogenes, auf sich bezogenes, gefühlsarm wirkendes Häschen, auf das alle Schlangen ringsum starren und ihm doch nur helfen wollen.«
»Gratuliere, Physikum bestanden!« Jens wagte sich aus der Deckung, und Julia quittierte es mit einem geschmeichelten Lächeln, fuhr dann aber wieder ernster fort: »Aber was hilft das ganze Analysieren? Nein, da haben Sie doch eben viel besser angefangen zu erzählen. Robert Schönherrs Stimme habe ich schon im Ohr. Und jetzt weiter, wie war sein Blick?«
Julia hatte der Übereifer eines Erstsemesters in der hippokratischen Kunst wieder eingeholt. Jens entging diese Verwandlung nicht, und er setzte seine Beschreibung umso leichter fort: »Da war es ähnlich wie bei seiner Stimme. Es kostete ihn sichtlich Mühe, mich anzuschauen. Eine Kleinigkeit zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Dann wanderten seine Pupillen hin und her, bis sie jedes Detail erfasst hatten. War er dann gewiss, dass dort alles in Ordnung war, hörte ich mehrmals einen Seufzer der Erleichterung. Dann kehrten seine Augen wieder zu mir zurück, jetzt aber ganz langsam, schüchtern, jedoch wohlwollend. Wenn ich ihn da gebeten hätte, mir in seinem Kloster Asyl zu gewähren, ich glaube, er hätte einfach bloß genickt.«
Julia rührte im Kaffee, der Löffel klingelte silberhell am Tassenrand. Für Momente stand sie wieder im Kloster vor den Toten, wenige Stunden zuvor, bedrängt von der Geschäftigkeit ihrer vier gerichtsmedizinischen Kollegen, die der Tod nicht zu berühren schien, und doch auch wieder dankbar dafür, dass sie dadurch dem Geschehenen nicht ganz alleine ausgesetzt war. Als Praktikantin war sie nicht in die eingespielte Beweisaufnahme einbezogen worden, und nur die Tatsache, dass es niemandem eingefallen war, ihr überhaupt einen Auftrag zu geben, hatte ihr gezeigt, dass die Tätigkeit auch die anderen bis aufs Äußerste anspannte. Julia sah sich beim Rühren zu, gedankenverloren, in sich versunken, beinahe ein anderer Mensch als eben noch. Da riss sie sich empor und wandte sich Jens zu: »Ich habe auch Erinnerungen an Robert Schönherr.«
Erwartungsvoll beugte sich Jens vor, und ohne lange Einleitungen begann sie: »Das war so. Als ich die Fünf da liegen sah, wusste ich: Das war kein Verbrechen und noch viel weniger eine Verzweiflungstat. Was aber dann? Die Ermittler, die zwischen uns herumstanden, sprachen immer wieder vom Leiter dieser Gruppe, von Robert Schönherr. Dabei taten sie so, als wäre er an allem schuld. Als kaltblütiger Mörder oder als zynischer Sektenführer, was macht das für einen Unterschied? Ich hätte schreien können, so falsch war das. Sie alle gaben sich hochprofessionell. Sahen sie denn nichts? Da begriff ich: Nur wer Robert Schönherr versteht, kann auch der Seligkeit der Toten näherkommen. Und im gleichen Augenblick wusste ich: Ich bin dazu bestimmt, alles herauszufinden. Die Kollegen hatten sich schon vom ersten Moment an jeden Zugang dazu versperrt. Sie wussten zu gut Bescheid, um noch wirklich Fragen zu stellen. So verschwand ich aus der Kapelle und suchte nach seinem Zimmer, seiner Zelle, wie sich das ja wohl in einem Kloster nennt. Sie war von den Ermittlungsbeamten bis dahin nur provisorisch gesichert worden. Ich fragte mich: Wo versteckt so ein Autist oder was er ist seine Geheimnisse? Natürlich im eigenen Kopf. Dahin dringt keiner vor. Und wo sonst noch? Nur da, wo es am logischsten ist.«
»Und wo wäre das?«
»Unter der Matratze natürlich, so wie er’s in jedem Krimi lesen konnte.«
»Und …?«
»Bingo!«
»Kommst du mal so schnell wie möglich vorbei, Julia? Ich glaube, ich habe in den Barbara-Dateien aus der Villa etwas gefunden, das könnte sich als eine ziemlich heiße Spur erweisen. Nur, ich verstehe es nicht.« Gleich nach diesem Überraschungstelefonat flog Julia mit dem Fahrrad quer durch die spätabendliche Stadt zur von Jens angegebenen Adresse. Eine abgelegene Seitenstraße in Trudering. Doch eine angebliche Nummer Achtundvierzig gab es hier nicht, ganz sicher. Missgelaunt über ihre kauzige neue Bekanntschaft war sie unschlüssig, ob sie ihn anrufen und ihm die Hölle heißmachen oder gleich kehrtmachen und die ganze Sache begraben sollte. Inzwischen näherte sich das Brummen eines einbiegenden Transporters. Im Schritttempo schob er sich zwischen parkenden Autos voran und blieb auf ihrer Höhe stehen. Unruhig geworden, drehte sich Julia um. Der Motor wurde ausgeschaltet. Hinter einem parkenden Kleinwagen hob sich der Lieferwagen ab mit seinem fremden Nummernschild, Fenstern ringsum und einer imposanten Antennenkonstruktion auf dem Dach. Julia zögerte, ließ sich dann aber von ihrer Neugier leiten und schob ihr Fahrrad vor das seltsame Gefährt. Das Cockpit war erhellt, die Fahrertür stand offen, aber niemand war zu sehen. Nun packte sie doch die Angst. Sie schwang sich auf den Sattel. Im gleichen Moment rief es leise vom Heck des Wagens her: »Julia, schnell!« Jens! Was sollte sie von diesem Theater halten? Trotzig blieb sie, wo sie war. Da tauchte Jens’ wirre Frisur neben ihr auf. »Julia, komm, bitte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf der Fahrt werde ich dir alles erklären.« Seine Worte klangen ehrlich, aber angespannt. Etwas war nicht in Ordnung. Sie ließ sich nach hinten ziehen, wo Jens die Hecktür geöffnet hatte. Er hievte ihr Fahrrad hinein, befestigte es, hielt ihr die Beifahrertür auf und fuhr los, irgendwohin.
Einige Zeit benötigte sie, um ihrer Angst, ihrer Verwirrung und ihres Befremdens Herr zu werden. Der Blick in den Fond des Wagens hatte ihr einen chaotischen Mehrzweckraum gezeigt, Fotolabor, Geräteschuppen, Kochnische und Schlafkoje in einem. In diesem sicher bald zwanzig Jahre alten Transporter, einem Wohn- und Labormobil, das Jens selbst zusammengebaut hatte und das nach Bratkartoffeln und Paprikasuppe roch, saß sie nun neben einem ihr noch vor wenigen Stunden völlig Unbekannten und fuhr planlos durch Neben- und Hauptstraßen, er wusste wohl selbst nicht wohin. »Was ist das?«, platzte es schließlich aus ihr heraus. Auf diese Frage schien Jens nur gewartet zu haben. »Mein Zuhause auf Rädern«, erwiderte er, »mein Fotomobil.« Stolz und Liebe lagen in seiner Antwort. Die Sache war rasch erklärt. In seiner Zeit als Werbefotograf, als das Geschäft etwas besser lief, er aber wegen der vielen Außenaufnahmen heute hier und morgen dort sein musste, hatte er kurzerhand seine Wohnung in Zwickau aufgelöst, nachdem er sich an vielen Wochenenden diesen alten Lieferwagen zum Allrounder eines reisenden Fotografen umgebaut hatte. »Nummer Achtundvierzig – zuhause im Nirgendwo!«, schloss er seine Erläuterungen lachend.
»Da bist du ja ein vollkommener Individualist«, meinte sie, und er fügte hinzu: »Und der letzte freie Geist aus der DDR!«
Jetzt aber, was war so dringend? Jens erzählte ihr, was er in Roberts Dateien gefunden hatte, von der Geheimnistuerei mit dem seltsamen Sperren durch das Passwort »Barbara« und wie er die Dateien kopiert und sie in Professor Rautloffs Abwesenheit heimlich an sich selbst gemailt hatte.
»Aber dann braucht doch nur jemand die gesendeten Objekte zu überprüfen, und er weiß, dass du es warst.« Oh, schon wieder dieses Motiv von ihm als kleiner Portion! Doch er war sich seine Sache zu sicher: »Das muss man nicht daraus folgern. Es könnte ja auch jemand denken, Rautloff selbst habe mir Material zuspielen wollen. Immerhin ist Robert jetzt für die Presse wahnsinnig interessant.«
»Egal wie, das war doch wirklich keine Glanzleistung. Die kommen dir bestimmt jetzt leichter auf die Spur als ein Hund mit Schnupfen.«
Jens konnte den Vorwurf an ihn als einen weltfremden Sonderling nun nicht mehr überhören, und das war ein Punkt, auf den er scharf reagierte: »Für wen hältst du mich denn? Den Gesendet-Eintrag konnte ich gerade noch löschen, ich bin doch kein Anfänger. Aber bitteschön, der nützliche Idiot lässt dich gerne wieder aussteigen. Die einzige Idiotie des heutigen Tages habe ich offensichtlich begangen, als ich dich ins Vertrauen zog. Ich arbeite eben doch immer noch am besten allein.«
Die Beifahrerin legte ihre Linke auf seinen Arm und schaute ihn betreten an. Es ging doch gerade erst los, und da sollte alles schon wieder zu Ende sein? »Also, was hast du herausgefunden?«
Die Straßenlaternen warfen ihr regelmäßiges Licht auf den Fotografen, und seine Gesichtszüge kündigten einen Triumph an: »Zuerst fast gar nichts. In Roberts Ordner war nur das absolute Minimalprogramm: Curriculum Vitae, Veröffentlichungsverzeichnis und der Plan, wann er für das Institutsfrühstück Kaffee und Brötchen zu besorgen hatte.«
»Fast nichts? Die ersten beiden Dokumente kannst du ja mal nach Besonderheiten abklappern. Wir Frauen interessieren uns viel mehr dafür, was dahintersteckt, wenn die Männer fürs Frühstück mal selbst einkaufen müssen.«
»Mussten! Die Frühstücksdatei war zuletzt vor über drei Jahren aktualisiert worden.«
»You got it! Also haben sie Robert vor drei Jahren als Assistenten am Lehrstuhl hinausgekickt und auf ein Sonderforschungsprojekt abgeschoben. Vor drei Jahren, Moment mal, also seitdem dieser Brescher seinen trinkfreudigen Vorgänger mit dem Lehrstuhl beerbt hat.«
»Auch das muss man nicht daraus folgern. Vielleicht war Brescher ja nur ein neuer Besen gegen Trödelei am Arbeitsplatz: ›Schluss mit Kaffeekränzchen, ich habe euch eine Menge Arbeit mitgebracht!‹ Oder ganz anders, vielleicht hat der Neue ja auch einen wesentlichen Teil seines kargen Professorengehaltes dazu verwendet, als edler Dauerspender des Institutsfrühstücks aufzutreten. Oder vielleicht war es Robert einfach zu viel. Vergiss nicht, er war damals zwar nicht mehr Assistent, aber er bekam doch immerhin seinen Vertrag in diesem Sonderforschungsprojekt.«
»Das Logikvirus hat dich wohl schon angesteckt: folgern, Alternativen und Verknüpfungen entwickeln, und- und-und, oder-oder-oder, alle-einige-einige nicht-keine … Aber bitte, denken kann ich auch. Wer miteinander Faschingsorgien feiert, pflegt auch Frühstücksrunden. Und wenn das Besorgen reihum abgeschafft worden wäre, warum wurde dann nicht irgendwann in den letzten Jahren diese überflüssige Datei wieder gelöscht?«
Anerkennend blickte Jens zur Seite. »Also doch. Vor drei Jahren trennten sich die Wege zweier Assistenten. Der eine wird fromm, und der andere rückt auf zum Nachfolger seines eigenen Professors – übrigens sicher nicht zur Freude Rautloffs, wie ich aus seinen mehr als eindeutigen Bemerkungen geschlossen habe …«
»… und sicher auch nicht zur Freude seiner Philosophischen Fakultät. Hausberufung nennt man ein solches Nachrücken des eigenen Schülers, und das gilt immer als etwas anrüchig, auch wenn er seine Habilitationsschrift im schon laufenden Bewerbungsverfahren pro forma an irgendeinem osteuropäischen Institut eingereicht hat.«
»Wie weit uns Kaffee, Brötchen und ein bisschen Grips doch gebracht haben! Die eine Seite wird jetzt klar: Frederic Brescher will um jeden Preis Karriere machen. Klar, solche Leute brauchen ihre Sitzungen, ihre Höflinge und ihre Hintertüren. Und noch etwas ist klar geworden. Brescher wollte unbedingt an dieser Uni bleiben, selbst gegen das Handicap einer Hausberufung. Barbara?«
»Quatsch! Dass ihr Männer immer nur eines im Kopf habt! Karrieristen lassen sich doch nicht durch Sentimentalitäten von ihren Plänen ablenken. Etwas anderes band ihn an dieses Institut, und zwar sicher nicht dessen Renommee. Unter Rautloff ist es ja nie über ein Nischendasein hinausgekommen, das dem nächsten Streichkonzert des Wissenschaftsministers zum Opfer fallen könnte. Nicht die Institutsarbeit war unvergleichlich, sondern sein Netzwerk, also die Beschäftigten, ihre Loyalität zum Chef, die Kontakte und … das Wissen darum, bei wem man hier in der regionalen Szene auftrumpfen kann und bei wem man sich bedeckt halten muss. Das funktioniert wie die Mafia: Sie agiert global, aber die Fäden werden von Corleone aus gezogen.«
Das war nicht schlecht, und Jens sparte nicht an Bewunderung. Darüber hätte sie beinahe die Frage vergessen, die sie von Anfang an auf den Lippen hatte: »Wozu die ganze Eile?« Wortlos zog Jens aus einer versteckten Klappe unter dem Handschuhfach einen bereits hochgefahrenen Laptop auf einer Schiene hervor. Der Bildschirm war mit wirren Zeichen überdeckt. Jens erläuterte, was er herausgefunden hatte: »Mir ist es gleich verdächtig vorgekommen, dass sich in Roberts Ordner nur drei Dateien befanden. Von der dritten gab es allerdings nur eine Spur in einem Backup-Ordner. Sie hieß ›Widerlegung‹. Als ich sie anklicken wollte, erhielt ich nur die Meldung: ›Datei nicht vorhanden.‹ Letzte Chance: der Papierkorb des PCs. Und wirklich, dort habe ich sie noch gefunden und mir ebenfalls gleich zugemailt. Hier ist sie.« Julia hatte sie auf dem Bildschirm des Laptops vor Augen. Sie begann mit dem Satz: »Die Argumentation von Frederic Brescher in seiner Logik der Macht beruht auf Fehlschlüssen, genauer n1 mal eine petitio principii und n2 mal eine fallacia dictionis.« Robert schrieb also etwas gegen Brescher. Die genaue Ziffer für n1 usw. musste offensichtlich noch eingesetzt werden, das heißt, seine Widerlegung stand noch ganz am Anfang. Es folgte unmittelbar darauf eine unabsehbare Folge von logischen Verknüpfungszeichen und Buchstaben. Julia fielen ihre ersten Stunden in Anatomie ein. Kommilitonen hatten beim Sezieren nur einen aufgeschnittenen Gewebehaufen erblickt, wenn sie nicht sowieso gleich fluchtartig die Toiletten aufgesucht hatten. Sie dagegen hatte alles in Ruhe angeschaut und sich dann gefragt: Organe, Muskeln, Gewebe, Adern, wie hängt alles miteinander zusammen? »So also sehen die Eingeweide des Denkens aus«, sprach sie jetzt beim Blick auf den Bildschirm beeindruckt zu sich selbst. In dieser wirren Zeichenfolge fand sie aber eines bald heraus: Immer drei Zeilen gehörten zusammen. Vor jeder stand jeweils ein A, ein E, ein I oder ein O. Es folgten zwei kleine Buchstaben in jeder Zeile, von denen einer in Zeile eins und zwei stand, in Zeile drei aber verschwand. Letztere bildete oft wieder die erste Zeile in einer neuen Dreiergruppe.
»Kannst du mit diesem ganzen Salat denn etwas anfangen?«, fragte Jens nach zehn Minuten, während er seelenruhig einmal hierhin und einmal dorthin abbog. »Dieser Rautloff hat mir schon so etwas aufgetischt, aber das kann doch kein vernünftiger Mensch begreifen.«
»Wohin kutschierst du uns denn die ganze Zeit?«, fragte Julia zurück. Nun, Jens schlug mit seinem Fotomobil Haken durch die Stadt. So konnte er sich vergewissern, dass ihm keiner folgte. »Und warum hältst du nicht einfach irgendwo an? Ich werde ja schon bald seekrank.«
»Weil sie mir eben doch bei den drei kopierten Dateien bald auf die Schliche kommen werden. Das ist brisantes Material. Bei der Dissertation gibt es die verschwundene Fakultätsfassung mit der ganz anderen Passage zu Frederic Brescher. Und dann diese Datei ›Widerlegung‹. Sie enthält nur Bruchstücke, und ich verstehe davon absolut nichts. Außer einem: Damit soll Brescher wissenschaftlich zur Strecke gebracht werden. Oh, Brescher, Robert, Rautloff, das ganze Institut, Barbara – da hat sich eine gewaltige Spannung aufgebaut, und du wirst sehen, bald wird sie sich mit Blitz und Donner entladen. Nur dich dürfen sie auf keinen Fall mit der Sache in Verbindung bringen. Deshalb mein Herumgekurve.«
Aus der letzten Bemerkung begriff Julia, dass sie es mit einem Kavalier der alten Schule zu tun hatte, nur eben mit einem, den die Zeitumstände zu mancherlei seltsamer Vermummung getrieben hatten. Sie schwieg und fühlte sich an seiner Seite sehr wohl. Aus Dankbarkeit wollte sie zeigen, dass sie möglichst viel von dieser Widerlegung verstehen konnte. So fing sie an, ihre Entdeckungen laut vorzutragen. Das regte Jens seinerseits an, diese durch Nachfragen wieder ins Wanken zu bringen. Plötzlich stieß sie einen lauten Schrei aus: »Barbara! Da steht: ›Führe alles Unvollkommene auf Barbara zurück!‹ Oh, Barbara, die vollkommene Frau – das klingt wahnsinnig schwärmerisch, wie die Sehnsucht nach der ersten Liebe. Und das in einem trockenen Konglomerat!«
Es hatte den Anschein, als hätte Jens die letzten Bemerkungen gar nicht gehört. Doch mit einem Mal ließ er die Bremsen quietschen, riss den Wagen zur Seite in die Einfahrt zum Hof eines nächtlich ruhigen Industriebetriebes, hielt an und schwenkte den Laptop zu sich herüber. »Nein, Barbara ist keine Frau!« Er schrie es beinahe. »Es ist eine Form der Schlussfolgerung. Siehst du nicht, was du mir die ganze Zeit immer wieder vorgelesen hast? Zurückgeführt wird immer nur entlang der Anfangsbuchstaben B, C, D und F: nach B wie Barbara eben oder nach C wie Celarent, nach D wie Darii oder nach F wie Fesimo. Diese vier bilden also die Reihe der Vollkommenen, und alle anderen, die mit diesen Buchstaben beginnen, sind unvollkommen. Julia, hör zu, wir müssen das alles verstehen. Wann wurde an der Datei zuletzt gearbeitet?«
»Am 9. Februar um 23.34 Uhr.«
»Also am Tag des Unglücks, zu einer Zeit, da im Kloster schon längst die Totenruhe herrschte. Und jetzt der Knüller: Weißt du, wann die Datei aus dem Intranet des Instituts genommen und in den Papierkorb verschoben worden ist? In der gleichen Nacht um 1.17 Uhr!«
»Wurde sie von Robert gelöscht, weil ihm diese Widerlegung zu heiß wurde?«
»Glaube ich kaum. Im Gegenteil, Robert riskiert alles mit dieser Widerlegung. Da gibt er sein Herzblut. Außerdem konnte die Datei durch die diversen Sicherungen des PCs nur direkt am Institutscomputer gelöscht werden. Und da war doch gerade Party.«
»Also wurde sie von …«
»… Brescher gelöscht, ganz genau, Roberts speziellem Feind.«
»Das ist ja wie Kain und Abel«, entfuhr es Julia.
Fragen gab es also mehr als genug. Für heute reichte es. Der Abschied war kurz. Jens schaute sich sorgfältig um, ob es Beobachter gab. Alles war still. Julia saß schon wieder auf ihrem Fahrrad, da klopfte sie noch einmal an die Fahrertür: »Nur eines ist seltsam. Bei einem Begriff steht bei Robert fettgedruckt: Achtung, bei irrealen Gegenständen nicht zurückführbar – vergleiche Lomonossow!«
»Und welcher Begriff ist das?«
»F wie Felapton.«