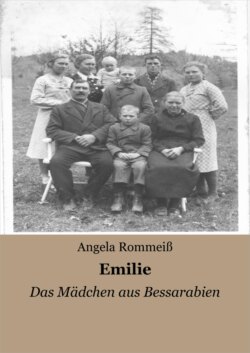Читать книгу Emilie - Angela Rommeiß - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IN DER FREMDE
ОглавлениеMan schrieb das Jahr 1905, es war Sommer.
Die Hitze flirrte über dem Stoppelacker. Im heißen Sonnenlicht glänzten die Ähren wie Gold, wenn sie unter den kraftvollen Sensenstrichen der Männer zu Boden raschelten.
Emilie richtete sich auf. Oh, wie der Rücken schmerzte! Aber sie war noch jung, zehn Jahre erst, da reicht es, sich einmal nach hinten zu beugen, die Fäuste ins Kreuz zu drücken – schon war der Schmerz vorbei. Bei den älteren Frauen ging das nicht mehr so schnell. Die ganz Alten hatten das Aufrichten völlig aufgegeben, ihre Rücken blieben gebeugt, wenn sie abends nach Hause gingen.
Emilie strich sich eine hellblonde Haarsträhne unter das buntgeblümte Kopftuch. Dabei wanderten ihre Blicke über die arbeitenden Menschen. Die Männer mit ihren Sensen, hemdsärmelig die meisten, mit nackten, glänzenden Oberkörpern einige Jüngere. Na, die wollten wohl den Mädchen gefallen. Die Frauen und Mädchen hatten allerdings kaum einen Blick für sie. Emsig rafften sie die gefallenen Halme und banden sie zu Garben, die dann als Puppen zusammengestellt wurden. Für Emilie wurde es Zeit, wieder mitzutun. Seufzend warf sie die blonden Zöpfe nach hinten und bückte sich.
„Sehen selbst aus wie Ähren, deine Zöpfe!“, rief lachend ein halbwüchsiges Mädchen hinter ihr. „Pass nur auf, dass der Mikosch sie dir nicht abmäht!“
Emilie lächelte. Sie war die gutmütigen Scherze über ihr helles Haar schon gewöhnt. Die meisten Menschen hier waren schwarzhaarig, denn sie waren hier in der Ukraine, nahe dem Schwarzen Meer. Wie ihre Mutter sagte, gab es weiter westlich viele Leute mit blonden Haaren, ja sogar ganze Dörfer mit rein deutscher Bevölkerung. Warum sie da nicht wohnten, wollte Emilie von ihrer Mutter wissen. Aber die war einsilbig geblieben und hatte nur gesagt, es ginge eben nicht. Die Wahrheit war einem Kind schwer zu erklären – es war die Sturheit des Vaters. Nachdem Jacob und Wilhelmine mit ihren Kindern von zu Hause weggezogen waren – Reichtum und Wohlstand entgegen – lief nicht alles so wie geplant.
Es war durchaus üblich, dass Bauern, die keine erwachsenen Söhne oder Töchter hatten um die landwirtschaftlichen Arbeiten zu bewältigen, Knechte aus dem eigenen Dorf einstellten. Doch Jacob war zu stolz, um sich bei seinen Nachbarn zu verdingen. Er hatte sogar darüber nachgedacht, nach Amerika auszuwandern, wie so viele seiner Landsleute es taten. Nachdem nämlich die ‚ewige‘ Militärfreiheit nach nur achtundfünfzig Jahren von der russischen Regierung wieder aufgehoben worden war, setzte eine wahre Auswanderungswelle ein. Aber davon wollte Wilhelmine nichts wissen. Lieber würde sie in den Kaukasus, in die Krim oder nach Sibirien auswandern, wie schon einige deutsche Siedler vor ihnen. Dort waren die Menschen freundlich, sagte sie, nicht so wie in Amerika, wo die Männer Waffen trugen und es wilde Ureinwohner gab. Am Ende waren sie hier gelandet, in dem kleinen ukrainischen Dörfchen bei Cherson. Der mächtige Dnipro mündete nicht weit von hier ins Meer und bestimmte das Leben der Menschen. Es gab eine Werft und große Handelsplätze. Um die Stadt herum lagen fruchtbare Weizenfelder. Hier fand Jacob Arbeit, hier ließen sie sich nieder.
Aber, ach, wie weit war es bis nach Hause! Immer, wenn sie weitergezogen waren, entfernten sie sich weiter von der Heimat, bald waren es über vierzig Meilen (fast dreihundert Kilometer) bis Teplitz. Die Nachricht vom Tod der Eltern erreichte Jacob erst, als die schon unter der Erde waren. Gertrud, die derweil noch zwei Kinder bekommen hatte, machte in ihrem Brief unmissverständlich klar, dass sie eine Heimkehr des Schwagers nicht gutheißen würde. Es ginge ihnen ja auch viel besser in der Fremde als hier in Teplitz, schrieb sie scheinheilig. Jacob verfiel nach dieser Nachricht in ein dumpfes Brüten. Wilhelmine steckte den Brief ins Herdfeuer und bemühte sich, ihren Mann auf andere Gedanken zu bringen.
Die Kinderschar war mittlerweile auf fünf angewachsen, was in der damaligen Zeit, anders als heute, als Gottes Segen empfunden wurde. Sie erzogen ihre Kinder im evangelischen Glauben und sprachen mit ihnen deutsch. Natürlich konnten sich die Kinder auch in der Landessprache verständigen. Oftmals mussten sie für die Mutter übersetzen, der die neue Sprache schwerfiel. Ihr Mann war bei seiner Arbeit mehr unter Menschen und konnte sehr gut russisch. Wenn er als Schmied keine Arbeit fand, nahm der Vater allerlei Stellungen an. Er galt als zuverlässig und war handwerklich geschickt. Die Mutter baute auf dem kleinen Acker hinter dem Haus Gemüse, Arbusen (Wassermelonen) und Hülsenfrüchte an. Als Jacob und Emilie, die beiden Großen, alt genug waren, konnten sie zur Erntezeit bei den Bauern helfen. Das brachte auch ein paar Münzen oder Lebensmittel ein. So ging es der Familie in dieser Zeit gar nicht schlecht. Sie hatten sogar eine Kuh angeschafft und allerlei Federvieh tummelte sich auf dem Hof. Das Häuschen war allerdings nur gepachtet und das Pferd derweil gestorben. Doch mit Gottvertrauen und Zuversicht gedachte Wilhelmine, ihre Kinder zu guten Menschen zu erziehen, auch wenn es im Leben keinen Reichtum zu erringen gab.
Ihr Mann sah das ganz anders. Seine Abenteuerlust hatte sich merklich abgekühlt und er haderte mit seinem Schicksal. Wie gerne wäre er als strahlender Held nach Hause zurückgekehrt, mit zwei prachtvollen Pferden vor einem nagelneuen Wagen, gutgenährten Kindern und einer Frau in Kleidern, die sie im Geschäft gekauft und nicht selbst genäht hatte. Doch statt Geld hatte er nur Löcher in der Tasche. Die Enttäuschung über sein scheinbar erfolgloses Leben hatte aus dem einst so lebensfrohen jungen Mann einen wortkargen, mürrischen Sonderling gemacht.
Emilie ging nach Hause.
Das Blechtöpfchen, in dem das Mittagessen gewesen war, klapperte müde an ihrer rechten Hand, in der linken hing das buntgeblümte Kopftuch. Die nackten Füße wirbelten kleine Staubwölkchen auf dem trockenen Feldweg hoch. Das dürre Gras, die Stoppelfelder, die kleinen weißgetünchten Häuschen bekamen von der untergehenden Sonne einen orangeroten Schimmer. Schön sah das aus! Der mächtige Fluss, dem sie entgegenging, glänzte wie flüssiges Silber. Emilie träumte und schlurfte langsam heimwärts. Obwohl sie staubig war und es überall von der Spreu juckte, hatte sie es nicht eilig. Zu Hause gab es immer genug zu helfen für die älteste Tochter – und heute waren die Hände besonders zerschunden. Die Mutter würde etwas Fett drauf streichen müssen. Ob es heute grüne Riebela gab? Diese Kohlsuppe mit Mehlklößchen aß Emilie gern. Natürlich ging nichts über ein Stück Fleisch auf dem Teller, oder süße Nudeln...! Emilies Magen knurrte. Meistens machte die Mutter Brei oder Suppe. Wegen der kleinsten Geschwister und seit der Vater so schlechte Zähne hatte.
Emilie stellte das Töpfchen auf der Treppe neben der Haustür ab und ging zum Brunnen. Als das Schöpfrad quietschte, sprang die Haustür auf. Jacob kam heraus, an jeder Hand einen Zwilling. Die sechsjährige Paula drängelte hinterdrein.
„Wo bleibst du nur?“, rief der Bruder. „Nimm mir mal die Blagen ab, ich muss zur Schmiede. Der Vater hatte einen Unfall, Mutter haben sie vor ner Viertelstunde geholt!“
Emilie stand wie erstarrt. „Was – wie ...?“, stammelte sie, doch Jacob war schon davongerannt. Man sah nur noch seinen braunen Schopf über einer Staubwolke, aus der die nackten Sohlen blitzten, dann war er fort.
Das war doch wieder typisch, als ob sie den dort gebrauchen konnten! Seufzend nahm Emilie die Zwillinge bei den Händchen. Selma und Eduard waren erst zwei Jahre alt und sehr zarte Kinder. Emilie wusste noch, wie schwer die Geburt gewesen war. Die Zwillinge schienen unbedingt gleichzeitig auf die Welt kommen zu wollen. Dann sah es für ein paar Tage so aus, als wollten sie die Welt gleich wieder gemeinsam verlassen. Auch um das Leben der Mutter mussten sie bangen. Nun bangte Emilie um den Vater. Nicht, dass sie ihn besonders liebte. Der Vater war meistens mürrisch und abends müde. Mit seinen Kindern wusste er nichts anzufangen, solange sie klein oder Mädchen waren. Bisweilen verteilte er Schläge, wenn es ihm nötig erschien, damit war seine erzieherische Tätigkeit erschöpft. Von der Mutter bekamen sie höchstens mal einen Klaps.
Das Mädchen öffnete ein Fenster, weil es im Raum stickig war. Ein kühler Abendhauch tat gut nach dem heißen Tag. Was mochte nur passiert sein? Emilie war unruhig. Sie nahm einen Lappen aus der Schüssel und wischte über den groben Holztisch. Ach, wahrscheinlich war es nicht so schlimm. Der Vater würde die nächsten Wochen mit einem gebrochenen Bein im Bett liegen und alle herumkommandieren. Emilie hob die kleine Selma auf ihr Stühlchen und schaute nach dem Herd. Paula und Eduard balgten sich auf dem Fußboden herum.
Das Feuer war ausgegangen, aber die Suppe war noch warm. Emilie hob den Deckel und schnupperte in den Topf. Sie zog die Nase kraus. Kein einziges Fettauge schwamm auf der dünnen Brühe! Die Mutter hatte sicherlich nichts dagegen, wenn sie einen Kanten Brot dazu aßen.
„Sei ein großes Mädchen und setz Edi auf den Stuhl!“, rief Emilie der Schwester zu.
„Ja, ja!“, antwortete Paula und kitzelte Eduard am Bauch. Der kreischte und rannte mit dem Kopf gegen den Schrank. Emilie musste pusten, damit es nicht mehr wehtat. Als endlich alle am Tisch saßen und die Suppe in den Schüsseln war, wurde es still. Nur die Löffel klapperten ihr hungriges Lied. Paula hatte ihr Kinn fast in die Schüssel gesenkt und zwinkerte fröhlich ihre Schwester an. Paula war ein lustiges kleines Ding mit Sommersprossen auf der kecken Nase. Auch Jacob und Eduard hatten solche Sommersprossen und rotbraunes Haar. Emilie und Selma waren blond und zarthäutig wie die Mutter. Die Älteste fütterte die Kleinen. Abwechselnd bekam jeder einen Löffel Suppe in den Mund: Emilie – Edi – Emilie – Selma - Emilie. Ganz gerecht war es zwar nicht, aber nach dem arbeitsreichen Tag auf dem Feld hatte Emilie einen Riesenhunger. Wie zwei Vögelchen sperrten die Kleinen geduldig die Mäulchen auf, bis sie wieder an der Reihe waren. Auf Edis Stirn leuchtete eine Beule, aber zum Glück hatte er sie vergessen. Nach einer Weile wollte Selma nicht mehr essen, ihr fielen schon die Äuglein zu.
„Ob ich sie gleich so ins Bett lege – ohne Waschen?“, fragte Emilie Paula und blickte zweifelnd die Kleinen an.
„Ohne Waschen!“, rief Paula und klatschte in die Hände. Aber der staubige Sommertag hatte seine Spuren hinterlassen, alle drei mussten gewaschen werden. Emilie hatte sich ja selbst noch nicht einmal erfrischt. Draußen am Brunnen wurde Selma wieder munter. Quietschend rannte sie mit ihren Geschwistern nackt um den Brunnen, aus dem Emilie Wasser schöpfte und immer mal dem einen oder dem anderen einen Guss verpasste. Dann wusch sie sich selber, sammelte die Kleinen ein und wollte ins Haus. Plötzlich erschien am Gartenzaun zwischen den Büschen ein runzliges, altes Gesicht. Es war die Nachbarin, eine verrückte Alte, die leicht zornig wurde und dann mit dem Teufel drohte. Sie mochte der Grund dafür gewesen sein, dass man ihnen diese Hütte so billig vermietet hatte. Die Mutter hielt die Kleinen tunlichst von ihr fern, auch Emilie und Jacob gingen ihr nach Möglichkeit aus dem Wege.
Die Alte starrte die Kinder eine Weile durch die Zweige an. Emilie bemühte sich, die Nacktheit der Geschwister rasch mit Tüchern zu bedecken, denn die streng katholischen Menschen hier sahen solche Freizügigkeiten nicht gerne. Als sie zu der Alten schielte, hielt sie verwundert inne, denn diese grinste über das ganze verknitterte braune Gesicht. Dann lachte sie schrill, eine klauenartige Hand langte über den Zaun und zeigte auf die Kinder.
„Bald seid ihr weg – alle, alle weg!“ Die dünne Greisinnenstimme wurde lauter. „Wirst beim Satan wohnen – du!“, und dabei schaute sie Emilie fest in die Augen. Das Mädchen überlief es eiskalt. Schnell rannten sie ins Haus, obwohl noch einige Sachen draußen lagen. Emilie knallte die Tür zu und lehnte sich schwer atmend dagegen. Verstört drängten sich Selma und Eduard an ihre Beine. Paula war auf die Fensterbank geklettert und streckte die Zunge heraus.
„Paula, lass das!“, rief Emilie erschrocken und schloss schnell das Fenster. Sie wusste selber nicht, warum sie so aufgeregt war. Sonst nahmen sie die Alte nicht besonders ernst, wie überhaupt kaum jemand im Dorf. Doch heute war es anders.
‚Du wirst beim Satan wohnen! ‘ Was mochten diese Worte nur bedeuten? Emilie war bedrückt. Eine dunkle Vorahnung legte sich wie ein Schatten auf ihr unbekümmertes Gemüt.
Sie brachten den Vater auf einer Trage. Die Mutter hielt sich die Schürze vor den Mund und hatte verweinte Augen. Jacob stand hilflos im Wege herum. Emilie und Paula drückten sich verzagt an die Wand, als die vier Männer die Trage durch die enge Tür, am Tisch vorbei und in die Schlafkammer bugsierten. Keiner sprach ein Wort. Gingen sonst Besucher fort, brachte die Mutter sie vor die Tür, scherzte und grüßte die Daheimgebliebenen. Jetzt blieb sie in der Schlafkammer sitzen und kümmerte sich nicht um die Männer, die schweigend und mit versteinerten Gesichtern hinaus stapften.
Die Kinder versammelten sich still um die Mutter. Jacob Haisch lag im Sterben.
Sie hatten ein junges Ross beschlagen. Als Jacob den hinteren Huf anpassen wollte, ließ ein Gehilfe ein glühendes Stück Eisen fallen, das dem ängstlichen Tier direkt vor die Vorderfüße rollte. Das erschrockene Pferd keilte aus und versetzte Jacob einen kräftigen Tritt vor die Brust. Die Herbeieilenden hoben ihn auf, aber er stöhnte vor Schmerzen. Wahrscheinlich waren einige Rippen gebrochen oder die Lunge gequetscht. Der Pferdedoktor, der sich mit gebrochenen Rippen auskannte, betastete Jacobs Brust, schaute in dessen wachsbleiches Gesicht mit den blauen Lippen und stand auf.
„Ruft die Frau!“, sagte er leise zu den Umstehenden. „Es geht zu Ende.“
Eine Rippe hatte die Lunge durchbohrt. Der Transport gestaltete sich äußerst schwierig und dauerte lange, weil den Verletzten jede Bewegung schmerzte. Jetzt lag er hier und keuchte mühsam. Seine Familie stand und saß um ihn herum, alle weinten. Eine halbe Stunde später verlor Jacob das Bewusstsein. Kurz darauf trat blutiger Schaum aus seinem Mund, er röchelte qualvoll und verstarb. Emilie stand wie erstarrt am Fußende des Bettes und hielt sich die Ohren zu. Niemals würde sie diesen Anblick und diese schrecklichen Geräusche vergessen.
Jacob zog die schluchzende Paula aus dem Zimmer. Glücklicherweise schliefen die Zwillinge bereits in dem Kämmerchen, welches mit Decken von der Küche abgeteilt war. Die Mutter saß auf einem Hocker neben dem Bett, immer noch die Schürze an den Mund gepresst und wiegte sich vor und zurück. Zaghaft legte ihr Emilie eine Hand auf die Schulter. Wilhelmine zuckte zusammen, dann schien sie zu erwachen. Sie nahm Emilies Hand in die ihre und legte sie sich an die Wange.
„Was soll nun werden?“, fragte sie leise. „Ach, Kind, was soll nun aus uns werden?“
Hilflos strich ihr Emilie übers Haar. Sonst war es immer die Mutter, die Trost spendete. Wilhelmine lächelte ihre Tochter dankbar an. Es wurde nur ein kleines Lächeln, aber es gab Emilie wieder Mut. Auch die Mutter fasste sich. Entschlossen stand sie auf und beugte sich über ihren toten Mann. Mit einem Tuch wischte sie ihm zärtlich das Blut aus dem Gesicht.
„Jacob!“, rief sie ihren Ältesten. Der stand sofort in der Tür. „Geh nach Cherson und hole den Pfarrer. Erzähle ihm, was passiert ist, er wird alles Nötige veranlassen.“ Jacob nickte nur und verschwand. Er war froh, etwas tun zu können und aus dem Haus zu kommen, obwohl es schon finstere Nacht war.
„Emilie!“, wandte sich die Mutter an die Tochter. „Heize den Herd an, ich brauche warmes Wasser. Dann holst du aus der Truhe die guten Sachen vom Vater. Du weißt schon, das weiße Hemd und den dunklen Anzug. Paula soll dir helfen.“
Wilhelmine entkleidete ihren Mann, wusch, kämmte und rasierte ihn sorgfältig. Obwohl es schon sehr spät war und die beiden Mädchen sich vor Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten konnten, gingen sie ihrer Mutter ernst und schweigend zur Hand. Als der Pfarrer kam, hatte Jacob Haisch seinen Sonntagsstaat angelegt und die Hände auf der Brust gefaltet. Die Mutter rief die Kinder herein, damit sie von ihrem Vater Abschied nehmen konnten.
Auf dem kleinen katholisch-orthodoxen Friedhof fand sich eine Ecke für Jacob Haisch.
Neben einem reisenden Händler, der auch evangelisch-lutherischen Glaubens gewesen war, und einem jüdischen Apotheker fand er in einer einfachen Holzkiste seine letzte Ruhe. Ein schlichtes Holzkreuz zierte sein Grab. Für einen Sarg und einen Stein fehlte das Geld.
Einige Nachbarn hatten sich zum Begräbnis eingefunden. Sogar die verrückte Alte war da, die den Kindern solche Angst eingejagt hatte. Emilie blickte scheu zu ihr hin, aber sie war heute ganz friedlich. Sie ging gern zu Beerdigungen und versäumte keine einzige.
Als Wilhelmine mit ihren Kindern gebetet hatte und sich endlich zum Gehen wandte, trat schüchtern ein junger Mann auf sie zu, der sich die ganze Zeit im Hintergrund aufgehalten hatte. Es war der Gehilfe, der das Pferd erschreckt hatte. Schuldbewusst versicherte er der Witwe sein Beileid, seine Worte kamen stockend. Schließlich brach er in Tränen aus. Wilhelmine legte ihm die Hand auf den Arm und beruhigte ihn.
„Grämen sie sich nicht, mein Junge. Ich werfe ihnen nichts vor. Leben und Tod liegen einzig und allein in Gottes Hand!“
Emilie blickte zu ihrer Mutter auf. Wie tapfer und großherzig sie war! Selbst in ihrer tiefen Trauer war sie imstande, demjenigen Trost zu spenden, der den Tod ihres Mannes verursacht hatte.
Wasile, so hieß der junge Bursche, erschien danach regelmäßig bei den Haischs. Mal brachte er einen Korb voll Eier, mal frischgebackene Maisfladen von seiner Mutter. Er hackte Holz, reparierte kaputte Dinge und grub im Herbst den kleinen Acker hinter dem Haus um. Wilhelmine war sehr froh über die Hilfe, die sie in dieser schweren Zeit von Wasile und seinen Eltern erfuhr. Sonst gab es aber im Dorf nicht besonders viel Aufmerksamkeit für die deutsche Familie. Es waren schließlich zugezogene Fremde und damit Außenseiter. Sie sprachen untereinander eine seltsame Sprache und bereiteten ihr Essen ganz anders zu als die Einheimischen. Man tolerierte sie zwar, aber richtig zugehörig waren sie nicht.
Wilhelmine belastete dieser Zustand sehr. Seit Jahren sehnte sie sich schon nach zu Hause. Als Jacob noch da war, fand sie bei ihm Halt und Schutz. Er ersetzte ihr die Heimat. Doch jetzt, so ganz allein und für fünf Kinder verantwortlich, fühlte sie sich oft so einsam und überfordert, dass sie sich nachts in den Schlaf weinte. Immer öfter bemerkte sie, dass sich ihre Kinder untereinander in der Landessprache unterhielten. Selbst zu Hause schlichen sich in deutsche Sätze russische Wörter ein. Eigentlich war es ja gar nicht verwunderlich, dass sich die Kinder ihrer Umgebung anpassten. Gerade das ist ja die große Stärke von Kindern – sie können sich anpassen. Sie wuchsen schließlich hier auf und kannten es nicht anders. Wilhelmine wollte aber, dass ihre Kinder Deutsche blieben, denn sie selbst war kein Kind mehr und konnte und wollte sich niemals von ihrer deutschen Vergangenheit lösen. Schon oft hatte sie versucht, mit ihrem Mann über dieses Thema zu sprechen, doch er war uneinsichtig geblieben. Nun war er aber tot, hatte sie und die Kinder mittellos zurückgelassen und Wilhelmine dachte ernsthaft darüber nach, wie sie wohl nach Hause kommen könnte. Ach, wie sehnte sie sich danach, einen Gottesdienst in der heimischen Kirche zu besuchen. Wie gern würde sie einmal wieder mit Nachbarinnen plaudern, ohne nach den richtigen Worten suchen zu müssen und für ihre Unbeholfenheit belächelt zu werden. Die Kinder könnten die deutsche Schule besuchen und mit Freunden spielen, deren Eltern ihnen die gleichen Märchen erzählten wie die eigene Mutter. Sie würden die Sitten und Gebräuche ihrer Vorfahren kennenlernen und nach ihren Gesetzen leben.
Ja, so wollte es Wilhelmine. Ihr Ziel war es, irgendwie nach Teplitz zu gelangen und dort im Hause ihres Schwagers um Aufnahme für sich und ihre Kinder zu bitten. Doch wie sollte sie das beginnen? Der Wagen war längst verkauft, ein Pferd hatte sie auch nicht. Selbst wenn sie Pferd und Wagen besäße – wie sollte sie den Weg finden? In solchen Dingen war Wilhelmine nicht bewandert, außerdem waren sie damals kreuz und quer durchs Land gezogen, ehe sie sich hier niederließen. Konnte sie es zudem wagen, eine Reise, die mehrere Wochen dauerte, ganz ohne Schutz vor Raubtieren und Wegelagerern zu beginnen? Schließlich waren die Kinder noch klein, obgleich sich Jacob mit seinen fast dreizehn Jahren schon für einen Mann hielt.
Wilhelmine dachte nach. Schließlich suchte sie den Briefumschlag heraus, den vor Jahren die Schwägerin geschickt hatte. Er lag mit einigen anderen Papieren wohlverwahrt in dem Holzkästchen unter der Bibel. Den Brief hatte Wilhelmine damals ins Feuer geworfen, den Umschlag jedoch aufbewahrt. Jetzt malte sie sorgfältig die Zahlen und Buchstaben der Adresse ab, die als Absender auf der Rückseite des Umschlages stand. Dann machte sie sich daran, einen Brief zu schreiben. Diese ungewohnte Arbeit war für sie mühsam und langwierig. Die richtigen Worte waren schwer zu finden und noch schwerer zu buchstabieren. Bis spät in die Nacht saß sie bei Kerzenlicht am Tische und grübelte, derweil die Kinder schon in tiefem Schlafe lagen. Doch endlich war sie zufrieden, faltete das Schreiben und verschloss sorgfältig den Umschlag. Jacob musste ihn gleich am nächsten Morgen aufs Postamt bringen. Von diesem Tage an wartete Wilhelmine auf ein Zeichen aus der Heimat.
* * *
Der Brief machte eine lange Reise.
Er rumpelte mit dem Pferdewagen übers Land, wurde an vielen Poststationen verladen und mehrfach sortiert und gestempelt. Auf seiner langen Reise nach Westen wurde er sogar ein Stück von der Eisenbahn transportiert, deren Netz zu jener Zeit bereits im Bau war. Am ersten Oktobertag traf der Brief in Teplitz ein. Der Gemeindeschreiber, der Pisar, bekam ihn zusammen mit der übrigen Post ausgehändigt. Da der Briefwechsel zu jenen Zeiten noch nicht so häufig ausgeübt wurde, gab es keinen Briefträger, obwohl Teplitz eine Kreisstadt war. Der Gemeindediener erledigte das Austragen der wenigen Briefe. Da aber Herr Otto Müller, der Pisar, ein Nachbar der Familie Haisch war, nahm er den Brief auf dem Heimweg selber mit. Er drückte Ludwig, welcher sich auch gerade auf dem Heimweg befand, das Papier in die Hand, rief einen Gruß und fuhr weiter.
Verwundert drehte der Bursche den Brief hin und her. Wilhelmine Haisch? Diesen Vornamen hatte er nie gehört. Seine große Schwester hatte ihm mal von Verwandten erzählt, die nach Russland ausgewandert waren. Sollten die das sein? Ludwig strich sorgfältig den Schmutz von den Schuhen, bevor er das Haus betrat. Er spähte um die Ecke. Ah, die Mutter war noch im Stall oder in der Küche. Entspannt betrat Ludwig die Stube, um gleich darauf zusammenzuzucken.
„Ludwig!“, ertönte eine schrille Stimme. Gertrud stand in der Tür, die Fäuste in die Hüften gestemmt. Die viel zu weiten Kleider schlotterten um ihre hagere Gestalt. Sie war jetzt etwa vierzig, sah aber älter aus. Ihr Hals war faltig und meistens vorgestreckt wie bei einem misstrauischen Huhn. Dieser Vergleich drängte sich jedem auf, der sie ansah, denn ihre lange Nase über dem verkniffenen Mund fuhr wie ein Schnabel überall hin, nichts blieb ihr verborgen. Da hatte sie schon den Brief erspäht.
„Was hast du da?“, wollte sie wissen. Ludwig gab den Brief wortlos heraus. Nach einem kurzen Blick auf die Adresse riss sie sogleich den Umschlag auf. Ludwig wusste, dass ‚Viktor Haisch‘ auf dem Kuvert stand, hütete aber seine Zunge. Ohnehin war er froh, dass der Brief die Mutter von ihm ablenkte. Bestimmt hätte sie wieder wegen irgendetwas mit ihm geschimpft. Als er sich an den Tisch setzte, betraten sein Vater und die beiden jüngeren Geschwister den Raum. Ilse war neun, Arthur sieben Jahre alt. Hanna war jetzt zwanzig und seit zwei Jahren verheiratet. Sie wohnte weit weg in Lichtental, fast dreißig Kilometer von zu Hause entfernt, und darum beneidete sie Ludwig von Herzen.
Ilse huschte in die Küche, um nach dem Abendessen zu sehen. Sie war ein kräftiges Mädchen und der Mutter sehr gehorsam. Ihren jüngeren Bruder kommandierte sie gern herum, so wie sie es bei den Eltern sah. Selbst bei Ludwig, der fast fünf Jahre älter war als sie, versuchte sie es bisweilen. Arthur hielt sich gern an den Vater. Obgleich er äußerlich nach der Mutter kam, hatte er die Mentalität seines Vaters geerbt. Gemeinsam werkelten sie im Hof, besorgten Stall und Feld. Als alle um den Tisch saßen, warf Gertrud den Brief auf den Tisch.
„Hier ist etwas gekommen, Viktor, das schlägt dem Fass den Boden aus! Ich kann es kaum glauben, wie viel Frechheit in diesem Weibsbild steckt. Trägt den halben Hausrat fort, nimmt in der schlimmsten Hungerzeit alle Vorräte mit und lässt uns mit der ganzen Arbeit und zwei alten Leuten hier sitzen! Und jetzt denkt sie, dass sie sich mit ihren Bälgern hier einnisten kann, nur weil ihr der Mann gestorben ist ...“
Viktor, der bis dahin verständnislos zugehört hatte, fuhr auf.
„Jacob?!“, rief er und ergriff das Papier. Seine Augen überflogen die Zeilen. „Ein Unfall!“, murmelte er tonlos und ließ das Blatt sinken. Die Kinder saßen gespannt um den Tisch und sahen den Vater an. In der Mitte stand unbeachtet die Schüssel mit den dampfenden Maiskolben. Auf dem Herd wartete noch ein Topf mit Hühnersuppe. Selbst Gertrud spürte, dass sie jetzt schweigen sollte. Sie teilte die Schüsseln aus, während Viktor den Brief mit zitternder Hand ergriff und noch einmal halblaut vorlas:
„Lieber Schwager!
Nun muss ich dir Nachricht geben vom Tode Jacobs. Er starb durch einen Unfall
bei der Arbeit. Er wurde mit Gottes Segen in geweihter Erde bestattet. Wir sind
nun sehr traurig und einsam. Leider bin ich mittellos. Ich möchte dich bitten,
uns wieder aufzunehmen. Wir wissen doch nicht, wo wir sonst hinsollen und
wir sind doch eine Familie. Da ist noch eine große Bitte, die ich an dich habe.
Lieber Viktor, du musst uns helfen, nach Hause zu kommen, denn ich weiß nicht
wie ich das anstellen soll. Wir haben weder Pferd noch Wagen. Ach Viktor, ich
bin sehr verzweifelt und hoffe auf deine Hilfe. Meine Kinder und ich können
dir bestimmt sehr nützlich sein in der Wirtschaft. Jacob ist schon zwölf Jahre alt
und sehr kräftig. Er arbeitet gut und ausdauernd. Emilie ist zehn und Paula
sechs Jahre. Sie sind fleißige Mädchen, können beide spinnen und stricken.
Emilie kann auch kochen und backen. Die Zwillinge heißen Eduard und Selma.
Sie sind jetzt zwei Jahre alt und machen überhaupt keineUmstände, auch essen
sie sehr wenig. Ich bete jeden Tag, dass ich Antwort aus der Heimat erhalte.
Lieber Schwager, Gottes Dank sei dir beschieden, wenn du deiner Familie in
dieser Not beistehst.
In Liebe und Dankbarkeit
Deine Wilhelmine
Als Viktor geendet hatte, herrschte betroffene Stille am Tische. Wie auf ein geheimes Zeichen schauten alle Kinder auf die Mutter.
Viktor sagte gequält: „Wir müssen ihr doch helfen!“
Gertrud nahm sich mit spitzen Fingern einen Maiskolben aus der Schüssel. Ihrem verkniffenen Gesicht war unschwer die Verachtung abzulesen.
„Möchte wohl noch abgeholt werden, die Dame, wie? Mit zwei Rossen vor einer goldenen Kutsche, was? Wo sind denn Pferd und Wagen, die sie von hier mitgenommen haben? Trägt den halben Hausrat fort ...“
„Aber Gertrud!“, rief Viktor. „Das war sein Erbteil!“
„Na und?“, entgegnete sie spitz. „Haben alles verjubelt und kommen jetzt angekrochen, um sich auf unserer Hände Arbeit auszuruhen!“
Viktor beugte sich vor. „Gertrud, mein Bruder ist tot! Das macht mich zum Vormund seiner Kinder, begreifst du das nicht? Ich kann sie doch nicht einfach ihrem Schicksal überlassen!“
„Ich will sie aber nicht hierhaben!“, fauchte Gertrud böse.
„Warum bist du nur so hartherzig, Frau?“ Viktor schüttelte fassungslos den Kopf. „Sie hat hier gelebt, ihr habt euch gegenseitig bei den Geburten beigestanden. Sie war doch immer freundlich und bei allen beliebt – nur bei dir nicht! Seit Jacob und Wilhelmine weggezogen sind, durfte in deiner Gegenwart nicht einmal mehr über sie gesprochen werden. Die Kinder wissen gar nicht, dass sie einen Onkel hatten.“ Viktor wandte sich an Ludwig, der wie seine Geschwister den Vater verblüfft anstarrte. Solche Töne von ihm waren neu. „Kennst du noch deinen Onkel Jacob?“, fragte Viktor seinen Sohn.
Ludwig schielte unsicher zur Mutter und hob die Schultern. „Hanna hat mir mal von Verwandten erzählt, die weggezogen sind, als ich noch klein war. Erinnern kann ich mich nicht.“
„Du warst drei!“, nickte Viktor nachdenklich. Er war sichtlich erschüttert über den Tod des Bruders. Gertrud merkte, dass sie diesmal mit dem üblichen Befehlston bei Viktor nichts ausrichten konnte und verlegte sich auf überzeugende Worte.
„Du musst doch einsehen, Mann, dass kein Platz im Hause ist. Es war damals schon sehr eng, als Hanna und deine Eltern noch hier lebten. Sechs Personen mehr! Herrjeh, wo sollen die denn hin in dem kleinen Haus?“ Giftig fügte sie hinzu: „Die meisten bauen ja schon ein Großes, nur du kannst dich nicht aufraffen!“
Tatsächlich war es so, dass die Häuser in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sogenannten ‚Kronshäuschen‘, sehr einfach gebaut waren. Anfangs hatten sie die Lehmhütten der Gründungskolonisten abgelöst und galten als modern, weil sie aus Stein erbaut waren. Sie bestanden aus zwei Zimmern, der Küche und dem Hausflur. Außer dem Pastorat, das schon damals mit Dachpfannen gedeckt war, bestand die Dachdeckung aller übrigen Häuser aus Rohr. In den Jahren um und nach der Jahrhundertwende setzte allmählich eine Veränderung der Hofanlagen ein. Man wollte es komfortabler haben. Die Männer schlugen Steine aus den Steinbrüchen am südlichen Höhenzug des Kogälniktales, welche gute Muschelkalksteine bargen, und bauten damit geräumige Häuser, breitere Stallungen, Mauern und Brunnen. Alles wurde hübsch weiß getüncht und war der Stolz eines jeden Hausherren. Im Winter, wenn die Feldarbeit ruhte, gingen die Männer in die Steinbrüche. Hatte die Gemeinde dorfeigene Steinbrüche, so wie es zum Beispiel in Teplitz und Alt- Elft der Fall war, hatte jeder Familienvater das Recht, so viele Steine zu brechen, wie er zum Eigenbedarf brauchte. Freilich gab es auch Unglücksfälle, bei denen es manchmal sogar Todesopfer zu beklagen galt. Vor vier Jahren hatte sich Viktor einen bösen Beinbruch zugezogen, als herabstürzende Steine ihn begruben. Er konnte froh sein, dass er mit dem Leben davongekommen war. Das Bein heilte, aber es schmerzte bei Wetterwechseln und schwoll an, wenn es zu sehr belastet wurde. Viktor humpelte leicht und mied fürderhin den Steinbruch. Das nahm ihm Gertrud übel, denn natürlich wollte auch sie ein großes Haus haben. Jetzt musste sie erleben, dass ein Nachbar nach dem anderen mit dem Bau begann, nur Viktor tat nichts dergleichen. Sein Ehrgeiz war dem jahrzehntelangen ehelichen Terror zum Opfer gefallen. Alle ihre Hoffnungen ruhten auf Ludwig, der nun langsam ein Mann wurde. Ludwig aber hatte vor, so bald wie möglich dem mütterlichen Einfluss zu entkommen. Er wollte sich, sobald er sechzehn Jahre alt war, irgendwo als Knecht verdingen - möglichst weit weg von zu Hause. Selbstverständlich verschwieg er seine Pläne. Gertrud meinte, sie hätte den Jungen genau wie ihren Mann unter Kontrolle. Ihr kam gar nicht in den Sinn, dass Ludwig rebellische Gedanken hegen könnte.
Nach Gertruds Bemerkung über den gewünschten Hausbau hatte Viktor schweigend zu essen begonnen. Anschließend stand er auf und ging ohne ein Wort hinaus. Wahrscheinlich war, wie so oft, die Weinschänke sei Ziel. Gertrud starrte ihm mit finsterem Gesicht hinterher. Als auch noch die Haustür geräuschvoll ins Schloss fiel, war ihre Laune vollends verdorben. Die Kinder folgten ihrem Instinkt und verschwanden lautlos wie Mäuschen in ihren Löchern. Wütend räumte Gertrud den Tisch ab und schimpfte dabei vor sich hin.
„Sie war freundlich und beliebt, pah!“ Viktor hatte Gertruds wunden Punkt getroffen. „ Außerdem hübsch und klug und von angenehmen Wesen – ich weiß, ich weiß!“ Aufgebracht stocherte Gertrud mit dem Haken im Feuerloch. „Das könnte der so passen, hier einfach wieder aufzutauchen und alle um den Finger zu wickeln! Jetzt bin ich hier die Hausherrin, und zwar alleine!“ Triumphierend richtete sie sich auf und schüttelte den Schürhaken gegen einen unsichtbaren Gegner. Dann lachte sie schrill. „Wenn ich die Alte losgeworden bin, schaffe ich das bei dir auch, mein Täubchen - wart’s nur ab! Und wenn ich wieder mal nachhelfen muss, dann tue ich das eben!“
Gertrud beendete ihr Selbstgespräch, band die Schürze ab und verließ ebenfalls das Haus. In einer Ecke des Flures löste sich ein Schatten aus dem Dunkel. Betroffen schaute Ludwig seiner Mutter nach.
Gertrud eilte zielstrebig die Straße hinunter. Den Nachbarinnen, denen sie begegnete, schenkte sie nur ein kurzes Nicken. Den alten Männern, die auf den Straßenbänken unter den Bäumen im Schatten saßen, gönnte sie einen knappen Gruß. Ihre geheuchelte Unterwürfigkeit gegenüber Höhergestellten und die rechthaberische Art, die sie Gleichgestellten gegenüber hatte, machte Gertrud im Dorf sehr unbeliebt. Die meisten Leute mieden sie. Da die Haischs auch keine weitläufige Verwandtschaft hatten wie die meisten Familien, blieben sie bei vielem außen vor. Zu Hochzeiten wurden sie nicht eingeladen, als Taufpaten wollte sie keiner haben, Frauennachmittage im Pfarramt fanden ohne Gertrud statt. Die Kinder vermieden es, Freunde mit nach Hause zu bringen, deshalb blieben auch sie unter den Schulkindern Einzelgänger. Einzig Viktor pflegte in der Weinschänke Kontakt zu den Nachbarn. So wie heute. Die Bauern bedachten ihn mit gutmütigem Spott. Viktor spürte jedoch, dass die Männer im Grunde Mitleid mit ihm hatten und so ertrug er auch ihre Verachtung. Heute saß er mit dem alten Anton Schütze in der Gaststube. Als einzige Gäste hockten sie am hintersten Tisch und tranken schweigend ihren Wein aus den groben Glasbechern.
Viktor brütete über seinem Problem. Dieses Weib! Konnte sie nicht so sein wie die meisten anderen Frauen? Was hatte er nur damals an ihr gefunden? War sie jemals jung und hübsch und liebenswert gewesen? Viktor schüttelte resigniert den Kopf über sein Unglück.
„Hast wohl Probleme daheim?“, fragte der Alte.
Viktors trunkener Kopf ging vom Kopfschütteln in ein Nicken über.
„Musst halt mal mit der Faust auf’n Tisch haun!“, schlug Anton vor. Feixend fügte er hinzu: „Aber sieh zu, dass du vorher das gute Tischtuch runternimmst, sonst kriegst Ärger!“ Er lachte schallend und schlug Viktor mit seiner derben Pranke auf den Rücken.
„Ach, es ist viel schlimmer!“, seufzte Viktor. „Mein Bruder, der Jacob, ist in der Fremde gestorben.“ Anton wurde ernst. „Meine Schwägerin will nun wieder heimkommen, aber die Gertrud will sie ums Verrecken nicht dahaben. Was soll ich jetzt nur machen?“
Anton verarbeitete die Neuigkeiten nur langsam. Auch er hatte schon einiges getrunken.
„Jacob? Ach, der Jacob! Ein guter Bursche, schad ist’s um ihn. Er war doch noch jung. Woran ist er denn gestorben?“
Viktor überlegte, aber er hatte es vergessen. Stand das überhaupt in dem Brief? Er hätte ihn mitbringen sollen.
Inzwischen war es Abend geworden und es trafen immer mehr Männer in der Weinschänke ein. Müde und zufrieden nach einem guten Erntetag, an dem sie Mais und Melonen von den Feldern gefahren hatten, kamen sie einzeln und in Grüppchen, zwirbelten die Schnauzbärte und freuten sich auf den wohlverdienten Feierabend mit einem ordentlichen Glas Wein und einem Schwätzchen unter Nachbarn. Einige kamen direkt vom Feld und hatten draußen ihr Fuhrwerk vor der Tür stehen, Jacken und Hosen aus grobem Tuch waren staubig. Andere hatten vorher zu Abend gegessen und erschienen gewaschen und umgezogen, sozusagen mit dem Segen ihrer Ehefrauen.
Anton Schütze erzählte jedem Neuankömmling sogleich von Jacobs Schicksal. Die Leute liebten Neuigkeiten, deshalb gruppierten sich alle um Viktors Tisch, begierig auf Einzelheiten. Viktor tat die Aufmerksamkeit wohl und er erzählte bereitwillig mehrmals von dem Brief, den Wilhelmine geschrieben hatte, von Gertruds Sturheit und was er jetzt unternehmen wollte - wenn er dürfte. Weil aber alle genau wissen wollten, was in dem Schreiben stand und er es partout nicht mehr zusammenbekam, machten sich ein paar Stunden später mehrere schwankende Männer auf den Weg zu Viktors Haus, um den Brief zu holen. Als der unordentliche Haufen schwatzend durch die Tür drängte, empfing sie eine aufgebrachte Gertrud. Ihre schrille Stimme ließ alle erstarren.
„Was soll der Lärm, dass alle Kinder aufwachen und die Nachbarn aus den Fenstern glotzen? Habt ihr vor, hier weiter zu saufen? Oder wollt ihr erst Viktors Arbeit tun, die er über der Flasche vergessen hat? Dann geht gleich raus, Ställe ausmisten und Wasser tragen!“
Stocksteif standen die Männer, dann schlich sich einer nach dem anderen unter Gertruds Gekeife aus der Tür. Junge, Junge, was für ein Drachen! Der Haisch war wirklich zu bedauern. Viktor, unbeeindruckt, weil abgehärtet, hatte derweil vergeblich auf dem Tisch und dem Ofensims nach dem Brief geschaut. Hatte ihn Gertrud vielleicht weggeworfen? Zuzutrauen wäre es ihr ja. Wie sollte man dann die Adresse herausfinden, unter der Wilhelmine jetzt lebte? Was sollte er den Nachbarn sagen?
„Wo hast du den Brief hingetan?“, fragte Viktor in eine Atempause Gertruds hinein.
Verdutzt hielt sie inne. Aber nicht lange.
„Den Brief?“, schrillte ihre Stimme. „Wo ich den Brief hingetan habe? Das wollte ich dich gerade fragen, mein Lieber. Den ganzen Abend habe ich ihn gesucht! Der Primar will ihn sehen, damit er Schritte unternehmen kann!“ Gertrud machte eine bedeutungsvolle Pause, damit sie Viktors verblüfften Gesichtsausdruck genießen konnte.
„Du - du warst beim Primar? Was denn für ... Schritte?“, fragte Viktor lahm. „Ich denke, du willst nicht, dass sie heimkommt?“
Gertrud lachte meckernd. „Das wird sie auch nicht. Ich habe heute auf dem Gemeindeamt in den Büchern nachschlagen lassen. Die Erbverhältnisse sind klar - Jacob ist ausbezahlt. Seinen Kindern steht in diesem Hause kein Wohnrecht zu, Vormund hin oder her. Gott sei Dank haben wir damals alles schriftlich gemacht und Jacob unterschreiben lassen.“
Viktor setzte sich langsam. Er war plötzlich wieder nüchtern.
„Und wo sollen sie dann hin?“, fragte er. Was hatte Gertrud nur wieder ausgeheckt? Seine Frau stützte sich auf den Tisch und beugte sich zu ihm vor.
„Hab nur keine Angst um deine Familie!“, sagte sie spöttisch. „Es geht ihnen dort besser als du denkst, glaube mir. Wilhelmine war halt schon immer ein bisschen wehleidig veranlagt. Wahrscheinlich hat sie längst wieder einen neuen Mann gefunden und bereut es schon, dass sie um Hilfe geschrieben hat. Niemand wird sich bereitfinden, sie heimzuholen. Das dauert ja Wochen! Wer soll so lange seine Wirtschaft im Stich lassen? Siehst du – das geht gar nicht.“ Als wäre Viktor ein törichtes Kind, so redete sie ihm zu. Doch jetzt wurde ihre Stimme schärfer. „Und wenn sie trotzdem irgendwann hier auftauchen sollte, habe ich vorgesorgt!“ Selbstgefällig verschränkte Gertrud die Arme vor der mageren Brust.
„Wie denn?“, fragte Viktor und wollte es doch eigentlich gar nicht wissen.
Gertrud lächelte liebenswürdig. „Nun, für Wilhelmine wird ein Mann gefunden, und ihre Kinder wachsen da auf, wo schon ihre Mutter großgeworden ist.“
„Was, im Waisenhaus?“, fuhr Viktor auf.
Das Alexander-Asyl in Sarata war eine Barmherzigkeitsanstalt mit Abteilungen für Alte, für Waisenkinder und für pflegebedürftige Geistesschwache. Die Anstalt war auf milde Gaben angewiesen und oft fehlte es am Nötigsten. Deshalb protestierte Viktor:
„Das kann doch nicht dein Ernst sein. Im Waisenhaus ist das Leben noch härter als auf einem Bauernhof, das weißt du genau!“
„Wilhelmine hat es ja wohl kaum geschadet!“, entgegnete Gertrud bissig.
„Aber wie kann man die Kinder weggeben, es sind doch meine Nichten und Neffen und keine Waisen. Niemand wird sie dort gern haben ...“
„Hier auch nicht!“, erwiderte Gertrud schroff. „Wenn wir alle Glück haben, kommen sie gar nicht hierher. Und nun genug gejammert, gib den Brief heraus, ich brauche ihn!“
„Ich habe ihn nicht, so glaube es doch. Ich habe ihn nicht mitgenommen, als ich ging, und du warst vor mir zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wo er abgeblieben ist!“ Gertrud und Viktor suchten nun sogar gemeinsam alles ab, doch der Brief blieb verschwunden.
Ludwig lag wie seine Geschwister wach im Bett und lauschte dem lautstarken Streit seiner Eltern. Es war ja nicht der erste. Ludwig wusste, wo der verschwundene Brief war. Am späten Nachmittag, als sein Vater in die Weinschänke und seine Mutter beim Schulzenamt gewesen war, hatte er den Pfarrer aufgesucht – mit dem Brief.
Ein furchtbares Geheimnis lag seitdem wie eine Zentnerlast auf seiner Brust.
Langsam senkte Herr Pastor Johannes Lehmann das Papier und nahm die Brille ab.
„Das ist ja wirklich sehr schmerzlich für deine Familie, mein Junge.“, sagte er mit seiner angenehmen, tiefen Stimme zu Ludwig, der vor ihm auf einem Stuhl hockte und die Mütze in den Händen drehte.
„Von wo kommt denn dieser Brief?“, fragte der Pfarrer und blickte auf die Rückseite des Umschlages. „Cherson!“, rief er aus. „So weit weg! Das muss ja fast bei der Krim sein. Wie um alles in der Welt hat es denn deinen Onkel dorthin verschlagen?“
Ludwig zuckte nur mit den Schultern. Seit er die Konfirmandenschule besuchte, war er öfter danach freiwillig zum Aufräumen dageblieben. Dem Pfarrer fiel auf, dass der Junge offensichtlich nur ungern nach Hause ging. Als guter Pfarrer erkannte er eine verstörte Seele, wenn er eine traf und als Vater von sechs Kindern wusste er mit Jugendlichen umzugehen. Mit freundlicher Anteilnahme gelang es ihm nach und nach, Ludwigs Vertrauen zu gewinnen. Seitdem war er der Ansprechpartner des Jungen bei all seinen Problemen. Pastor Lehmann war also mit der familiären Situation im Hause Haisch einigermaßen vertraut. Zögernd begann Ludwig zu sprechen.
„Vater will ihr schon helfen, aber er wagt es nicht. Ich glaube nicht, dass er was auf die Beine stellt. Die Mutter hat eine Wut auf die Tante. Wissen sie warum? Sie kannten sie doch, oder?“
Pastor Lehmann nickte, dann lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und schob die Daumen in die Weste. Sein Blick war an die Zimmerdecke gerichtet, als suche er dort nach längst vergessenen Gesichtern.
„Es war eine sehr angenehme junge Frau, gerade zwanzig Jahre alt. Man konnte sie eigentlich nur mögen. Sie war eine Waise und dein Onkel hat sie bei einem Fest in Sarata kennengelernt, wo sie im Waisenhaus als Betreuerin arbeitete, nachdem sie selbst dort aufgewachsen war. Ich war damals schon drei oder vier Jahre im Amt und kannte deine Großeltern recht gut. Sehr gute und gottesfürchtige Menschen! Dich habe ich getauft in demselben Jahr, als dein Onkel heiratete.“ Der Pfarrer schmunzelte zu dem Jungen hinüber. Ludwig lächelte auch und fühlte sich wie immer in der Gegenwart des Pfarrers sehr wohl. Dieser weißbärtige alte Herr war für ihn der Großvater, der ihm so früh genommen wurde. Ludwig fiel etwas ein.
„Woran sind eigentlich meine Großeltern gestorben?“
Der Pfarrer hätte beinahe den Kopf geschüttelt. Worüber wurde in dieser Familie eigentlich gesprochen? Er erhob sich etwas mühsam und zog nach kurzem Suchen ein großes, ledergebundenes Buch aus dem Regal. Er legte es auf den Schreibtisch und blätterte eine Weile.
„Da!“, rief er plötzlich und zeigte mit dem Finger auf einen Eintrag. Ludwig beugte sich ebenfalls über das Buch und las:
„Gottlieb Haisch – geboren am 26. August 1827 in Teplitz, gestorben am 8. April 1899 in Teplitz. Todesursache: Herzversagen.“ Aufblickend sagte Pastor Lehmann:
„Ich erinnere mich - er ist mitten bei der Arbeit gestorben. Plötzlich brach er zusammen, seine Lippen waren blau. Es ging schnell, er hat nicht gelitten. Du hast ihn wohl gern gehabt, was?“
Ludwig nickte. „Und meine Ahna?“, fragte er dann.
„Ach, die starb nur wenig später. Wie ich hörte, wollte sie schon damals deine Tante und deinen Onkel zurückholen, aber dann stürzte sie unglücklich die Scheunentreppe hinab und brach sich das Genick. Es war ein tragischer Unglücksfall. So etwas kommt vor. Wenigstens hat auch sie nicht gelitten.“ Pastor Lehmann verstummte und klappte das Buch zu.
Ludwig war der kalte Schweiß ausgebrochen. Was hatte die Mutter vorhin in der Küche gesagt? ‚Wenn ich wieder mal nachhelfen muss...‘. Ja, das waren ihre Worte gewesen. Er leckte die trockenen Lippen und fragte stockend:
„War sie denn ganz allein auf dem Scheunenboden, in ihrem Alter?“
Pastor Lehmann überlegte. „Nun, soviel ich weiß, war deine Mutter bei ihr – aber Junge, was hast du denn?“ Ludwig war bleich geworden. Hastig erhob er sich und verabschiedete sich eilig.
„Vielen Dank für alles, ich muss nun heim!“. Schon war er verschwunden. Den Brief ließ er liegen. Kopfschüttelnd blieb der Pfarrer zurück. Dieser Junge! Er nahm noch einmal das Schreiben und las es langsam durch. Zwischen den Zeilen las er nur eines: Heimweh!
Er erhob sich und steckte den Brief in seine Jackentasche. Dann verschloss er sorgfältig das Pastorat und begab sich nach oben in die Wohnräume, wo in einem hellen Raum seine Frau am Fenster saß und stickte. Frau Klara Lehmann war eine wohlbeleibte Matrone, die mit viel Herz und Verstand ihren großen Haushalt regierte. Ihre zwei Söhne und vier Töchter hatte sie mit fester und liebevoller Hand zu gottesfürchtigen, tugendsamen Menschen erzogen. Als ihr Mann das Pfarramt in Teplitz antrat, nahm sie sich voller Hingabe der Gemeinde an. Ihrem ausgeprägten Organisationstalent war es zu verdanken, dass Erntedankfeste, Christmessen und Ostergottesdienste in einer prachtvoll ausgeschmückten Kirche gefeiert wurden. Resolut regierte sie die Frauen und erwachsenen Mädchen, die den Blumenschmuck herstellten und die Kuchen backten. Auch der Frauenverein stand unter ihrem Zepter. Diese Frauenvereine gab es in fast allen deutschen Gemeinden und erfüllten durchaus einen wichtigen Zweck. Im Winter wurden dort nämlich viele wunderschöne Handarbeiten hergestellt, die dann alljährlich zum Wohle der Wohltätgkeitsanstalten in Sarata und Arzis versteigert wurden.
Als ihr Mann ins Zimmer trat, ließ Frau Lehmann den Stickrahmen sinken und schaute ihm aufmerksam entgegen.
„Na, mein Lieber, was war heute in der Amtsstube zu tun?“, fragte sie im abendlichen Plauderton. „Hast den Haisch-Ludwig dagehabt, oder? Gerade sah ich ihn davonlaufen. Wie der Wind ist er gerannt!“ Seufzend ließ sich der Pastor in einen Sessel sinken.
„Ach, der Junge ist mir ein Rätsel. Erst fragt er mir Löcher in den Bauch und dann rennt er plötzlich weg. Sieh mal, was er mir heute gebracht hat, das dürfte dich interessieren.“ Damit zog er den Brief hervor und gab ihn seiner Gattin, die sofort den Stickrahmen weglegte und sich in das Schreiben vertiefte.
„Ach“, sagte sie dann mitleidig. „Die arme Frau! Da muss man doch etwas unternehmen, Johannes! Glaubst du denn, dass die Familie sie aufnimmt?“
Pastor Lehmann schüttelte den Kopf. „Auf keinen Fall, Klara. Von Rechts wegen ist ja Viktor Haisch nun der Vormund der Kinder, aber ich glaube nicht, dass er dieser Rolle gerecht wird. Die Familie lebt beengt und die Frau ist... sie ist – du kennst sie!“
Die Eheleute wechselten einen bedeutungsvollen Blick. Nachdenklich überflog die Frau die Zeilen des Briefes.
„Nun ja, man könnte ...ich meine, es wäre bestimmt möglich ...Ich glaube, ich weiß etwas!“ Johannes Lehmann schmunzelte. Wenn er seine Frau so reden hörte, kam alles in die rechten Bahnen, darauf konnte er sich verlassen.
„Man müsste Pflegefamilien für die Kinder finden, oder sogar Adoptivfamilien. Würdest du mit überlegen, welche Familien man ansprechen könnte? Die arme Frau kann so viele Kinder unmöglich allein ernähren. Außerdem brauchen wir Heiratskandidaten. Wie alt wird sie denn sein? Johannes, so sag doch auch mal etwas - und lach mich nicht aus!“ In gespielter Empörung stemmte Frau Lehmann die Fäuste in die Hüften. Ihr Mann saß in seinem Sessel und lachte leise.
„Aber Klara, Liebes. Lass uns vorher überlegen, wie wir die Familie überhaupt aus Cherson nach Teplitz holen. Das ist eine sehr weite Strecke. Vielleicht kümmert sich ja der Haisch darum, aber das ist eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall werden wir das wohl auf einer Gemeindeversammlung besprechen müssen. Ehe das organisiert ist, hast du noch den ganzen Winter Zeit, mit deinem Frauenkränzchen Heiratskandidaten auszusuchen!“ Er lachte wieder. Würdevoll nahm Frau Lehmann wieder ihren Stickrahmen auf. „Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, Johannes! Darüber darfst du nicht scherzen. Eine Frau soll schließlich die treue Gefährtin ihres Mannes sein und dazu müssen sie zusammenpassen. Was die Kinder betrifft – die Kleinsten wird sie wohl behalten wollen. Die Größeren müssen bei gottesfürchtigen, verantwortungsbewussten Menschen untergebracht werden. Es gibt wirklich keinen Grund zum Scherzen!“ Pastor Lehmann stand auf und klopfte seiner Klara begütigend auf die Schulter.
„Nichts für ungut, meine Liebe. Ich weiß ja, dass die Angelegenheit bei dir in den besten Händen ist. Ich will nun zum Primar hinübergehen und die Sache auch mit ihm besprechen.“
Während Frau Lehmann in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne ihr Handarbeitszeug zusammenräumte, machte sich ihr Mann auf den Weg, um den Dorfschulzen aufzusuchen. Der amtierende Primar, Hermann Schenker, versah sein Amt mit Hilfe des Gemeindeschreibers Gustav Müller, welcher als Gemeindesekretär und Gesetzeskundiger eine wichtige Stellung innehatte. Bisweilen fungierte er sogar als Postbote, wie wir wissen. Diese Herren, aus der Mitte der Dorfbewohner auf drei Jahre gewählt, verwalteten die Gemeinde in dieser Zeit nach bestem Wissen und Gewissen. Der Pfarrer hatte jedoch eine Amtszeit von manchmal zwanzig Jahren und war deshalb mit den Belangen der Menschen, mit denen er es zu tun hatte, zutiefst vertraut. Aus diesem Grunde nahm die weltliche Behörde, die ja auch aus gläubigen Männern bestand, nicht selten die Hilfe des Pastors in Anspruch, wenn es die Situation erforderte. Herr Schenker, gerade von Gertrud Haisch heimgesucht, hielt die Situation für erforderlich. So kam es, dass sich der Herr Pastor und der Herr Primar mitten auf der Dorfstraße begegneten und sogleich eine angeregte Unterhaltung begann.
Auch an anderen Orten wurde an diesem Abend über Wilhelmine Haisch und ihre Kinder gesprochen. Die Männer, die aus der Weinschänke heimkehrten, erzählten die Neuigkeit ihren Frauen, und die besprachen es beim abendlichen Klatsch vor den Hoftoren mit den Nachbarinnen. Die meisten Leute, vor allem aber die Frauen, hatten Mitleid mit der Familie, und in einem war man sich einig: Man musste ihr helfen.
Wenn Wilhelmine, die als Fremde in einem fremden Land lebte, nur geahnt hätte, wie viel Anteilnahme die Menschen hier an ihrem Schicksal zeigten – wie glücklich würde sie das machen!
Wenn Gertrud, die als Fremde im eigenen Dorf lebte, ahnen würde, wie sich die Dorfgemeinschaft entgegen ihrem Willen auf die Heimkehr der Schwägerin vorbereitete, wäre sie weniger glücklich!
* * *
Für Wilhelmine und ihre Kinder wurde es ein harter Winter.
Das baufällige kleine Häuschen bebte und ächzte unter den orkanartigen Böen, die der Herbst alljährlich übers Meer schickte. Manchmal dachte Emilie, es würde gleich zusammenbrechen.
Die Mutter hatte im Herbst Kartoffeln, Bohnen und Melonen geerntet. Die halbreifen Arbusen hatte sie mit verschiedenen Küchenkräutern eingesäuert, wie sie es von daheim kannte. Auch ein paar Kürbisse lagen in der Speisekammer. Salz und Mehl würden allerdings nicht mehr lange reichen, auch der Tee und das Petroleum für die Lampe gingen zur Neige. Jeden Sonntag schlachteten sie ein Huhn und kochten es in dem großen Topf, die Brühe reichte dann die ganze Woche. Als kein Futter für die Kuh mehr da war, führte Jacob sie zu Wasile. Der versprach, einen guten Käufer zu finden. Tatsächlich brachte er eine Woche später ein ordentliches Geld und wollte nicht einmal Lohn dafür. Der wackere Wasile! Nun kauften Emilie und die Mutter noch einige Vorräte ein und hofften, dass der Winter nicht so lang und streng werden würde.
Ende November wurde es bitter kalt. Schwere Schneestürme fegten über das Land und verbannten die Menschen in ihre Häuser. Die kleine Selma bekam einen bösen Husten und musste wochenlang das Bett hüten. Fiebernd lag die Kleine auf dem Lager der Mutter und wurde zusehends schwächer. Zart und dünn war sie schon immer gewesen, nun wurde sie geradezu durchsichtig. Auch Wilhelmine wurde immer magerer. Vor lauter Sorge brachte sie oft keinen Bissen hinunter. Nächtelang saß sie am Bett ihrer Jüngsten, kühlte die kleine Stirn und betete.
Emilie hörte es im Halbschlaf. Der Sturm, der draußen ums Haus heulte und alles mit einem weißen Tuch bedeckte, die eintönige Stimme der Mutter, die Gebete murmelte oder Kinderreime aufsagte, schläferten sie allabendlich ein und begleiteten sie in ihre Träume. Trotz aller Sorgen und des Kummers um den Vater war es doch eine friedliche Zeit. Sie rückten alle enger zusammen, die Kinder stritten sich kaum und man ging sehr behutsam miteinander um, gleichsam um die heile Welt zu bewahren und kein neues Unglück heraufzubeschwören.
Wilhelmine hatte Jacob die Schnitzmesser seines Vaters überlassen. Nun hockte der Junge immer nachmittags und abends am warmen Herd und schnitzte mit Feuereifer kleine Tiere und Figürchen. In ein paar Jahren, prahlte er, würde er so geschickt sein, dass er die Sachen auf dem Markt verkaufen und die Familie reich machen würde. Wilhelmine lächelte nur. Wie bekannt kam ihr diese Prahlerei vor! Ihr Mann war auch so leicht zu begeistern gewesen und hatte nach den Sternen gegriffen, statt mit kleinen Erfolgen zufrieden zu sein. Derweil hielt sich Eduard an Jacobs Seite und freute sich über jedes neue Spielzeug.
Wenn die Haus- und Stallarbeit getan und die kleine Hütte saubergemacht war, saß Wilhelmine mit ihren älteren Töchtern auf der Ofenbank. Sie brachte ihnen das Stricken und Sticken, das Spinnen und Nähen bei. Die gesponnene Schafswolle und auch die daraus gestrickten Jacken ließen sich gut verkaufen.
„Spinnen am Abend: Erquickend und labend. Spinnen am Morgen: Kummer und Sorgen.“, pflegte Wilhelmine oft zu sagen.
„Wenn das Spinnen am Morgen Unglück bringt, warum tun wir es dann?“, fragte Paula einmal. Die Mutter lächelte.
„Ach, Kind, dieser Spruch heißt nichts anderes, als das diejenigen, die am Abend nach getaner Arbeit Wolle spinnen, dies nur zur Entspannung und zu ihrem Vergnügen tun. Dann ist es tatsächlich erquickend und labend. Arme Leute wie wir, die mit dem Spinnen ihr Brot verdienen müssen, haben Kummer und Sorgen - trotzdem wir schon am Morgen damit beginnen. Doch was hilft es, irgendwie müssen wir ja Geld verdienen. Also, an die Arbeit, Kinder!“
Gern hätte Wilhelmine die Mädchen auch im Weben unterwiesen, aber sie hatte keinen Webstuhl. Zu Hause, erzählte sie, gab es in jedem Haushalt einen Webstuhl. Alle Stoffe, grobe und feine, wurden darauf gewebt und anschließend daraus Kleider genäht. Man maß eine gute Hausfrau an der Qualität ihres Tuches! Aber auch die Männer gingen an langen Winterabenden ihren Frauen beim Weben zur Hand. Man konnte gutes Geld verdienen mit dem Verkauf von Stoffen. Ach, wenn sie doch nur einen Webstuhl hätten!
Oft traf man sich auch zu geselligen Runden und da wurde gelacht und gescherzt, Lieder gesungen und Geschichten erzählt. Wilhelmine wusste immer neue Einzelheiten aus dem Leben daheim zu erzählen. Dabei hatte sie den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend im Waisenhaus zugebracht. Bloß drei Jahre lebte sie im Haus ihres Mannes und lernte dort Sitten und Gebräuche des Familien- und Gemeindelebens kennen. Diese Zeit war aber für das einsame Mädchen so schön gewesen, dass sie sich heute noch an jedes Detail und jedes Fest genau erinnerte. Unschöne Erinnerungen verdrängte sie einfach.
Die Kinder lauschten und lernten. Längst hatten sie gemerkt, dass ihre Mutter sich von ganzem Herzen von hier fortsehnte. Richtig verstehen konnten sie es allerdings nicht. Das Leben hier war doch sehr schön! Die Ukrainer wussten auch fröhliche Feste zu feiern und im Sommer gab es wilde Reiterspiele, bei denen das ganze Volk auf den Beinen war. Ein Volk, freundlich und großherzig und so bunt wie die weiten Röcke und farbenfrohen Tücher der Frauen. Der Fluss und das nahe Meer boten viel Abwechslung, denn außer den Fischerbooten gab es auch oft fremdländische Schiffe und deren seltsame Fracht zu bestaunen. Das Rauschen des mächtigen Dnipro und das Kreischen der Möwen weckten Sehnsüchte nach fernen Ländern. Emilie gefiel es hier, warum also sollte sie fort?
Andererseits wurde sie durch die Erzählungen der Mutter auch zunehmend neugierig auf die alte Heimat, wo das Leben angeblich noch viel angenehmer war. Waren dort alle Leute blond? Sprachen wirklich alle deutsch? Wie sah die Landschaft aus? Wilhelmine beantwortete geduldig die Fragen ihrer Kinder. Sie erzählte ihnen auch von dem großen Land weit im Westen, das Deutschland hieß und aus welchem einst die Vorfahren aller Deutschen gekommen waren, die heute in großen Dörfern im Süden Moldawiens lebten.
„Warum ziehen wir nicht dorthin - nach Deutschland?“, fragte Emilie eines Tages die Mutter. Wilhelmine lachte unsicher. „Worauf du so kommst!“, meinte sie kopfschüttelnd. „Deutschland ist doch viel zu weit weg! Außerdem ist es schon voll, weißt du. Man hat dort keinen Platz zum Ansiedeln. Manche Leute wohnen sogar in Häusern übereinander!“
Die Kinder staunten. Übereinander wohnen! Sie stellten sich Deutschland wie einen Dorfplatz vor, auf dem gerade Markttag war. Wilhelmines Vorstellungen vom Mutterland waren freilich etwas verworren, aber Emilie gab sich damit zufrieden. Sie stopfte gerade einen Fäustling und war sehr in ihre Arbeit vertieft. Diese dünnen Fäden hatten ihre Tücken! Wenn man an einem Ende zu fest zog, war die gestopfte Stelle im Nu ein harter Klumpen, den man mit der Schere aufschneiden musste, nur um dann ein noch größeres Loch zu stopfen. Paula kniete am Fenster auf einem Stuhl und hauchte Löcher in die Eisblumen.
„Sei so gut und sieh nach Selma!“, bat die Mutter. Paula hüpfte zur Kammer. Selma hatte sich in den letzten Tagen gut erholt. Es war, als hätte man Wilhelmine einen Stein von der Seele genommen. Noch immer starben am Husten sehr viele Kinder und Selma war so zart! Der Doktor, der vor zwei Wochen dagewesen war, hatte teure Medizin dagelassen und der Mutter versichert: „Die Kleinsten und Dünnsten sind oft sehr zäh. Machen sie sich keine Sorgen, das wird schon wieder!“
Als er ging, waren die letzten Ersparnisse aus dem Erlös der Kuh aufgebraucht. Wenigstens hatte die Medizin geholfen und der Kleinen ging es von Tag zu Tag besser.
„Mama!“, rief es aus der Kammer. „Wann kommt denn das Christkindl?“
„Nicht mehr lange hin, Paula, nur noch sechs mal schlafen.“, antwortete die Mutter und schmunzelte zu Emilie hinüber. Die lachte:
„Heute musste ich ihr schon viermal sagen, wie lange es noch dauert. Wann backen wir Plätzchen, Mutterle?“
„Ach“, seufzte Wilhelmine, „ich muss sehen, ob ich überhaupt noch genug Zucker habe. Wenn doch nur die Hühner mal ein Ei legen wollten! Na, wir rühren schon was zusammen, gell?“
Emilie nickte. Sie warf den fertiggestopften Fäustling auf den Tisch und streckte sich. Vor zwei Wochen hatte sie Geburtstag gehabt und war nun elf Jahre alt. Ihre Mutter befand den Zeitpunkt für günstig, sie unter vier Augen über das Frauentum aufzuklären und was es mit dem Kinderkriegen auf sich hatte. Einiges hatte Emilie schon vorher geahnt oder sich zusammengereimt, aber jetzt, wo sie über alle Zusammenhänge Bescheid wusste, fühlte sie sich sehr erwachsen. Wilhelmine musste oft lächeln, mit welch herablassender Geduld Emilie jetzt manchmal mit ihren jüngeren Geschwistern umging. Gerade so, als wäre sie schon eine reife, abgeklärte Frau, die sich großmütig mit kleinen Kindern abgab. Meistens aber vergaß sie dieses Gehabe schnell wieder und dann war sie wieder das unbeschwerte Kind, das fröhlich spielte und lachte- und das war der Mutter auch lieber so. Ohnehin hatte das Mädchen schon viel zu oft die Pflichten einer Erwachsenen zu übernehmen, sei es bei der Feld- und Hausarbeit oder beim Kinderbetreuen. Außerdem ertappte sich Wilhelmine immer öfter dabei, wie sie ihrer ältesten Tochter ihr Herz ausschüttete und sie an ihren eigenen Problemen und Ängsten teilhaben ließ. War das gut für ein Kind? Wilhelmine wusste es nicht.
Es wurde wirklich Zeit, dass sie wieder unter Menschen kam. Ob sie noch einmal einen Mann fand? Sie war ja erst fünfunddreißig und eigentlich noch recht ansehnlich, wenn auch ein bisschen zu mager. Aber welcher Mann wollte schon eine Frau mit fünf Kindern heiraten? Wenn Jacob nur ein bisschen älter wäre! Der Junge wurde im Frühjahr dreizehn. Konnte ein Dreizehnjähriger seine Mutter und vier Geschwister ernähren? Wilhelmine blickte zu Jacob und Eduard hinüber, die auf dem Boden saßen. Jacob schnitzte. Eduard türmte geduldig kleine Holzscheite übereinander. Wenn er mal nicht hinsah, schubste Jacob den wackeligen Turm schnell mit dem Fuß um und freute sich diebisch, wenn der Kleine mit einem empörten Schrei herumfuhr. Edi hatte schon so eine Ahnung, dass sein Bruder hinter den Anschlägen steckte, aber mit unschuldigen Augen verstand es Jacob immer wieder, den Kleinen glauben zu machen, der Turm sei von allein umgefallen. Dieses Spiel konnte stundenlang so gehen, denn Edi wurde nicht müde, sein Türmchen immer wieder aufzubauen. Paula hatte sich in der Kammer zu Selma ins Bett gekuschelt und erzählte ihr Schauergeschichten von Hexen und Räubern.
„Das Holz ist alle, Jacob!“, meldete Emilie und sah ihren Bruder auffordernd an. Holzholen fiel in dessen Aufgabenbereich. Als Jacob sich widerwillig erhob und sein Schnitzmesser weglegte, stieß ihn Emilie verstohlen in die Seite. Schnell packte daraufhin Jacob seine Werkzeuge in ein Tuch und nahm sie mit hinaus. Emilie ging ein Weilchen später hinterher. Die Mutter stutzte, als sie bemerkte, dass Emilies Nähkörbchen fehlte. Die Beiden hatten wohl Heimlichkeiten? Da kam Selma im Hemdchen in die Stube getappt.
„Paula heia!“, krähte sie und klatschte in die Händchen.
„Selma, Kind!“, rief die Mutter. „Du sollst doch nicht aufstehen!“ Sie nahm die Kleine hoch und wickelte sie schnell in ihr Umschlagtuch. Als sie sie in die Kammer trug, lag Paula tatsächlich schlummernd in den Kissen. Die Wärme des Federbettes hatte sie schläfrig gemacht.
„Na, Traumsuse!“, rief die Mutter neckend und strich dem Kind über die Wange. „Willst wohl heute kein Abendessen, was?“ Verschlafen richtete sich Paula auf.
„Mama?“, fragte sie, sich die Augen reibend. „Ist das Christkindl jetzt da?“
Es wurde ein schönes Weihnachtsfest, wenn auch das Festessen recht kärglich ausfiel. Am Heiligen Abend nahmen sie am Gottesdienst mit anschließender Abendmahlsfeier in der kleinen Kirche teil und besuchten danach Wasile und seine Eltern. Die Kinder bekamen süßes Gebäck geschenkt und bedankten sich artig.
Wilhelmine hatte für Wasiles Mutter eine hübsche Linnenhaube genäht und schön bestickt.
Die alte Frau freute sich sehr und setzte die Haube auch gleich auf. Zu Wilhelmines Verblüffung band sie aber anschließend ihr großes, wollenes Kopftuch darüber. Wie haben sie zu Hause über diesen Vorfall gelacht!
Für alle Kinder hatte Wilhelmine eine Kleinigkeit vorbereitet. Jacob und Emilie bekamen schöne, warme Wollstrümpfe und fanden jeder ein glänzendes Geldstück darin. Paula freute sich über eine große Puppe aus Stoff, die ‚richtige‘ Augen aus Knöpfen hatte und ein rotes Kleidchen trug. Die beiden Kleinen bekamen neue Mützchen und dazu passende Handschuhe, außerdem zusammen ein Säckchen voller Bausteine. Die Klötzchen hatte Jacob in liebevoller Kleinarbeit aus verschiedenen Holzarten geschnitzt und geschmirgelt. Da war der Jubel groß! Sie schütteten die Bausteine auf den Boden und spielten den ganzen Abend damit. Edi machte später, als er Schlafen gehen sollte, solch ein Gezeter, bis er einen mit ins Bett nehmen durfte.
Auf dem Tisch stand ein großer Teller mit Äpfeln, Nüssen, Trockenpflaumen und Plätzchen. Die Kinder durften davon essen, soviel sie mochten.
Jacob und Emilie hatten für die Mutter in Gemeinschaftsarbeit ein Nähkästchen hergestellt. Es hatte mehrere Fächer und einen Deckel. Innen war es mit Stoff ausgeschlagen und ein hübsches Nadelkissen lag auch darin. Wilhelmine freute sich sehr und weinte sogar ein bisschen. Gleich räumte sie ihre Garne, Nadeln und die Schere in das Nähkästchen ein und versicherte den strahlenden ‚Großen‘, noch niemals solch ein schönes Geschenk bekommen zu haben. Dieses Weihnachtsfest war eines der schönsten, an das sich Emilie später erinnerte.
* * *
Es war ein klarer, kalter Morgen im Februar des Jahres 1906.
Die Wintersonne lugte gerade über den Hügel jenseits des Flusses, der fast zugefroren war. Als sie höher stieg, wurde aus der roten Sonne eine goldene, die blitzende Strahlen schickte. Ein paar davon erreichten soeben die Haustür der kleinen Hütte und spiegelten sich in den Scheiben des Fensters, als knarrend die Türe ein kleines Stück aufging und die winterliche Stille unterbrach. Emilie erschien mit einem Eimer. Hu, war das kalt! Sie stellte den Eimer ab und band schnell das Tuch um Kopf und Schultern, dann stemmte sie sich gegen die Tür, um mit ihr den Schnee wegzuschieben. Mit großen Sprüngen hüpfte das Mädchen über den frischgefallenen Schnee und hinterließ ihre Spuren im jungfräulichen Weiß. Am Brunnen zerbrach sie die Eisschicht, schöpfte Wasser in den Eimer und eilte schnell zurück ins Haus. Bald stieg Rauch aus dem Schornstein, es klapperte Geschirr und Stimmen ertönten. Ein Tag begann. Es sollte ein besonderer Tag werden, aber davon wussten sie noch nichts. Am Frühstückstisch diskutierte Jacob mit seiner Mutter darüber, ob er heute in die Schule gehen sollte oder nicht.
„Es ist kein Durchkommen draußen, sieh doch selbst!“, ereiferte sich Jacob gerade und zeigte aus dem Fenster, als tobe dort ein Orkan. Wilhelmine sah mit ihm hinaus. Friedlich hüpften die Spatzen über die zarte Schneedecke im Hof.
„Niemand wird da sein, wir werden wieder die einzigen sein!“ So schnell gab Jacob nicht auf.
„Wieder?“, fragte die Mutter und zog zweifelnd die Augenbrauen in die Höhe. „Warst du je der Einzige in der Schule? Ehrlich!“
Jacob wand sich. „Na ja, neulich haben drei Kinder gefehlt ...“
„Erkältet!“, warf Emilie im Vorübergehen ein, als sie die Kanne zum Tisch trug. Jacob warf ihr einen zornigen Blick zu.
„Na und, jedenfalls haben sie gefehlt!“
„Aber du wirst heute nicht fehlen!“, bestimmte die Mutter und goss Tee in die Tassen. Maulend ließ sich Jacob am Tisch nieder und schubste Emilie mit dem Ellenbogen.
„Wegen dir!“, raunzte er. Emilie schubste zurück.
„Warst ja heut noch nicht mal draußen, Maulheld!“
„Ziege!“
„Aber Kinder!“, mahnte die Mutter streng. „Esst jetzt und zankt nicht. Ihr müsst gleich los. Passt mir gut auf‘s Paulinchen auf!“
Paula durfte in diesem Winter das erste Mal mit in die Schule und war ganz begeistert. Strahlend und mit roten Wangen ging sie stolz zwischen ihren Geschwistern den langen Schulweg. Sie lernte gut. Zu Hause brachte ihr die Mutter noch das Schreiben und Lesen in deutscher Sprache bei. Das fiel Wilhelmine schwer, aber sie lernte es dadurch gleich selbst besser. Manchmal half ihr auch Emilie, wenn sie nicht weiterwusste. Die beiden Großen hatte damals Jacob die Buchstaben gelehrt.
Ach, Jacob! Wilhelmine dachte oft wehmütig an ihren Mann. Er fehlte ihr ständig. Darüber hinaus drückten sie finanzielle Sorgen. Im Frühjahr wurde die Pacht für das Häuschen fällig, wie sollte sie das Geld nur auftreiben? Sie hatte schon alles verkauft, was sich nur zu Geld machen ließ. Die Einkünfte aus den Handarbeiten reichten gerade so zum Leben. Es half alles nichts, sie brauchte eine Arbeit.
Als sie den Kindern nachschaute, die dick eingemummelt durch den Schnee stapften, waren schon einige Nachbarn auf der Straße unterwegs. Langsam belebte sich das kleine Dörfchen auf dem Hügel. Unten am Fluss lag die eigentliche Ortschaft Cherson, zu der das Dorf gehörte. Dort gab es auch Geschäfte und Werkstätten. Heute Nachmittag, wenn die Großen daheim waren, wollte Wilhelmine in die Stadt gehen und sich wieder einmal um Arbeit bemühen. Vielleicht fand sie etwas als Näherin oder Köchin. Viel Hoffnung hatte sie nicht, aber sie versuchte es dennoch. Wenn sie eine Arbeit fand, musste sie Emilie aus der Schule nehmen, denn da waren ja auch noch die Kleinen. Ach, wenn sie doch nur einen Webstuhl hätte!
„Das will ich nicht essen!“, sagte Selma und schob das Brot weg. Wilhelmine wandte sich seufzend den Zwillingen zu. Eduard langte sogleich nach dem Brot seiner Schwester und wollte es zu dem Stück in den Mund schieben, das schon seine Backen beulte. Er hatte immer Hunger! Wilhelmine nahm es ihm fort und stellte es wieder vor Selma hin. Doch die war mäklig. Sie mochte das schlechte Schrotbrot nicht, das wie Erde aussah und auch so schmeckte. Wenn wenigstens Butter drauf wäre! Aber es gab nur gesalzenes Schweineschmalz und das war schon alt.
„Iss, Kind, damit du groß und stark wirst. Bald ist Frühling, da gibt’s frisches Grün!“, versuchte die Mutter die Kleine zu trösten. Wenn der Schnee schmolz, suchten sie oft auf den Wiesen hinterm Dorf nach jungen Gänseblümchen, Löwenzahnblättern und Sauerampfer. Das gab einen erfrischenden Salat. Nach dem langen Winter mit einseitiger Kost hatten alle richtigen Heißhunger darauf. Aber dazu war es noch zu zeitig im Jahr, kein Blättchen zeigte sich auf den kahlen Flächen.
Wilhelmine sah nach, was sie noch in der Speisekammer hatte. Ein Bund Zwiebeln, drei Kürbisse und ein Säckchen Bohnen lagen noch da. Sie wünschte, es wäre ein Räucherschinken oder wenigstens eine Speckseite dabei! ‚Vielleicht mache ich heute eine Kürbissuppe ‘, dachte Wilhelmine bei sich. Dann hätten die Kinder heute Abend Kürbiskerne zum rösten. Die aßen sie so gern. Jacob könnte auch mal wieder zum Angeln an den Fluss gehen. Das tat er aber nicht gern, seit ihn mal große Jungen verprügelt, ins Wasser geworfen und seine Angelrute zerbrochen hatten. Er schnitzte sich danach zwar eine Neue, ging aber nur noch selten und am liebsten in Begleitung zum Angeln.
Als Wilhelmine den Hühnerstall ausmistete und die Kleinen im Schnee herumtollten, erschien plötzlich der Postzusteller auf dem Hof. Er war ein großer, dünner Mann mit einem gewaltigen, schwarzen Schnauzbart, der gerne mal ein Schwätzchen machte. Er war lustig, die Kinder mochten ihn. Meistens blieb er bei seiner wöchentlichen Tour kurz am Gartenzaun stehen und man wechselte ein paar Worte. Brachte er Post, bekam er einen Schnaps. Bei Haischs kehrte er nie ein. Heute jedoch kam er geradewegs auf den Stall zu, aus dessen offener Tür immer mal ein Haufen Stallstroh geflogen kam.
„Liebe Frau, wollen sie mich mit Mist bewerfen?“, rief der Mann laut und verdrehte theatralisch die Augen. Selma und Eduard kreischten vor Lachen. Erschrocken erschien Wilhelmine und ordnete schnell ihr Haar. Mit einer freundlichen Verbeugung reichte ihr der Postbote einen Umschlag und brachte sie damit in große Verlegenheit. Wo in alles in der Welt sollte sie einen Schnaps hernehmen?
„Nun, ich sehe, sie machen den Damen ein neues Bett!“, plauderte der Mann und deutete auf die Hühner, die gackernd ums Hühnerhaus drängten.
„Ach ja, sie sind nicht gern im Schnee!“, erwiderte Wilhelmine nervös und steckte den Brief in die Schürzentasche, damit sie ihn vor Aufregung nicht zerknüllte.
„Unsere legen zurzeit rein gar nichts, es müsste eben wärmer werden. Aber dann - plopp, plopp - kommen die Eierchen nur so geflogen, was?“ Der Mann schmunzelte und zwirbelte seinen Schnurrbart. Er hatte die Hoffnung auf ein Gläschen Schnaps noch nicht ganz aufgegeben, obwohl ihm seine langjährige Erfahrung sagte, dass hier nichts zu holen war. Alleinstehende Frauen hatten nur selten Alkohol im Hause und wenn doch - dann taugten sie nichts. Diese hier war ordentlich, das sah man gleich. Der Postbote scherzte mit den Kindern, die ihm lachend an den Beinen hingen. Wilhelmine hatte keine Lust auf Späße, sie wollte den Postboten so schnell wie möglich loswerden. Mit einem Blick hatte sie gesehen, dass der Brief aus Teplitz kam und war ganz begierig darauf, ihn zu lesen. Nach einer Weile, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, machte sich der Postbote wieder auf den Weg. Wilhelmine eilte ins Haus und ließ die Kleinen draußen spielen. Mit zitternder Hand riss sie den Umschlag auf und entfaltete das Blatt. Dank ihrer Übungen mit Paula konnte Wilhelmine mühelos die gestochen scharfe Schrift des Primars lesen.
Als sie auf der Hälfte war, musste sie sich setzen. Sie las den Brief dreimal. Dann stand sie langsam auf und ging zum Ofen, auf dessen Sims das Holzkästchen und die Bibel lagen. Nachdenklich verstaute sie den Brief im Kästchen, legte die Bibel wieder obendrauf und verharrte dann, die Hände noch auf dem Buch, für eine ganze Weile. Dann hob sie plötzlich den Kopf, ihre Augen funkelten.
„Das kommt überhaupt nicht in Frage!“, sagte sie laut und entschlossen, drehte sich um und ging wieder an ihre Arbeit.
Der Primar hatte ihr in seinem Schreiben die Hilfe der Dorfgemeinschaft zugesichert und das Eintreffen eines Wagens für das Frühjahr angekündigt. Zwei Männer des Heimatdorfes sollten sie begleiten. Weiterhin hatte er versichert, dass Pflegefamilien bereit seien, die Kinder aufzunehmen und für ihren Lebensunterhalt und ihre Ausbildung zu sorgen. Da sie kein eigenes Einkommen und auch keinen ererbten Grundbesitz ihr Eigen nannte, sollte Wilhelmine einige Heiratsangebote prüfen, welche die Pfarrersfrau zusammengetragen hatte. Sollte ihr von diesen keiner zusagen, stand es ihr frei, als Dienstmagd in Stellung zu gehen. Von ihrem Schwager Viktor war in dem ganzen Schreiben nicht die Rede.
So sehr Wilhelmine auf eine Antwort aus der Heimat gehofft hatte, so sehr widerstrebte ihr jetzt dieser Brief. Was dachten die sich eigentlich? Sie konnte doch nicht einfach ihre Kinder an wildfremde Leute verteilen und irgendeinen alten Hagestolz heiraten! Doch je länger Wilhelmine darüber nachdachte und alle Möglichkeiten abwog, die das Leben für sie und die Kinder zu bieten hatte, desto mehr musste sie erkennen: Es blieb ihr gar keine andere Wahl. Wilhelmine war eine gottesfürchtige Frau, aber sie glaubte nicht an Wunder. Nur mit einem praktischen Verstand kam man durch dieses harte Leben, und mit diesem praktischen Verstand begriff sie langsam: Es ging nicht anders. Wollte sie das Beste für die Kinder, dann musste sie sie weggeben. Zu dieser Erkenntnis zu gelangen war für Wilhelmine ein langer und schmerzhafter Prozess. In vielen Nächten weinte sie sich in den Schlaf und ihr Herz war schwer vor Kummer.
In den folgenden Wochen wurde die Nahrung immer knapper und auch Geld war keins mehr da. Die Wintervorräte gingen schnell zur Neige, gerade drei Hühner gackerten noch im Stall. Bald mussten auch die geschlachtet werden, wollten sie nicht Hungers sterben. Die Kinder waren ausgemergelt und schlapp. Jacob bräuchte dringend neue Schuhe, aber die waren teuer! Weil die alten gar nicht mehr passen wollten, zog er kurzerhand die vom Vater an, obwohl ihm die noch drei Nummern zu groß waren. Damit er hinten nicht hinaus rutschte, stopfte er vorne alte Lappen hinein. Er sah aus wie ein Clown!
Wilhelmine fand keine Arbeit in der Stadt, denn die Menschen hatten selbst nichts zu essen. Die wenigen Reichen stellten lieber Einheimische ein. Wegen ihres hellen Haares erregte Wilhelmine, als sie in Cherson auf Arbeitssuche war, die Aufmerksamkeit einiger Männer. Es waren zwielichtige Gestalten, die ihr bis nach Hause folgten und sich in den Abendstunden am Fenster einfanden, um ihr eindeutige Angebote zu machen. Wilhelmine stand Todesängste aus und verriegelte Türen und Fenster. Statt ihr zu helfen, schickten die Nachbarn nur argwöhnische Blicke und begannen alsbald zu tuscheln. Bald war die Fremde als Hure verschrien. Kein Ehemann verteidigte ihre Ehre, nicht mal einen Hund hatte sie zum Schutz. Selbst die Kinder bekamen Anfeindungen zu spüren. Als alleinstehende Frau war man Ungerechtigkeiten hilflos ausgeliefert, das musste Wilhelmine bitter erfahren. Die anhaltenden Feindseligkeiten und das schleichende Misstrauen vergifteten ihr das Leben, die bittere Armut laugte sie aus. Ach, wenn doch nur der Wagen käme!