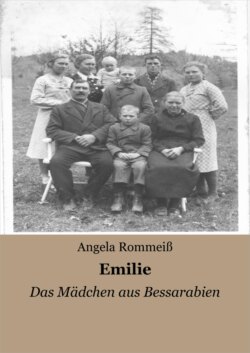Читать книгу Emilie - Angela Rommeiß - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HEIMKEHR
ОглавлениеDer Leitermacher Otto Jaske und der Steinmetz Albert Hanemann machten sich Anfang März 1906 auf den langen Weg nach Cherson. Auf der eigens einberufenen Gemeindeversammlung sollte ausgelost werden, wer sich dieser Aufgabe stellen musste, die ja einige Wochen Verdienstausfall mit sich brachte. Doch eine Auslosung war gar nicht notwendig geworden. Der Vater vom Steinmetz Albert Hanemann hatte den jungen Jacob Haisch seinerzeit als Schmiedelehrling ausgebildet, dabei waren die gleichaltrigen Jungen gute Freunde geworden. Albert war auch erst Schmiedelehrling gewesen, fand dann aber keinen Geschmack am Eisen. Ihm lag mehr die Kunst im Blute, schöne Grabsteine zu hauen und mit Ornamenten zu verzieren. Die Steinmetzerei erwies sich als einträgliches Geschäft, welches Albert zu einigem Wohlstand verhalf. Mittlerweile hatte er einen Gesellen in der Werkstatt, sein großes Haus versorgte seine Frau mit einer Magd, im Hof und auf dem Feld arbeiteten mehrere Knechte. So konnte er es sich leisten, ein paar Wochen ‚Ferien‘ zu machen, wie seine Frau es scherzhaft nannte. Sie ließ ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Gewiss würde er ihr fehlen, zudem sie gerade ihr drittes Kind erwartete. Andererseits war sie als frommer Mensch natürlich stolz auf ihren Mann, der die barmherzige Aufgabe übernahm, die Witwe und die Waisen seines Jugendfreundes aus der Fremde heimzuholen.
Die Motive dazu waren bei Otto Jaske eher geschäftlicher Natur, wenn auch nicht weniger ehrenhaft. Er verkaufte seine ‚Littern‘, wie die Leitern für die Leiterwagen genannt wurden, nicht nur unter der deutschen Bevölkerung Bessarabiens, seine Geschäftsbeziehungen führten ihn oft sogar bis zur Hauptstadt Kischinau. Bis zum Dnipro war aber auch er noch nicht gekommen. Meistens wurden geschäftliche Absprachen und Preisverhandlungen über Mittelsmänner geführt, was nicht immer zum Guten hinauslief. Außerdem war die Konkurrenz groß, man musste neuerdings auch Harken und Rechen herstellen, um den Umsatz zu machen, der notwendig war, eine große Familie zu ernähren. Und die hatte er! Zehn Kinder hatte seine gute Frau ihm geboren. Zwei starben im frühen Kindesalter, acht hatte Gott ihm gelassen. Otto Jaske gedachte, auf der Fahrt nach Cherson einige neue Abnehmer für seine Wagen und Gerätschaften zu gewinnen, deshalb war der zweite Freiwillige schnell gefunden.
Von Viktor Haisch wurde eigentlich auch erwartet, dass er sich der Mission anschloss, schließlich war er der naheste Verwandte und der gesetzliche Vormund der Kinder. Aber Viktor erschien nicht mal zur Versammlung.
Bei der Abfahrt war der Frühling in der Budschaksteppe schon zu spüren. Die Männer waren guten Mutes. Angetan mit ihren langen Schaffellmänteln, den ‚Fahrpelzen‘ und auf dem Kopf die hohen Pelzmützen, die so typisch für die bessarabischen Bauern waren, bereiteten sie sich auf die Reise vor. Gut verstaut lagen die Vorräte unter der Plane. Ihre Frauen hatten sie gut versorgt. Otto meinte lachend:
„Ihr denkt wohl, wir fahren zum Mond und wieder zurück?“
„Ach was!“, erwiderte seine Frau und packte noch ein Paket Brot und Speck dazu. „Wozu sollt ihr unterwegs zahlen, wenn’s hier mit Liebe zubereitet wurde!“ Schluchzend umarmte sie ihren Mann.
Unruhig tänzelten und scharrten die Rosse mit dampfenden Nüstern und wollten los. Lange hatten sie im winterlichen Stall gestanden, nun witterten sie Morgenluft. Die Tiere, an harte Arbeit gewöhnt, wollten bewegt werden. Wenn es statt der eintönigen Feldarbeit einen Ausflug zu machen galt, umso besser!
Winkend und rufend nahmen die Dörfler Abschied, dann setzte sich der Wagen rasselnd in Bewegung. Albert Hanemanns schwangere Frau Agnes stand mit den Kindern und den Bediensteten am Hoftor, winkte und wischte sich mit einem Tuche die Augen. Das letzte, was die Männer hörten, war das Geplärr von Alberts sechsjährigem Sohn, der durchaus nicht einsehen wollte, dass er zu Hause bleiben musste.
Mehrere Wochen dauerte die anstrengende Fahrt.
Die Männer verstanden sich gut und genossen die Abwechslung, die diese Reise ihnen in ihrem sonst recht eintönigen und arbeitsreichen Leben bot. Ende März, die ersten Frühblüher streckten gerade ihre Blütenköpfchen aus der Erde, kamen sie in Cherson an.
Es war am frühen Abend, die kleineren Kinder waren schon in den Betten. Auch Emilie schickte sich an, schlafen zu gehen. Auf Handarbeiten hatte sie heute Abend keine Lust. Die Mutter drängte sie auch nicht. Als sich Emilie unter die Flickendecke kuschelte, krampfte sich ihr Magen vor Hunger zusammen. Die dünne Mehlsuppe, die es zum Abendessen gegeben hatte, hielt nicht lange vor. Sie war zwar heiß und würzig, jedoch wenig nahrhaft gewesen. Morgen früh würde es Tee und ein Stück Brot geben. Bis dahin war es das Beste, einfach einzuschlafen, dann musste man nicht immerzu ans Essen denken. Manchmal meinte Emilie, sie würde nie wieder richtig satt werden. SATT ! Schon dieses Wort war schön!
„Satt, satt, satt.“, sang sie in Gedanken, schloss die Augen und gab sich ihrer Phantasie hin, die ihr Brathähnchen und Zuckerkuchen vorgaukelte. Als sie gerade ihre Zähne in ein Stück fetttriefendes Fleisch senken wollte, hörte sie Edi leise weinen. Das arme Kerlchen konnte nicht verstehen, warum er nichts zu essen bekam. Er war ja auch erst zwei. Wenn er größer war, würde er auch lernen, im Traum zu essen. In dem anderen Bett wälzte sich Paula unruhig im Schlaf. Paula! Neulich hatte sie Kerzenwachs gegessen und fürchterliche Bauchschmerzen bekommen. Zudem war die Kerze für die Kirche bestimmt gewesen und die Mutter schimpfte Paula tüchtig aus. Sie wurde schließlich bald sieben und sollte vernünftiger sein. Emilie drehte sich um und wollte einschlafen. Da klopfte es dreimal laut an die Tür. Sie schreckten hoch. Die Mutter rief auf Russisch: „Geht weg, was wollt ihr?“
Männerlachen ertönte. Eine tiefe Stimme antwortete: „Begrüßt man so seine Landsleute?“
Eine deutsche Stimme! Emilie sprang aus dem Bett, auch Paula sauste zur Schlafstubentür. Mit fliegenden Händen entriegelte Wilhelmine die Tür und öffnete sie dann zögernd. Da standen zwei bärtige Männer mit einer Laterne und der eine fragte mit stark schwäbischen
Akzent:
„Wohnt hier Wilhelmine Haisch, Witwe von Jacob Haisch?“
„Ja, kommen sie doch herein!“, rief die Mutter erfreut und machte die Tür weit auf. Den Augen der Männer bot sich eine Wohnstube, die wohl sauber und warm, jedoch sehr ärmlich eingerichtet war. Am Herd stand ein dünner Junge mit großen, tiefliegenden Augen. Er hatte sich mit einem Feuerhaken bewaffnet. Albert erkannte sofort die Ähnlichkeit, die der Junge mit seinem Vater hatte. An der Tür zur hinteren Kammer drängten sich ein paar magere Kinder, sie trugen nur ihre Hemdchen und sahen blass und krank aus. Mit geübtem Blick sahen die Teplitzer gleich: Hier herrschte der Hunger. Auch die Frau war abgehärmt, hatte aber schöne Gesichtszüge und klare Augen, in denen jetzt Tränen der Freude schimmerten.
„So kommen sie doch herein, ich - ich bin ja so froh, dass sie da sind - so zeitig! Möchten sie einen Tee? Sonst kann ich ihnen leider nicht viel anbieten, außer... vielleicht etwas Brot?“
Der Junge hatte den Feuerhaken weggelegt und kam jetzt schüchtern näher. Auch die anderen Kinder schubsten sich gegenseitig nach vorn. Die Mutter würde doch nicht etwa das Brot fürs Frühstück den Fremden zu essen geben?
Otto und Albert betraten den kleinen Raum und brachten einen Schwall frische, kalte Luft von draußen mit. Fahrig wischte Wilhelmine über den Tisch, rückte Stühle zurecht. Dann bemerkte sie die Kinder im Hemd.
„Emilie, Paula, zieht euch was an, aber schnell!“
Eduard war auch auf den Beinen, nur Selma schlief noch tief und fest.
„Vier Kinder?“, fragte Otto Jaske. „Ich dachte, es wären fünf. Ist denn eines - ich meine...“
„Nein, nein!“, rief Wilhelmine schnell. „Gottlob haben alle den Winter überlebt, auch wenn eines recht krank gewesen ist. Ich habe noch kein Kind verloren und danke jeden Tag Gott dafür.“
„Ich musste schon zwei begraben.“, meinte Otto Jaske und ließ sich auf einem der Stühle nieder. „Oh, das tut mir furchtbar leid!“, sagte Wilhelmine und legte voller Mitgefühl ihre Hand auf sie seine. Jacob saß Otto gegenüber und sah ihm forschend ins Gesicht. Albert Hanemann stand unschlüssig in der Tür. Dann drehte er sich plötzlich um und ging zum Wagen. Fragend sah Wilhelmine Otto Jaske an. Der grinste nur, weil er ahnte, was Albert vorhatte. Mit zwei großen Körben kam Albert zurück und stellte sie mitten auf den Tisch. Neugierig drängten sich die Kinder, inzwischen mehr schlecht als recht angezogen, um die Sachen, die der Besucher auspackte. Ach, was da alles zum Vorschein kam! Kuchen, Brot, Dauerwurst, Äpfel, Sirup, Kaffee, Zucker, Hafermehl und Bohnen. Es waren alles nur Reste vom Reiseproviant. Die Säckchen mit den Vorräten waren halb leer, die Brotscheiben wellten sich und die Äpfelchen waren schon runzlig. Von der Wurst waren nur noch ein Paar Zipfelchen da und die restlichen Stücke vom einst saftigen Maiskuchen waren hart und krümelig. Bauern warfen nie Essen weg.
In den Augen der hungrigen Kinder tat sich ein Schlaraffenland auf! Jubelnd fielen sie über die Köstlichkeiten her. Lachend rettete Wilhelmine die Sachen wieder in die Körbe, dann goss sie Tee auf und bereitete ein Festmahl. Jedes Kind bekam seinen Tee mit Zucker gesüßt, der Kuchen und das Brot wurden in gerechte Portionen geteilt und zu guter Letzt durfte sich jeder noch einen Apfel nehmen. Auch Wilhelmine aß mit Appetit. Sie war so glücklich, als sie ihre ausgehungerten Kinder mit leuchtenden Augen und vollen Backen essen sah! Die verschlafene Selma wollte erst weinen, als die Mutter sie behutsam weckte, aber dann saß sie mit großen Augen am Tisch und bestaunte die fremden Männer. Als sie merkte, dass es süß schmeckte, was man ihr gab, sperrte sie gleich das Mäulchen auf und war genauso verfressen wie ihr Zwillingsbruder.
Die Männer aßen nichts. Schmunzelnd saßen sie da, tranken ihren Tee und genossen das Gefühl, Wohltäter zu sein. Es war angenehm, jemanden mit ein paar Bröckchen trockenem Kuchen so glücklich zu machen! Noch nie war Agnes‘ Backwerk einen Monat nach seiner Herstellung noch solches Lob zuteil geworden. Allein für die Freude, die es machte, in solch strahlende und glückliche Kinderaugen blicken zu dürfen, hatte sich die lange Reise für die Männer gelohnt.
Paula saß bei Albert auf dem Schoß und erzählte von der Kerze, die sie letzte Woche gegessen hatte. Mit Docht! Albert lachte und sprach von seinen Kindern zu Hause. Ach, da ging die Fragerei los! Alle plapperten durcheinander und bestürmten die Gäste aufgeregt. Irgendwann fragte eines der Kinder, wie denn das Haus aussähe, in dem sie dann wohnen würden. Otto und Albert verstummten und schauten über die Köpfe der Kleinen zu Wilhelmine hinüber. Die schüttelte nur unmerklich den Kopf, was heißen sollte: Sie wissen es noch nicht!
Nach einer Stunde konnte Wilhelmine ihre Rasselbande so weit beruhigen, dass sie bereit waren, wieder ihre Lager aufzusuchen. Diesmal schliefen alle satt und zufrieden sofort ein. Die Erwachsenen saßen noch lange beisammen und redeten. Sie sprachen über Jacob und seinen Tod, über den harten Winter und natürlich über die Heimat. Sie besprachen auch die Einzelheiten der Rückreise. Die konnte durchaus länger dauern als die Herfahrt, denn der Wagen würde voll und damit schwerer sein. Außerdem brauchten die Kinder mehr Pausen. Die Männer dachten erst, sie müssten alle abwechselnd neben dem Wagen herlaufen, weil so viel Hausrat mitzuführen sei, aber dem war nicht so. Außer einer Truhe hatte Wilhelmine keine eigenen Möbel. Alles andere war schon im Haus gewesen und blieb hier.
Die Männer schlugen ihr Nachtlager wie gewohnt im Wagen auf, während sich Wilhelmine neben ihren Kindern zur Ruhe legte. Lange konnte sie nicht einschlafen, denn die Aufregung des Abends war zu groß gewesen. In ihrem Kopf jagten sich die widersprüchlichsten Gedanken und ließen sie nicht zur Ruhe kommen. In zwei Tagen sollte die Fahrt beginnen.
Die Formalitäten waren schnell erledigt.
Wilhelmine kündigte beim Vermieter den Pachtvertrag, meldete die Kinder von der Schule ab und sagte dem Dorfvorsteher Bescheid. Dann besuchte sie mit den Kindern das letzte Mal Wasile und seine Eltern. Der gute Bursche hatte die ganze Zeit zu ihnen gestanden und geholfen, wo er nur konnte. Nun umarmten sie sich unter Tränen und wünschten einander alles Gute für die Zukunft. Länger dauerte der Abschied auf dem Friedhof. Weinend standen sie alle sechs am Grab des Vaters und sagten ihm Lebewohl. Paula legte eine Handvoll Gänseblümchen auf den kleinen Hügel. Als die Kinder schon längst wieder zu Hause waren, kniete Wilhelmine immer noch da und hielt innere Zwiesprache mit ihrem toten Mann. In tiefem Gebet versunken fühlte sie sich seinem Geist so nahe, dass sie sicher war, Jacob könne sie hören. Leise begann Wilhelmine zu sprechen.
„Wir ziehen morgen wieder nach Hause, Jacob! Hier können wir nicht bleiben, noch so einen Winter überleben wir nicht. Es kann sein, dass ich wieder heirate. Vielleicht aber auch nicht. Unsere Kinder gebe ich zu Pflegeeltern. Es ist das Beste für sie, glaube mir! Im Gesetz steht, dass sie einen männlichen Vormund haben müssen. Dein Bruder ist selber arm, und sie sollen es doch einmal besser haben! Ach, Jacob, ich will ja nur nicht, dass sie im Waisenhaus landen, so wie ich. Du warst mir ein guter Mann, Jacob, und ich habe dich sehr lieb gehabt. Wer weiß, ob ich es noch einmal so gut treffe. Aber eine alleinstehende Frau gilt nicht viel, das weißt du ja. Ach, warum musstest du nur sterben, wir hätten noch so viele gute Jahre miteinander haben können!“ Wilhelmine schluchzte. „Nun liegst du hier ganz alleine in fremder Erde. Ich kann dich dann nicht mehr besuchen. Wasile hat versprochen, dein Grab zu pflegen, und das tut er auch, bestimmt! Ach, Jacob, nie wieder werde ich einen Mann so sehr liebhaben wie dich!“ Wilhelmine weinte bittere Tränen.
Mit verschwollenen Augen kam sie eine Stunde später vom Friedhof heim, ihr Rock war vom Knien ganz schmutzig. Albert und Otto wechselten verstehende Blicke und beluden schweigend den Wagen. Decken und Kissen wurden so gelegt, dass gleich bequeme Lager für die Kinder entstanden. Die Wäsche packte Wilhelmine in Bettbezüge. Spielzeuge, Spinnrad und Küchengeräte kamen in Kisten. Stall und Hof wurden noch einmal ordentlich gefegt, auch das Häuschen war sauber und bereit für neue Mieter. Niemand sollte ihnen nachsagen, sie wären liederliche Menschen gewesen.
Als sie am Morgen des 1. April 1906 aus ihren provisorischen Betten stiegen, waren alle sehr aufgeregt. Heute ging es los! Die Kleinen wurden warm eingepackt und in den Wagen gesetzt. Die Pferde mussten noch einmal getränkt werden. Derweil ging Emilie ein letztes Mal durch die Räume des Häuschens, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte.
Dass die nun vorbei war, ahnte sie bereits. Die Mutter war in den letzten Wochen so niedergeschlagen und bedrückt gewesen wie kurz nach dem Tod des Vaters im vergangenen Herbst. Hing das mit dem Brief zusammen? In einem unbewachten Moment hatte ihn Emilie heimlich hervorgeholt und gelesen. Alles verstand sie nicht, aber das Wort ‚Pflegefamilien‘ machte ihr doch zu schaffen. Emilie war noch zu sehr ein Kind, als dass sie ernsthaft daran glaubte, ihre Mutter würde eines Tages nicht mehr für sie da sein. Wenn sie bei fremden Leuten wohnen müsste, dann doch höchstens ein paar Wochen oder Monate! Außerdem könnte sie die Mutter sicherlich jeden Tag besuchen, weil sie bestimmt ganz in der Nähe wohnen würde. Große Sorgen machte sich das Mädchen also nicht. Trotzdem hielt sie ein seltsames Gefühl im Bauch davon ab, die Mutter direkt zu fragen. Auch mit ihren Geschwistern sprach sie nicht darüber.
Emilie ging noch einmal zum Fenster in der Kammer, wo sie alle geschlafen hatten. Manchmal, wenn die Geschwister schon schliefen und die Eltern noch draußen in der Stube saßen, hatte sie hier am Fenster gestanden und in den dunklen Garten gesehen. Die Büsche waren nachts finster und bedrohlich. Ab und zu leuchteten die Augen einer Katze wie grünes Feuer. Oben am schwarzen Nachthimmel waren in klaren Nächten tausend funkelnde Sterne zu sehen. Die faszinierten sie so, dass sie erst von ihren eiskalten Füßen gemahnt werden musste, wieder ins Bett zu schlüpfen. Ob sie dort in der alten Heimat die Sterne auch so sehen konnte? Als Emilie versonnen in den Garten schaute, starrten sie plötzlich zwei Augen an. Erschrocken blickte sie in das runzlige, verwirrte Gesicht der verrückten alten Frau. Schnell wandte sie sich ab, ein ungutes Gefühl beschlich sie. Die Alte hatte vorhergesehen, dass sie von hier weggehen würden. Ihr selbst hatte sie eine düstere Zukunft prophezeit!
Auf einmal regte sich Trotz in Emilie. Ihre Zukunft ließ sie sich von niemandem schwarz- reden, die hatte sie immer noch selber in der Hand! Schnell lief sie zum Fenster, streckte der Alten die Zunge heraus, so weit sie konnte, und wandte sich dann zufrieden ab. Der hatte sie es aber gegeben! Nun konnte die Zukunft kommen! Die Mutter rief, es wurde Zeit. Ein neues Leben wartete auf sie. Nach einem kurzen Blick durch den Wohnraum verließ Emilie das Haus und ging zum Wagen, von dem ihr schon fröhliche Gesichter entgegenblickten. Otto Jaske und die Mutter saßen auf dem Kutschbock, zwischen sich hatten sie Eduard genommen, der von den Pferden hellauf begeistert war. Hinter ihnen stand Jacob, zu aufgeregt zum Sitzen. Auf dem Kopf trug er die Pelzmütze des Vaters, die ihm noch zu groß war und ihm immerfort ins Gesicht rutschte. Emilie, Paula und Selma mussten mit Albert Hanemann hinten Platz nehmen, von wo sie auch eine schöne Aussicht hatten. Nur, dass ihnen die Landschaft nicht entgegenkam, sondern hinter ihnen zurückblieb.
Einige Nachbarn hatten sich vor ihren Häusern eingefunden und schauten dem Wagen verwundert nach. Wie konnte sich die alleinstehende, bettelarme Frau nur so einen großen Wagen leisten? Dass Leute so weit fuhren um einige ihrer Landeskinder zurückzuholen, konnten sie sich gar nicht vorstellen. Der einzigartige Zusammenhalt, der in den deutschen Kolonien herrschte, war ihnen fremd. Selbst in Deutschland war Solidarität in diesem Ausmaß nicht üblich. Wahrscheinlich entwickelt sich solch ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl nur durch die Isolation einer Minderheit in einem fremden Land.
Schnell hatte sich die Abreise der Deutschen herumgesprochen. Erstaunlicherweise fanden sich doch etliche Dorfbewohner ein, die ihnen Lebewohl sagten. Vergessen schienen die Feindseligkeiten. Schulfreunde und Spielkameraden winkten am Wegrand, Bauern hielten ihre Ochsenkarren an und grüßten, indem sie mit zwei Fingern an die Mütze tippten. Eine Bauersfrau ergriff Wilhelmines Hand und wünschte ihr alles Gute. Hinten winkten die Mädchen noch lange aus dem Wagen, bis die kleinen, verstreut liegenden Häuschen außer Sicht waren. Mit Tränen der Rührung in den Augen begann Wilhelmine ihre Heimkehr.
Sie hatte keine Ahnung, wie es zurzeit in Teplitz aussah. Elf Jahre war sie fort gewesen! Von den Kornspeichern erzählten die Männer, in welche jeder vom Überschuss abgab, um dann in Notzeiten genügend Mehl und Saatgut zu haben. Hungerzeiten waren selten geworden in den Dörfern am Kogälnik. Neue, schöne Häuser waren allerorts gebaut worden, Wilhelmine würde sich wundern! Kaum einer wohnte noch in den alten Kronshäuschen. Wilhelmine freute sich, als sie hörte, dass Pastor Lehmann noch in Teplitz Pfarrer war. Ein Dorfladen sollte entstehen, damit die Hausfrauen nicht mehr bei den reisenden jüdischen Händlern einkaufen mussten, die oft überteuerte Waren anboten. Nach und nach verschwanden die Weinschänken aus den Orten, weil fromme Brüderschaften sich das Ziel gesetzt hatten, Trunkenheit und Lasterhaftigkeit aus den Gemeinden zu verbannen.
Für Wilhelmine waren dies alles durchaus schöne und gute Neuigkeiten. Umso mehr freute sie sich jetzt auf zu Hause, obgleich die Trennung von den Kindern wie ein böser Schatten über ihr lag. Doch irgendwie hoffte sie immer noch auf eine Lösung. Vielleicht konnten sie ja doch bei Viktor bleiben, oder sie fand einen Mann, der die Kinder auch wollte? Womöglich nahm eine Familie alle Kinder auf und Wilhelmine könnte dann dort als Magd arbeiten? Sehr wahrscheinlich war das alles nicht, aber die Mutter klammerte sich mit verzweifelter Hoffnung an jede neue Möglichkeit, die ihr in schlaflosen Nächten einfiel.
Das Reisen war zu jenen Zeiten nicht bequem. Vor allem nicht so früh im Jahr, wenn das Schmelzwasser die Wege aufweichte und der Wagen manchmal tief im Morast versank. Von den vierzig Meilen, die bis nach Hause zurückzulegen waren, bewältigten sie am ersten Tag etwa zweieinhalb. (Eine russische Meile entspricht 7,5 Kilometer.) Das war eine gute Strecke, wie die Männer sagten. Auf der weiten Fahrt mussten sie nämlich auch oft die befestigten Straßen verlassen und durch die Wildnis fahren. Die selten benutzten Wege hielten so manche Widrigkeit für Reisende bereit. In den Waldgebieten konnte man ständig mit umgestürzten Bäumen rechnen, die den Weg versperrten. Ließen die sich nicht wegräumen oder umgehen, musste man oft große Umwege in Kauf nehmen. Auf diese Weise konnte eine vermeintliche Abkürzung leicht die Reise um zwei Tage verlängern.
Am Vormittag des zweiten Tages kam die kleine Reisegesellschaft an so eine Stelle, von der aus eine Abkürzung der Strecke möglich war. Mit der Abkürzung würden sie etwa acht Meilen sparen, allerdings wussten sie nicht, was sie im Wald erwartete. Die Männer diskutierten. Albert Hanemann wollte durch den Wald, Otto Jaske auf der Straße fahren. Schließlich fragten sie Wilhelmine, die still dabeigesessen hatte, um ihre Meinung. Sie entschied sich ohne zu zögern für die längere Strecke.
„Wegen der wilden Tiere.“, sagte sie. Otto Jaske schaute sie prüfend an.
„Sie haben es den Kindern noch nicht gesagt, was?“, fragte er leise. Wilhelmine schüttelte nur stumm den Kopf. Wenn es nach ihr ginge, könnte die Reise ewig dauern.
Nachts wurde es empfindlich kalt. Die Reisenden machten ein Feuer an und verkrochen sich zum Schlafen im Wagen. Alle Decken, die sie hatte, breitete Wilhelmine über den zitternden Kindern aus. Von Ferne hörten sie die Wölfe heulen. Die Kleinen hatten große Angst vor ihnen. Die Mutter machte ihnen Mut, so gut sie konnte, aber auch sie fühlte sich von dem dünnen Wagenzelt nicht besonders geschützt. Mehr Sicherheit gab ihr das Lagerfeuer, welches die Männer die ganze Nacht unterhielten. Abwechselnd hielten sie Nachtwache. Das taten sie auch wegen der Wegelagerer, vor denen sie von Einheimischen gewarnt worden waren. Auch Wilhelmine wollte wachen, aber die Männer ließen es nicht zu. Dafür ruhten sie am Tage abwechselnd hinten im Wagen. Da, wo sonst drei Kinder schliefen, lag dann ein Mann und schnarchte. Paula, Selma und Eduard hockten daneben und sahen zu, wie sich der Schnauzbart zitternd bewegte. Einmal legte Paula eine kleine Daunenfeder auf Ottos prustende Lippen. Wenn sie in die Höhe flog, kicherten sie.
Emilie und Jacob streiften gern morgens und abends durchs Gelände. Sie sammelten Brennholz und erkundeten die Gegend. Otto und Albert mochten die Wälder nicht, obwohl es sich bei diesen nur um dürre Kiefern und spärliches Unterholz handelte. Sie waren in der weiten Budschaksteppe aufgewachsen und brauchten einen freien Blick bis zum Horizont, um sich wohlzufühlen.
Manchmal trafen sie zur Abendzeit auf kleine Ortschaften und konnten dort bei freundlichen Menschen ein Nachtlager bekommen. Für die Kinder war das alles ein einziges großes Abenteuer. Mal übernachteten sie im Wagen, mal in einer Scheune im duftenden Heu. Das roch so gut nach Sommer! Wo würden sie wohl diesen Sommer verbringen?
Die Fahrt verlief gut. Bald lagen die Waldgebiete hinter ihnen und sie fuhren nun meistens zwischen Wiesen und Feldern dahin. Im Sommer würden hier Mais, Weizen, Sonnenblumen und Tabak wachsen. In einer etwas größeren Stadt nahe der moldawischen Grenze deckten sie sich mit Vorräten ein. Hier gab es viele Geschäfte mit Verkaufsläden und einen Bahnhof. Die Kinder staunten über die großen Häuser. Sogar eine Burg lag auf einem Felsen.
„Wartet nur, bis wir nach Kischinau kommen!“, versprach Albert, „Da werdet ihr Augen machen!“
Das Wetter hatte ein Einsehen und brachte viel Sonnenschein. Fröhlich rollte der Wagen über glatte Wege, holperte über steinige Strecken und bewegte sich vorsichtig durch die Furten kleiner Flüsschen. Die Wegelagerer hatten so früh im Jahr anscheinend noch keine rechte Lust zum Wegelagern, die Reisenden blieben von dieser Prüfung verschont. Dafür wurden die Wölfe zu einem Problem. Wenn sie nicht in einem durch Zäune oder Dornenhecken geschützten Dorf übernachten konnten, hielten die Männer mit der Flinte Wache, denn die ausgehungerten Raubtiere kamen frech bis ans Feuer heran. Meistens vertrieb sie schon ein Schuss, allerdings wurden davon alle munter. Wilhelmine hatte dann Mühe, die Zwillinge zu beruhigen und Jacob daran zu hindern, mit dem Messer auf Wolfsjagd zu ziehen. Jacob hielt oft bis in die Nacht hinein mit Albert Wache, den er besonders ins Herz geschlossen hatte. Er genoss sichtlich die männliche Gesellschaft, ihm fehlte der Vater besonders.
‚Vielleicht bekommt er ja bald wieder einen‘, dachte Wilhelmine traurig. Sie hatte bis jetzt immer noch nicht den Mut gefunden, den Kindern von der wahrscheinlich bevorstehenden Trennung zu erzählen. Wilhelmine beschloss, es ihnen erst in Teplitz zu sagen. So konnten sie die Fahrt genießen und später an diese Zeit als eine schöne Erinnerung zurückblicken. Als sie so weit mit sich im Reinen war, entspannte sich Wilhelmine und fand nun auch Gelegenheit, sich an der Reise zu erfreuen.
Die Kinder wunderten sich indes, dass die Mutter mit ihnen in letzter Zeit so übertrieben fürsorglich umging und alles erlaubte. Sie schimpfte nie, herzte und küsste ständig alle und ließ kein Kind an sich vorüber, ohne es in den Arm zu nehmen und liebevoll zu drücken. Emilie fand dieses Verhalten befremdlich. Es störte sie, dass die Mutter den Kleinen alles durchgehen ließ. Paula nutzte diese Freiheiten nämlich für etliche dumme Streiche. Sonst war die Mutter immer recht streng gewesen und achtete stets auf gutes Benehmen. Jetzt lächelte sie nur milde, wenn Paula vorlaut war oder die Kleinen sich beim Essen gegenseitig beschmierten. Jacob entzog sich gern der mütterlichen Umklammerung und verbrachte viel Zeit mit den Männern. Emilie beobachtete das alles mit immer größerem Unbehagen. Irgendetwas stimmte nicht!
Vor Kischinau kamen sie durch Weinberge. Leider begann nun ein stetiger Nieselregen zu fallen, so dass die Reisenden missmutig im Wagen saßen und die schöne Landschaft um sich herum gar nicht recht würdigten. Als sie aber die Hauptstadt vor sich liegen sahen, hob sich die Stimmung. Sie hielten auf einem Hügel und überblickten das Häusermeer. So viele Gebäude! Die Kinder staunten und riefen „Ah“ und „Oh“.
„Na, was hab‘ ich euch versprochen?“ Albert Hanemann wies stolz mit einer weiten Handbewegung auf die Stadt, als habe er sie selbst erbaut. Obwohl es ein Umweg war, hatten sich die Männer dazu entschlossen, die sichere Strecke über die Hauptstadt zu nehmen. Der Dnister war ein großer Fluss, von dem man im Frühjahr niemals wusste, wie viele kleinere Brücken er überschwemmt hatte. Bei Tighina gab es eine sichere Brücke. Sogar eine Eisenbahnbrücke war im Bau. Bequem waren sie im Wagen über den reißenden Fluss gerollt. Nun standen sie also vor Kischinau. Otto Jaske konnte den Kindern einiges von der Stadt erzählen, denn er war schon öfter hier gewesen. Eine Lederfabrik gab es hier, die entsetzlich stank. Auch die Milchkühe der deutschen Bauern mussten am Ende ihres Lebens ihre Haut hier zu Markte tragen. In der Stadt standen schöne Kirchen und andere imposante Gebäude. Die Straßen waren von großzügigen Stadtplanern lang und breit angelegt worden. Auf etlichen Märkten gab es alles zu kaufen, was man sich nur vorstellen konnte. Von überall her kamen die Händler und boten ihre Waren feil. Wie gern hätte Emilie dort einen Bummel gemacht! Die Männer jedoch wollten sich hier nicht lange aufhalten, denn es zog sie nach Hause. Außerdem hatte es vor kurzem politische Unruhen in der Stadt gegeben, bei denen sogar Menschen ums Leben gekommen waren. Juden, wie man hörte. Aus solcherlei Konflikten hielten sich die Bauern lieber heraus, deshalb ließen sie die Stadt jetzt hinter sich und rollten weiter Richtung Südosten. Gut die Hälfte der Strecke hatten sie bewältigt, und zwar die schwierigere. Schwieriger deshalb, weil das Gelände unwegsam und hügelig war und weil die Männer sich nicht auskannten. Südlich der Hauptstadt begann langsam die heimische Steppenlandschaft. Nun ging es auf öfter benutzten Wegen weiter.
„Die Pferde wittern Stallduft!“, behauptete Albert fröhlich, dabei hatte er selber Heimweh. Vielleicht hatte seine Frau schon das Baby bekommen? Mit jedem Tag, an dem sie gute Fahrt machten, wurden die Männer ungeduldiger. Sie wollten heim zu Frau und Kind, zu Hof und Feld.
Ottos Geschäfte waren gut verlaufen und er war zufrieden. Wenn er heim kam, wartete viel Arbeit auf ihn. Die junge Frau an seiner Seite tat ihm ein bisschen Leid. Sicher, es war üblich, dass eine Witwe wieder heiratete und ihre Kinder in Vormundschaft geben musste. Aber meistens waren es Verwandte, die sich der Kinder annahmen, oder sogar der neue Ehegatte. Wilhelmine unterhielt sich gern mit Otto Jaske. Er flößte ihr mit seiner ruhigen, bedächtigen Art Vertrauen ein. Außerdem tat ihr die Fürsorge gut, die der ältere Mann ihr angedeihen ließ.
Er achtete zum Beispiel darauf, dass sie am Lagerfeuer weich saß und nicht fror, nahm ihr öfter Arbeiten ab und bemerkte, wenn sie müde war.
Alberts Aufmerksamkeit galt mehr den Kindern. Er dachte sich lustige Spiele aus, wenn es langweilig wurde und erzählte den Älteren viel von ihrem Vater. Er war ja ein Freund von ihm gewesen und sprach gern über die gemeinsam verbrachte Jugend. Den Kindern gefiel das, aber Wilhelmine tat es weh. Deshalb hielt sie sich lieber bei Otto Jaske auf. Mit ihm konnte sie auch über die Zukunft sprechen. Natürlich vertraute sie dem Mann nicht ihre persönlichen Ängste an, das wäre zu weit gegangen. Trotzdem machte er ihr oft unbewusst Mut, wenn er voller Stolz über sein Dorf, die Gemeinde und die Kirche sprach.
Es war morgens gegen fünf Uhr. Alle lagen noch in tiefem Schlaf. Da begann eine Amsel ihr morgendliches Lied. Ihre wundervollen Triller schallten durch die Nacht und weckten die Sonne. Sie weckten auch Emilie. Still lag sie auf ihrem Lager aus Säcken. Neben ihr schnaufte Paula, drehte sich unruhig um und schlief weiter. Emilie lauschte der Amsel. Wie konnte ein so winziges Tier nur solche Laute hervorbringen? Ihr Tirilieren war so klar und rein wie das Wasser einer Bergquelle. Die vielfältigen Töne bildeten ein endloses Lied. Es war faszinierend.
„Dieses Vieh verfolgt uns schon seit Tagen!“, brummte Otto unwillig. Emilie musste lächeln. Der Zauber war gebrochen. Langsam erwachten die Schläfer einer nach dem anderen. Sie gähnten und reckten sich, klaubten ihre Sachen zusammen oder verschwanden kurz hinter den Büschen. Die Männer schirrten schon die Pferde an, während Wilhelmine noch ein Frühstück richtete. Heute hatten es die Männer eilig. Sie taten sehr geheimnisvoll und zwinkerten sich ein ums andere Mal zu. Der Tag begann ansonsten wie viele vor ihm. Langsam wurde es heller. Im Zwielicht der Morgensonne funkelten die Tautropfen auf den Gräsern. Zwischen den Bäumen und in den Niederungen hielten sich Nebelreste, bis auch sie von der steigenden Sonne aufgeleckt wurden.
Gegen elf Uhr begannen die Kleinen unruhig zu werden. Bis auf einer kurzen Pause waren sie stramm durchgefahren. Sonst machten sie um diese Zeit eine längere Mittagsrast, aber Otto und Albert fuhren weiter und schienen nach etwas Ausschau zu halten. Endlich kamen sie durch bewohntes Gebiet. Der Weg war ausgefahren, links und rechts der Straße gab es Pferdekoppeln und Kuhweiden. Sie durchquerten einen Hain mit blühenden Obstbäumen und sahen endlich ein Dörfchen vor sich liegen, dessen Einwohner geschäftig in den Gärten zu Gange waren. Weiße Wäsche leuchtete auf den Leinen. Sie hielten kurz an. Die Kinder kamen nach vorn und schauten den Erwachsenen über die Schultern.
„Das ist Blumental!“, sagte Otto.
Jacob begriff als erster. „Ein deutsches Dorf?“, rief er aus. Otto nickte.
„Ein rein deutsches Dorf.“, antwortete er und freute sich an den überraschten Gesichtern.
In manchen Ortschaften lebten einige deutsche Familien unter den Moldauern, aber das sah die Obrigkeit nicht gerne. Die Volksgruppen sollten unter sich bleiben. So wurden die Dörfer mit rein deutscher Bevölkerung immer häufiger, je südlicher man kam. Blumental war das erste auf ihrer Route und wahrscheinlich auch das kleinste.
Es gab die sogenannten ‚Kaschubendörfer‘, wo man plattdeutsch sprach, sowie die ‚Spätzleschwoba‘, das waren die Schwaben. Auch aus anderen Regionen Deutschlands wanderten Siedler ein und brachten ihre Mundart, ihre Sitten und ihre Eigenarten mit. Im Laufe der Jahre wuchsen sie alle zu Bessarabiendeutschen zusammen.
Unsere Reisenden erreichten also Blumental. Das Dorf war noch jung. Hübsch gelegen zwischen grünen Hügeln mit blühenden Bäumen und Wiesen voller Löwenzahn gab es nur etwa zwei Dutzend Häuschen. Unter den Einwohnern hatte Otto Jaske einige Bekannte, weil eine Base von ihm hierher geheiratet hatte. Auf der Hinfahrt waren sie bereits hier eingekehrt und nun warteten auf die erschöpften Reisenden ein gedeckter Tisch und eine warme Mahlzeit. Dazu etliche neugierige Leute, die viele Fragen stellten und natürlich auch Auskunft gaben. Diese Mittagspause wurde ziemlich lang. Man bat sie natürlich auch, hier zu übernachten, dennoch verabschiedete sich die Reisegesellschaft am Nachmittag von den gastfreundlichen Leuten und machte sich wieder auf den Weg. Schließlich lagen bis Teplitz noch fast siebzehn Meilen vor ihnen. Nach diesem von Landsleuten bewohnten Tal folgten zwei Tagesreisen ohne Ortschaften. Sie folgten zwar schon dem Flüsschen Kogälnik, an dessen Ufern auch der Heimatort lag, aber das Gelände war schwierig. Nicht immer konnten sie am Fluss entlang fahren, häufig mussten sie Umwege durch die felsigen Hügel in Kauf nehmen. Das Land war hier karg und steinig, das Flüsschen schäumte und sprudelte über Stromschnellen. Die Wageninsassen wurden durchgerüttelt und geschüttelt und spürten bald jeden Knochen im Leib. Als sie am letzten Apriltag in Leipzig ankamen, goss es wie aus Kannen. Es war wieder kühler geworden. Otto meinte, sie könnten froh sein, dass es nicht schneie. Doch von nun an hatten die Reisenden jeden Abend ein Strohlager in einer Scheune, einen Schlafplatz in einem Schuppen oder sogar ein Bett zur Verfügung, denn nun waren sie bald daheim. Hier hießen die Ortschaften Josefsdorf, Korntal oder Friedensfeld. Die Deutschen bewirteten die Landsleute herzlich, alle hatten gerne Gäste. Man brauchte nur an eine Tür zu klopfen, schon bekam man eine Mahlzeit angeboten. Niemandem fiel es ein, Geld zu verlangen, alle teilten bereitwillig das Wenige, das sie hatten. Dieses Tun war gottgefällig und für die frommen Menschen eine Selbstverständlichkeit. Außerdem waren sowohl Otto Jaske als auch Albert Hanemann hier bekannt. Auch ihre Mission hatte sich derweil herumgesprochen. Dementsprechend neugierig waren die Leute auf die Frau mit den fünf Kindern. Die eine oder andere Familie hatte sich sogar auf die Adoptionsanzeige gemeldet, die der Teplitzer Pisar überall hatte anschlagen lassen. An manchen Abenden kamen an die zwanzig Dörfler in das Haus des jeweiligen Gastgebers, um sich die Fremden zu besehen.
Für Wilhelmine und die Kinder waren solche Abende sehr anstrengend. Zudem wurde die Mutter immer bedrückter, was sogar den Kleinsten auffiel. Obgleich diese Zeit sehr aufregend war, kam es doch gelegentlich vor, dass sich Emilie in die stille Hütte bei Cherson zurücksehnte, als der Vater noch am Leben und die Mutter noch fröhlich gewesen war. Am 4. Mai des Jahres 1906 erreichten die Reisenden Teplitz.
Im Frühjahr des Jahres 1895 waren sie fortgezogen. Jacob und Emilie waren noch ganz klein gewesen, die anderen Kinder noch nicht geboren. Dreihundert Kilometer, fast vierzig Meilen, trennten sie elf Jahre lang von der Heimat. Nun mussten sie hier wieder ein Zuhause finden.
Der Wagen rollte fröhlich ratternd den baumgesäumten Weg, von Krasna kommend, auf ein Dorf zu. Es war früher Nachmittag, die Bauern arbeiteten auf den Feldern. Ein Karren kam ihnen entgegen, man grüßte sich.
„Wir kommen jetzt nach Alt-Elft hinein!“, rief Albert gegen das Rattern des Wagens. „Meine Frau stammt von hier, ein hübscher Ort.“
Emilie richtete sich auf. Gerade hatte sie ein bisschen gedöst, nun schob sie sich nach vorn und schaute hinaus. Durch den hellen Sonnenschein geblendet, kniff sie die Augen zusammen. Das Dorf war von Ferne ein heller Klecks im zarten Frühlingsgrün. Weiße Häuser mit roten Dächern standen dort, dazwischen viele Bäume. Links und rechts des Dorfes, leicht ansteigend, die Felder. In langgestreckten Rechtecken lagen sie da, oberhalb derselben gab es Weinberge. Die flache Ebene, auf der die Reisenden seit gestern fuhren, bot dem Auge einen weiten Blick. Am fernen Horizont verschmolz das zarte Gelb des Steppengrases mit dem blassblauen Frühlingshimmel. Dies war also die Budschaksteppe! Es gab keine alten Bäume, selbst die in den Dörfern waren nicht sehr hoch. Der Himmel war hier irgendwie viel größer. Am Horizont war eine flache Hügelkette zu sehen. Albert wies nach links. Die Neuankömmlinge folgten seiner Geste mit den Blicken. Der Kogälnik floss jetzt ganz friedlich neben ihnen her, eingerahmt von Buschwerk. Etwas entfernt sah man Häuser.
„Dort liegt Paris!“, rief Albert. „Dort kommt mal die Bahnstrecke lang. Und dort ... “, er zeigte nach rechts und alle Köpfe drehten sich gehorsam mit, „dort liegt Katzbach, seht ihr?“ Alle nickten, obwohl man von Katzbach nur den Rauch der Schornsteine sah. Dafür kamen sie jetzt nach Alt-Elft hinein. Am Dorfeingang fiel ihr Blick auf den Kälberbrunnen. Dort wurde für das Vieh Wasser geschöpft und in große hölzerne Tröge geleitet, damit die Tiere saufen konnten. Auch am anderen Dorfende gab es einen solchen Brunnen. Links stand die Mühle. Doch nicht mit dem Wasser des Flusses wurde diese Mühle angetrieben, denn dazu war die Strömung viel zu schwach. Hier wurde mit Stroh Dampf erzeugt und mit diesem Wunderwerk der Technik Weizen, Gerste und Mais gemahlen. Jacob staunte noch die Dampfmühle an, da hatte Paula noch etwas Besseres entdeckt.
„Ein Maibaum!“, schrie sie laut und zeigte nach vorn. Da stand ein großer, mit bunten Bändern und Blumen geschmückter Maibaum mitten auf der Straße. Die Kinder schauten hinten aus dem Wagen heraus und gafften.
Es war wirklich ein hübscher Ort. Fast alle Häuser und Mauern waren weiß getüncht. Die Akazien an der Straße begannen zu grünen. Auf den Bänken an den Hofmauern saßen die Alten und ließen sich von der Frühlingssonne die Winterkälte aus den Gliedern treiben. Mit zahnlosem Lächeln grüßten sie freundlich die Vorbeifahrenden. Die Dorfstraße war bestimmt fünfundvierzig Meter breit. Quer über die unbefestigte Straße führten kleine Trampelpfade. Das waren die ‚Klatschwegla‘ der Weiber, wie sie von den Männern abfällig genannt wurden. Dabei benutzten sie sie selber. Die Häuser und Höfe waren groß und sauber. Alle neueren Häuser hatten hohe Fenster und massive Mauern, die Hofmauern zwischen den dicken Pfosten waren individuell gestaltet. Hübsche Blumenrabatten schmückten die Vorgärten. Man sah kein Fachwerk oder Zäune aus Holz, denn Bauholz war hier knapp. In langer Reihe fügte sich Hof an Hof, Haus an Haus - immer mit dem Giebel zur Straße. Kilometerlang musste die Dorfstraße sein. Und doch war sie irgendwann zu Ende und sie rollten auf der anderen Seite wieder aus Alt- Elft hinaus. Teplitz war nun nicht mehr weit, nach einer knappen halben Stunde Fahrt erreichten sie endlich den Heimatort. Dieser glich, wie auch alle anderen deutschen Dörfer, in seiner Anlage Alt-Elft, war jedoch noch größer. Auch hier erhob sich auf einem Platz ein Maibaum. Etliche Jugendliche standen dort beisammen und blickten auf, als der Wagen vorbeirollte. Otto Jaske winkte und einer der Burschen stieß einen überraschten Jubelruf aus.
„Mein Sohn!“, erklärte Otto stolz. Doch sie hielten nicht an.
Flinke Pferdewagen und behäbige Ochsenkarren belebten die Straße. Männer und Frauen gingen mit Körben oder Kiepen beladen ihrer Arbeit nach. Ein Bauer und seine Frau trugen Heurechen über der Schulter. Ein Bursche rollte ein großes Wagenrad zum Schmied. Emilie betrachtete interessiert die Leute. Alle Frauen trugen große, dunkle Kopftücher, deren lange Fransen Brust und Schultern bedeckten und vorn nur lose verschlungen waren. Die Tücher der jungen Mädchen waren bunt. Die Männer hatten oft noch die langen Schafpelzmäntel an und Pelzmützen auf, was die typische Winterkleidung war. Manche trugen jedoch schon die leichteren, hochgeschlossenen Joppen und die leichten Tuchmützen. Schwatzende Hausfrauen hielten inne und starrten die Ankömmlinge an. Dann hatten sie es plötzlich sehr eilig. Sie liefen schnell ins Haus um kurz darauf mit der Großmutter im Schlepptau wieder herauszukommen. Andere klopften erst bei der Nachbarin an, ehe sie sich auf den Weg zum Pfarramt machten.
Emilie und ihre Geschwister winkten unbefangen aus dem Wagen den Leuten zu. Was für eine Heimkehr! Als Otto und Albert erkannt wurden, ertönten Rufe, es wurde gewunken. Bestimmt wussten auch die Angehörigen der Männer schon, dass die Familienväter heimgekehrt waren. Trotzdem hielten sie nicht eher an, als bis sie die Kirche erreichten. Erst dort kam der Wagen zum Stehen. Die Männer sprangen vom Kutschbock. Mit steifen Gliedern kletterte auch Wilhelmine vom Wagen und hob die Kinder herunter. Derweil waren auch einige Schaulustige eingetroffen.
„Wilhelmine, kennst‘ mich noch?“, rief eine korpulente Frau und fasste die Jüngere mit beiden Händen um die Schultern.
Die so Angesprochene stammelte verdutzt: „Ja, ja du bist doch... du bist... “
„Martha! Martha Erdmann!“, lachte die Frau und drückte Wilhelmine herzlich an ihren großen Busen. Auch andere ehemalige Nachbarinnen kamen hinzu. Dann wurden die Kinder betrachtet.
„Ach, wie der Junge seinem Vater ähnelt ...“
„So hübsche Mädchen ...“
„Blaue Augen wie’s Großmutterle ...“
„Viel zu dünn ...“
Die Rufe und das Geplapper der aufgeregten Frauen war ein einziges großes Durcheinander. Die Zwillinge drückten sich verschüchtert an Emilie. Wilhelmine lachte, wandte sich hierhin und dorthin, beantwortete Fragen, schüttelte Hände und wurde immer wieder neu begrüßt. Plötzlich traten die Menschen auseinander und machten Platz für einen Mann. Es wurde still. Vor Wilhelmine stand Viktor. Sie erschrak, als sie ihren Schwager ansah. Sein Gesicht war eingefallen und bartstoppelig, seine ganze Erscheinung wirkte ungepflegt.
„Guten Tag, Wilhelmine!“, sagte er leise. Seine Augen waren seltsam. So traurig und auch ein wenig verwirrt. Die Leute schauten betreten zu Boden oder gingen ein Stück weg.
„Es ist etwas geschehen.“, sagte Viktor. „Etwas Schreckliches.“
Nur das Ticken der Uhr war zu hören. In der Wohnstube der Pfarrersfamilie war es still. Auf dem großen grünen Sofa hockten Wilhelmines Kinder dicht aneinander gedrängt wie die Orgelpfeifen und folgten einem Teller voll Gebäck mit den Augen, den Frau Lehmann eben ins Zimmer trug. Zwei der Pfarrerskinder saßen auf der anderen Seite des Tisches und warteten auf den Tee.
„Jetzt sagt mal!“, begann Frau Lehmann betont fröhlich das Gespräch, „Sagt doch mal, wie gefällt es euch denn in Teplitz?“ Dabei sah sie die kleine Selma an. Selma steckte den Daumen in den Mund.
„Na, und was ist mit dir?“, wandte sie sich an Eduard.
„Ich will nach Hause!“, sagte Edi. Frau Lehmann wechselte einen Blick mit ihren halbwüchsigen Kindern. Der Junge zuckte die Schultern und grinste. Paula wollte ein Stück Gebäck nehmen, aber Emilie zog sie rasch aufs Sofa zurück.
„Aber nicht doch – nehmt, Kinder, es ist alles für euch!“, sagte die Pfarrersfrau zuvorkommend und schenkte Tee ein. Emilie stand auf, nahm fünf der kleinen Kuchen vom Teller und verteilte sie an ihre Geschwister. Schweigend aßen alle. Jacob wurde langsam zappelig. Er fühlte sich nicht recht wohl in dieser feinen Stube und wollte hinaus zu Otto und Albert und den Pferden. Er wusste nicht, dass die Männer bereits zu Hause bei ihren Familien saßen und ihren Kindern von der Reise erzählten.
Otto Jaske wollte gleich morgen mit seinem Knecht einen Rundgang über die Felder machen und anschließend die neuen Aufträge in die Geschäftsbücher eintragen.
Albert Hanemann war mit dem Gesellen schon in der Werkstatt gewesen und hatte die Arbeiten begutachtet, die während seiner zweimonatigen Abwesenheit angefertigt worden waren. Dabei trug er seinen Sohn auf dem Arm, der sich vor Freude kaum zu lassen wusste, den geliebten Papa wiederzuhaben. Alberts Frau konnte kaum noch einen Schritt gehen, so unförmig dick war ihr Bauch. Das Baby musste bald kommen. An den Jungen, zu dem er auf der weiten Reise ein so freundschaftliches Verhältnis gehabt hatte, dachte Albert kaum noch. Schließlich war sein Auftrag zur allgemeinen Zufriedenheit erfüllt und die Familie heimgeholt worden. Sein Herz hing an seiner eigenen Familie und der Arbeit in der Steinmetzwerkstatt. Er konnte nicht ahnen, dass Jacob in ihm so etwas wie einen Vaterersatz gesehen hatte.
Nun, Jacob und seinen Geschwistern standen noch weitere Enttäuschungen bevor. Während Albert und Otto heimgekehrt waren und Frau Lehmann die Kinder beaufsichtigte, hatte der Primar bereits Boten losgeschickt, von denen einige schon zurück waren. Sie brachten Menschen mit, die für die Zukunft der Familie Haisch eine große Rolle spielen sollten.
Währenddessen saß Wilhelmine mit ihrem Schwager auf einer der Kirchenbänke im leeren Gotteshaus und musste sich die ganze bittere Geschichte Viktors anhören. Es war kühl und dunkel hier drinnen, aber sie waren ungestört. Nur der Pfarrer war zugegen. Stockend und immer wieder mit den Tränen kämpfend erzählte Viktor. Ab und zu unterstützte ihn Pastor Lehmann mit sanfter Stimme.
Nachdem Wilhelmines schicksalhafter Brief in Teplitz eingetroffen war, hatte sich Ludwig plötzlich völlig zurückgezogen. Er nahm nicht mehr an den Mahlzeiten teil, ging nicht zur Schule und verkroch sich stundenlang auf dem Heuboden. Weder das Keifen seiner Mutter noch das Zureden seines Vaters konnten ihn zur Vernunft bringen. Eines Morgens, Gertrud beschimpfte Viktor gerade, er hätte seinen Sohn öfter mit dem Stock verprügeln müssen, wie andere Väter es taten, sagte Ludwig laut und deutlich zu ihr:
„Du bist eine Mörderin!“
Gertrud verstummte augenblicklich, wich totenbleich an die Wand zurück und starrte ihren Sohn erschrocken an.
„Aber Junge, wie kannst du so etwas sagen!“, fuhr Viktor seinen Sohn an und schüttelte ihn, als er nicht reagierte. Da sprudelte es aus Ludwig heraus: Was er gehört und was er sich zusammengereimt hatte und dass er ganz sicher war, die Mutter hätte die Ahna umgebracht, indem sie sie vom Heuboden stieß. Gertrud hätte nun leicht alles abstreiten können, aber ihre Reaktion sprach Bände. Sie war so blass geworden, dass sie fast schon grün wirkte und stammelte immer nur:
„Sie war doch sowieso schon alt – sie war doch alt.“
Ludwig verließ noch am selben Tage das Elternhaus. Er ging nach Lichtental zu seiner Schwester Hanna, die dort mit ihrem Mann einen kleinen Hof hatte. Um mit der Last auf seiner Seele leben zu können, wurde er ein tiefreligiöser Mensch und verbrachte viele Stunden beim Gebet.
Auch Viktor wurde nicht mit der Tatsache fertig, dass seine Mutter von seinem eigenen Weib erschlagen worden war. Er zog sich, wie vorher sein Sohn, völlig zurück. Außerdem verfiel er dem Alkohol.
Gertruds verhärtetes Herz war indes auch nicht ohne Schaden geblieben. Die Schuld, mit der sie seit Jahren lebte, hatte ihren Verstand verwirrt. Das äußerte sich immer öfter in Wutanfällen, die sich nun, weil niemand anders mehr da war, hauptsächlich an den beiden jüngsten Kindern entluden. Als Viktor eines Tages seinen kleinen Arthur wimmernd und blaugeschlagen im Schafstall liegend fand, ging er zum Primar und zeigte seine Frau wegen Mordes an. Der Gemeindeschreiber war der Gesetzeskundige im Dorfe. Weniger wichtige Streitigkeiten und geringe Vergehen konnten vom Schulzengericht geahndet werden. Aber mit einem Mord war es überfordert. Schwere Vergehen wie dieses kamen vor das Wolostgericht. Zunächst holte der Büttel Gertrud von zu Hause ab und sperrte sie unter den Augen ihrer Kinder und sämtlicher Nachbarn in die Arrestzelle, das ‚Häusle‘, welches gleich hinterm Bürgermeisteramt lag. Gertrud spuckte Gift und Galle. Ludwig wurde es erspart, gegen seine eigene Mutter aussagen zu müssen, denn Gertrud war geständig, wenn auch nicht einsichtig. Zunächst kam sie ins Gefängnis, später wegen ihres verwirrten Geistes ins Irrenhaus.
Viktor versuchte, mit den Kindern ein normales Leben weiterzuführen. Obwohl er sich nicht offiziell als einer der Heiratskandidaten gemeldet hatte, hoffte er doch insgeheim, seine Schwägerin würde zu ihm ziehen und ihm den Haushalt führen. Als dieses Ansinnen im Gespräch ersichtlich wurde, griff der Pastor ein. Seine Worte waren freundlich, aber seine Augen blickten streng, als er Viktor unmissverständlich klar machte, dass er ein solch unzüchtiges Verhalten nicht dulden konnte. Schließlich war Gertrud noch am Leben und Viktor mit ihr vor Gott verbunden. Eine neue Frau kam nicht in Frage. Höchstens als Magd könne Wilhelmine bei ihm leben. Fragend sahen die Männer Wilhelmine an.
Als Magd bei Viktor leben und im Stall schlafen? Die eigenen Kinder zur Adoption freigeben und Gertruds Kinder aufziehen? Langsam schüttelte Wilhelmine den Kopf.
Viktor wirkte nicht sonderlich überrascht, der Pastor erleichtert.
Da wurden die Kirchentüren aufgestoßen. Die ersten Bewerber trafen ein. Frau Lehmann erschien mit den Kindern in der Kirche. Wilhelmine, die von dem Gespräch mit Viktor noch ganz benommen war, drückte die Kleinen an sich und nahm Emilies Hand. Herr Schenker, der Primar, kam freundlich auf Wilhelmine zu und machte sie mit einem Bauern bekannt. Der Mann hatte seinen Schnurrbart gezwirbelt und trug eine Blume im Knopfloch. Im Hintergrund sah Emilie noch einige Herren stehen, die die Mutter interessiert betrachteten. Was waren das für Männer? Frau Lehmann kam jetzt wieder auf sie zu und führte die Kinder geschickt und unauffällig von der Mutter weg. Warum wirkte die Frau so nervös?
Draußen stand ein Bauer mit seiner Ehefrau. Hinter ihnen drängten sich fünf kleine Mädchen. Sie sahen alle gleich aus und waren offenbar jeweils nur ein Jahr auseinander. Der Mann klopfte Jacob auf die Schulter und betrachtete ihn mit Wohlgefallen.
„DAS ist ein Junge, ein Prachtjunge!“, erklärte er laut. Seine ausgemergelte Frau lächelte säuerlich.
Emilie blickte sich um und sah Selma auf dem Arm einer Frau. Sie war noch jung, auch ihr Gatte, der neben ihr stand und Eduard auf dem Arm trug, konnte kaum dreißig sein. Die Frau hatte glückliche Augen und stellte dem Kind Fragen. Wenn Selma etwas antwortete, lächelten die Erwachsenen und sahen sich an. Anscheinend ein kinderloses Ehepaar. Was wollten sie mit den Zwillingen? Etwa mitnehmen?
Paula schwatzte mit einer dicken Frau, die sich zu ihr niedergebeugt hatte.
„Bist du aber dick!“, hörte Emilie Paula sagen. Der Mann und der ältere Junge, die hinter der Frau standen, grinsten breit. Ärgerlich richtete die Dicke sich auf.
„Na, dir werd ich die Frechheiten schon noch austreiben, mein Fräulein!“, schnaufte sie. Wie meinte sie das? Frau Lehmann war überall zugegen. Sie wechselte hier ein paar Worte, stellte dort jemanden vor und kam schließlich auf Emilie zu, die still an der Kirchentür stand und das ganze mit immer größerem Unbehagen betrachtete.
„Emilie, mein Kind!“ Frau Lehmann lächelte. „Schau mal, wer dich kennenlernen will!“ Ihre füllige, schwarzgekleidete Gestalt trat zur Seite und Emilie sah einen kleinen, älteren Mann mit einer großen Nase, der zögernd auf sie zu trat.
„Guten Tag!“, sagte er freundlich und streckte ihr eine kräftige, abgearbeitete Hand hin.
„Guten Tag!“, erwiderte Emilie abweisend und ließ die Hand unbeachtet in der Luft hängen. Einen Augenblick starrte sie ihn an, dann drehte sie sich um und lief weg.
Wilhelmine hatte ihre Heiratskandidaten in der Kirche stehen lassen. Sie war in den Wagen geklettert, der mit ihren Habseligkeiten beladen immer noch vor der Kirche stand. Die Pferde waren weg, die Deichseln lagen auf dem Boden. Einsam stand der verlassene Wagen auf der Straße. Schluchzend wühlte die Mutter in Kleidern und Kisten und machte für jedes Kind ein Bündel zurecht. Als sie vom Wagen stieg, stand plötzlich Emilie vor ihr. Vorwurfsvoll und fassungslos schaute die Tochter der Mutter in die Augen. Ein paar lange Augenblicke sahen sie einander an. Emilie wollte Fragen stellen, doch in dem verzweifelten Gesicht der Mutter las sie schon die Antwort.
„Du gibst uns weg!“, sagte sie leise. Tränen schnürten ihr die Kehle zu. Auch über Wilhelmines Gesicht rannen Tränen. Sie sah ihre Tochter fest an und nickte. Sprechen konnte sie nicht. Still trat sie auf Emilie zu und umarmte das Kind.
„Leb wohl, Kleines!“, flüsterte sie. „Es geht nicht anders!“ Weinend hielten sie sich umfangen.
„Ich will aber bei dir bleiben Mama, ich hab dich doch lieb!“, schluchzte Emilie. Die Mutter schüttelte nur den Kopf. Nach einer Weile schob sie ihre Tochter entschlossen von sich.
„Du musst tapfer sein, Emilie! Das müssen wir alle. Auch die Kleinen, obwohl sie es noch nicht verstehen. Du aber bist schon groß. Mein großes Mädchen! Ich war immer so stolz auf dich! Versprich mir, dass du immer so fleißig und gut bleibst! Versprichst du mir das?“ Emilie nickte mit verweinten Augen. Wilhelmine lächelte.
„Wir müssen jetzt da durch - irgendwie! Sie haben freundliche Leute für dich ausgesucht, glaube ich. Du wirst es gut haben.“ Mit aller Kraft versuchte Wilhelmine ihrer Tochter Mut zuzureden - und sich selbst.
Jacob trat hinzu. Seine Mine war starr. Er hatte schon begriffen, worum es ging. Auch er umarmte und küsste die Mutter und nahm sein Bündel entgegen. Auch ihm sagte sie aufmunternde Worte. Jacob umarmte seine Schwester und ging ohne ein weiteres Wort mit gesenktem Kopf zu der Familie mit den fünf Töchtern hinüber, einem arbeitsreichen Leben entgegen.
Da kam Paula heulend angerannt. Sie hatte der dicken Frau auf den Fuß getreten, als die sie züchtigen wollte. Nun flüchtete sie zur Mutter. Es rächte sich jetzt, dass Wilhelmine in den letzten Wochen so nachsichtig mit Paula umgegangen war. Als sie hörte, dass sie mit der dicken Frau gehen sollte, warf sie sich schreiend auf den Boden. Emilie wünschte, sie wäre noch kleiner und könnte das auch machen. Aber ob es etwas nützte? Zusammen mit der Mutter beruhigte sie Paula nur mit Mühe. Während Wilhelmine mit der dicken Frau sprach und sich anschließend von ihren jüngsten Kindern verabschiedete, blieb Emilie wie betäubt am Wagenrad hocken. Das Ganze kam ihr so unwirklich vor wie ein böser Traum. Das Dorf, welches ihr vor zwei Stunden noch so gut gefallen hatte, erschien ihr jetzt trotz Sonnenschein grau und kalt. Als sie ihre von Tränen verschwollenen Augen hob, sah sie in einiger Entfernung den Mann stehen, dem sie vorgestellt worden war. Er stand einfach nur so da und wartete geduldig. Mochte er warten! Jetzt redete er mit dem Primar und nahm einige Papiere entgegen. Es waren immer noch etliche Schaulustige da. Scharen von Kindern drückten sich an den Hausecken herum und gafften. Jeder wollte alles ganz genau mitbekommen. Auch Emilie wurde angestarrt. Der Mann schaute ab und zu ihr hinüber. Er wirkte ruhig und freundlich. Wo war seine Frau? Sollte sie etwa allein bei einem älteren Mann leben? Emilie bekam es mit der Angst. Langsam stand sie auf. Ihre Beine waren schwach und zitterig. Jacob fuhr gerade auf einem Fuhrwerk an ihr vorüber und hob ein letztes Mal grüßend seine Hand. Der Bauer neben ihm wirkte hochzufrieden, als habe er gerade einen günstigen Handel gemacht. Endlich hatte er einen Sohn, der ihm bei der Arbeit im Stall und auf dem Feld zur Hand gehen konnte. Man musste auch nicht jahrelang warten, ehe er dafür groß genug war. Für einen Knecht fehlte ihm das Geld.
Selma und Eduard schienen es nicht schlecht getroffen zu haben. Die Leute waren sehr liebevoll zu den Kleinen. Aber als sie mit den Kindern wegfuhren, schrie Selma plötzlich:
„Mama!“ und streckte beide Ärmchen nach ihr aus. Auch Eduard fing zu weinen an und wollte sich loswinden. Sie riefen immer wieder nach ihrer Mama und ein ums andere mal auch nach Emilie. Die stand hilflos schluchzend am Straßenrand und musste mit ansehen, wie die kleinen Geschwister, um die sie sich seit ihrer Geburt liebevoll gekümmert hatte, von fremden Leuten weggefahren wurden.
Die Mutter war zusammengebrochen und musste von der Pfarrersfrau gestützt werden. Emilie wollte zu ihr hinübergehen, aber irgendetwas hielt sie davon ab. Wo war eigentlich Paula? Die Schwester war schon weg. Emilie hatte sie gar nicht fortfahren sehen. Ihr kleines, freches Paulinchen! Sie war zwar frech, hatte aber ein gutes Herz. Abends wurde sie immer ganz verschmust und wollte Geschichten erzählt bekommen. Ob die dicke Frau das tun würde? Wenigstens sah es so aus, als sollte Paula bei ihr genug zu essen bekommen. Emilie seufzte. Das Stupsnäschen mit den Sommersprossen würde ihr fehlen! Na, Paula würde bestimmt mit der dicken Frau fertig werden, auch wenn sie dabei selbst einige Rüffel einstecken musste!
Emilie hielt es plötzlich nicht mehr unter den vielen Menschen aus. Der Kummer und die Verzweiflung saßen wie ein schmerzender Klumpen in ihrer Brust. Die Kirchentür stand ein Stück offen, davor drängten sich Leute. Hinter ihren Rücken quetschte sich Emilie durch den Spalt und fand sich in der dämmrigen, leeren Kirche wieder. Trotzdem sie an Gott glaubte und auch schon oft Trost im Gebet gefunden hatte, zog es sie nicht zum Altar. In einer dunklen Nische hinter einem Pfeiler hockte sich das Mädchen nieder und wollte weinen. Aber es kamen keine Tränen mehr. Und obgleich es sie in der Kühle fröstelte, schlief sie einen Augenblick später ein.