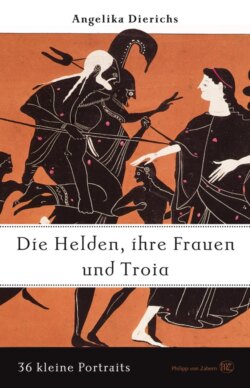Читать книгу Helden, ihre Frauen und Troja - Angelika Dierichs - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dieses Thema verlangt eine lange Einführung Troia fasziniert noch immer
ОглавлениеDas bedeutende Mythenzentrum Troia-Ilion-Pergamos in der nordöstlichen Agäis, unmittelbar an den Dardanellen, am Hellespont, gilt als die Heimat des Ganymed (Mundschenk des Zeus), des Tithonos (Gatte der Göttin Eos) und des dort herrschenden Königs Laomedon, dessen Wortbruch gegenüber Gottheiten zum „ersten“ Troianischen Krieg führt. Vor allem aber heißt es, Troia sei der „Schauplatz“ des „zweiten“ Troianischen Krieges. Diese These ist so verbreitet, dass man sie kaum hinterfragt. Seit Generationen hält sich die archäologische Forschungsmeinung, jene berühmten Figuren vom Tempel der Athena Aphaia auf der Insel Aegina – ausgestellt in der Münchner Glyptothek – seien im Ostgiebel (490/480 v. Chr.) als Krieger des ersten Troianischen Kampfgeschehens und im Westgiebel (500/490 v. Chr.) als Krieger des zweiten Troianischen Kampfgeschehens zu deuten. Raimund Wünsche korrigiert diese Interpretation überzeugend. Er hält die „Aegineten“ für Verkörperungen der mythischen Ahnen Aeginas, deren Nachfahren dazu beitragen, dass die Griechen im Kampf um Troia siegen. Wer sich dem „Thema Troia“ erstmalig nähert, kann an der unüberschaubaren Materialfülle verzweifeln. Wissenschaftliche Beiträge erlauben das Fazit: Die Griechen in früher Zeit glauben fest an ihre Mythen und werten diese anteilig als wirklich fassbare Ereignisse. Sogar der griechische Historiker Thukydides (ca. 455–400 v. Chr.) hält einige Mythen für wahr. „Griechischer Mythos“ meint, so Udo Reinhardts Definition, alle Mythen, die im altgriechischen Kulturraum vom 9. bis zum 6. Jh. v. Chr. entstanden sind und sich in den folgenden Jahrhunderten bis in die Spätantike aus den Primärbildungen weiterentwickelt haben. Aufgrund aktueller Forschungsergebnisse ist der Troianische Krieg eine Fiktion, weil es nichts gibt, was ihn real beweist. Trotzdem erreichen die von Homer in der Ilias erstmalig schriftlich fixierten Kämpfe um Troia – bestritten durch die von Gottheiten abhängenden Protagonisten – eine so große Wirkung, dass sie ihre historisch erscheinende Welt bis in nachantike Epochen weitertragen. Man möchte nicht wissen, wie oft der Schiffskatalog im 2. Buch der Ilias pfleglich gesichtet worden ist, denn mit seinen mehr als 30 Fürsten und fast 1200 Schiffen, lassen sich doch ‚eigentlich recht interessante Fakten’ sammeln! Im 18. Jahrhundert beginnt die topographische Suche nach jenem antiken Ort mit den Namen Troia, Ilios, Ilion und Ilium. Er liegt bei dem, heute noch ca. 40 m hohen, Hügel Hissarlik. Dort grub Heinrich Schliemann (1822–1890) nun keineswegs jene Stadt aus, in der man sich so gern den troianischen König Priamos im Kreise seiner großen Familie vorstellt. Möglicherweise handelt es sich um ein Gebiet, das erst seit dem 8.Jh. v. Chr. als Schauplatz des berühmten mythischen Geschehens galt. Die dort erforschten spärlichen Reste weisen auf eine vom 4. vorchristlichen Jahrtausend bis in die Spätantike bewohnte Siedlung. Nur eine gute Führung macht die Ruinen verständlich. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts entdeckt man 9 Hauptschichten. Jede dieser Siedlungsphasen weist unterschiedliche Bauphasen auf. Insgesamt sondert man 47 Bauphasen. Zerstörungen durch Erdbeben, Brände und Kriege sind zu erschließen. In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends hat der Ort eine überregionale Bedeutung. Sein Name ist im hethitischen Nachbarreich bekannt. Dass die ausgegrabenen Spuren denn wirklich zur Stadt Troia (Ilios, Ilion, Ilium) führen, bleibt bis heute unbewiesen. Aber sollte der Troianische Krieg via Homer denn doch irgendwie historisch zu fassen sein, dann könnten sich Griechen und Troianer irgendwo und irgendwann in den Schichten Troia VI/VII erschlagen haben, d.h. unverzeihlich grob gerastert, in der 2. Hälfte des 2. vorchristlichen Jahrtausends.