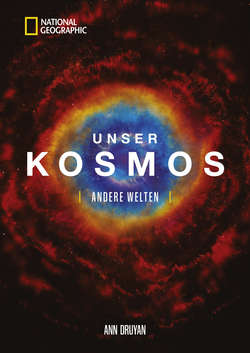Читать книгу Unser Kosmos. Andere Welten. - Ann Druyan - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
| 1 | DIE LEITER ZU DEN STERNEN
ОглавлениеNicht ich, sondern die Welt sagt es: Alles ist Eins.
HERAKLIT, UM 500 V. CHR.
99 Prozent der Zeit seit Entstehen unserer Spezies waren wir
Jäger und Sammler … Nur die Erde, der Ozean und der Himmel
setzten uns Grenzen …
Wie sollen wir uns ins Weltall vorwagen, Welten versetzen,
Planeten umformen, benachbarte Sternensysteme besiedeln, wenn wir
nicht einmal unseren Heimatplaneten in Ordnung halten können? …
Wenn wir fähig sind, das nächstgelegene Planetensystem zu besiedeln,
werden wir uns verändert haben, schon weil so viele Generationen verflossen
sind. Wir mussten uns verändern. Wir sind eine anpassungsfähige Art. …
Trotz all unserer Fehler, trotz unserer Einschränkungen und
Fehlbarkeit können wir Menschen Großartiges bewirken …
Wie weit wird unsere nomadische Art am Ende des nächsten
Jahrhunderts gewandert sein? Und des nächsten Jahrtausends?
CARL SAGAN, BLAUER PUNKT IM ALL:
UNSERE ZUKUNFT IM KOSMOS, 1996
Das Band der Saturnringe – ein Regenbogen der Gravitation. Die NASA-Sonde Cassini eröffnet einen Blick auf einen fast 1,5 Milliarden Kilometer entfernten hellblauen Punkt: die Erde.
Antares, einer der größten Sterne in der Milchstraße, leuchtet trotz seiner Entfernung von mehr als 600 Lichtjahren hell über der chilenischen Atacama-Wüste auf.
Wir sind sehr jung, Neulinge in der Unermesslichkeit. Wir verharren am Ufer des kosmischen Ozeans wie Kleinkinder, die gelegentlich einen Vorstoß wagen, bevor ihre Angst sie wieder in den Schoß der Mutter zurücktreibt.
Vor einem halben Jahrhundert statteten wir Menschen dem Mond einige kurze, vorübergehende Besuche ab. Seither überließen wir unsere Erkundungsreisen Robotern. 1977 schickten wir Voyager 1, unseren kühnsten Abgesandten dieser Art, weiter weg, als die Sonnenwinde reichen, hinaus in die interstellare Tiefe.
Unsere Sonne ist lediglich der nächste Stern. Mit 60 000 Stundenkilometern würde Voyager 1 fast 80 000 Jahre bis zum zweitnächsten Stern Proxima Centauri benötigen. Das ist nur eine Spritztour in der Milchstraße, eine durch die Gravitation zusammengehaltene Ansammlung von Hunderten von Milliarden Sternen. Und sie ist nur eine von einer Billion Galaxien – zwei Billionen, wenn wir alle Zwerggalaxien mitzählen, die inzwischen mit größeren Galaxien wie der unseren verschmolzen sind. Der Kosmos besteht aus Milliarden von Billionen Sternen und vermutlich einem tausendfachen Mehr an anderen Welten.
Und das ist nur der sichtbare Teil des Universums. Der Kosmos ist größtenteils hinter einem Schleier aus Zeit und Entfernung verborgen. In der frühen, hyperlichtschnellen Expansion des Raumzeitgefüges verschwanden riesige Massen des Universums aus der Reichweite unserer Teleskope. Vielleicht ist das unermessliche Universum auch nur ein winziger Teil eines Multiversums, jenseits unserer Erkenntnis oder Vorstellung. Kein Wunder, dass wir uns ängstlich an den Irrglauben klammern, im Zentrum zu stehen, das einzige Kind des Schöpfers zu sein. Wie können sich winzige Wesen, die sich regelmäßig auf einem Punkt verirren, angesichts dieser überwältigenden Realität im Universum zu Hause fühlen?
Seit es uns Menschen gibt, erzählen wir uns Geschichten, die uns die Furcht vor der Dunkelheit nehmen sollen. »Dunkelheit« ist eine Eigenschaft, keine Größe. In einem Kinderzimmer ist die Nacht ein eigener Kosmos. Unsere Spezies geht ihren Weg, indem sie die Dunkelheit durch Erzählungen zähmt. Wir konnten diese nicht anhand der Realität überprüfen, bevor es die Wissenschaft gab. Wir trieben im Ozean der Raumzeit, ohne zu wissen wo und wann, bis die Wissenschaft anfing, unsere Koordinaten zu bestimmen.
Die neueste Erkenntnis über das Alter des Universums lieferte das Weltraumteleskop Planck der Europäischen Weltraumorganisation. Es suchte über ein Jahr lang den gesamten Himmel ab und vermaß akribisch das Licht, das das junge Universum 380 000 Jahre nach dem Urknall ausstrahlte. Planck zeigt den Kosmos, wie er vor 13,82 Milliarden Jahren aussah – hundert Millionen Jahre älter, als die Wissenschaft vor Kurzem noch annahm.
Das liebe ich an der Wissenschaft. Kein Wissenschaftler versuchte, die Entdeckung, dass das Universum wohl älter war als angenommen, zu vertuschen. Sobald die neuen Daten überprüft waren, wurde diese Korrektur von der gesamten Wissenschaftsgemeinde sofort angenommen. Diese fortschrittliche Haltung, die Offenheit für den Wandel, bildet den Kern der Wissenschaft und macht sie so wirksam.
DIE ANFÄNGE DER WISSENSCHAFTLICHEN GESCHICHTE der Zeit liegen so weit zurück, dass wir sie auf menschliche Kategorien herunterbrechen müssen. Der Kosmische Kalender bringt ihre 13,82 Milliarden Jahre in eine für uns begreifbare Bezugsgröße, ein einziges Erdjahr. Die Zeit beginnt oben links mit dem Urknall am 1. Januar und endet um Mitternacht des 31. Dezember unten rechts. In diesem Maßstab steht jeder Monat für etwas mehr als eine Milliarde Jahre. Jeder Tag repräsentiert 38 Millionen Jahre. Jede Stunde 1,6 Millionen Jahre. Eine kosmische Minute entspricht 26 000 Jahren. Eine kosmische Sekunde umfasst 438 Jahre, kaum mehr Zeit, als seit Galileos erstem Blick durch ein Teleskop verstrichen ist.
Daher ist der Kosmische Kalender für mich so bedeutungsvoll. In den ersten neun Milliarden Jahren der Zeit gab es keinen Planeten Erde. Erst nach zwei Dritteln des kosmischen Jahres, am 31. August, ballt sich aus der Gas- und Staubscheibe um unseren Stern die winzige Erde zusammen. Der größte Teil der Geschichte des Universums findet ohne uns statt. Da ist Demut angesagt.
Während der ersten Milliarde Jahre musste unser Planet ziemlich viel einstecken. Am Anfang prallten viele Trümmer auf die neuen Welten, als sie ihre Umlaufbahnen freiräumten. Als später Jupiter und Saturn auf andere Umlaufbahnen wanderten, verursachte ihre Größe im Sonnensystem vermutlich ein Chaos, das Asteroiden aus der Bahn warf und sie mit Planeten und Monden kollidieren ließ.
Das Große Bombardement war noch nicht vorbei, als sich am Meeresgrund Leben zu entwickeln begann. Das ermutigt alle, die Leben anderswo im Universum zu finden hoffen. Die Geschichte unserer Sonne und ihrer Welten ist im Kosmos vermutlich ein häufiger Vorgang. Die Körper, die auf unsere Erde trafen, könnten die notwendigen Zutaten für das Leben und sogar die notwendige Energie mitgebracht haben, um das Leben in Gang zu bringen.
Alles Leben auf der Erde scheint einen gemeinsamen Ursprung zu haben. Vermutlich begann es am 2. September tief im Ozean, in einer Stadt aus Steintürmen am Meeresboden. Darauf gehen wir später genau ein. Das erste Leben besaß einen Kopiermechanismus, der mehr Leben herstellte. Es war ein Molekül, geformt wie eine verdrehte Leiter – DNS. Eine seiner Stärken war seine Unvollkommenheit. Gelegentlich machte es Kopierfehler oder wurde von kosmischen Strahlen beschädigt. Einige dieser zufälligen Mutationen führten zu erfolgreicheren Lebensformen – wir nennen das Evolution durch natürliche Selektion. Die Leiter legte um einige Sprossen zu.
Bei Ebbe tauchen in der Shark Bay in Australien ähnliche Mikrobenkolonien auf wie vor über drei Milliarden Jahren.
Es erforderte drei weitere Milliarden Jahre Evolution, bis aus einzelligen Organismen komplexe Pflanzen entstanden, die wir mit bloßem Auge sehen können. Es gab zwar noch keine Augen, aber der einzellige Organismus, der weiß: »Dich esse ich, meinesgleichen nicht«, zeugt wohl von einem gewissen Bewusstsein.
DIE GESCHICHTE DES MENSCHLICHEN LEBENS ist Teil dieses Kontinuums. Doch in der letzten Woche des kosmischen Jahres gab es eine dramatische Entwicklung. Hätte der Kosmische Kalender Feiertage, wäre der 26. Dezember einer davon. Denn irgendwann an diesem Tag vor 200 Millionen Jahren erschienen die Säugetiere.
Die ersten Säugetiere waren winzige spitzmausähnliche Wesen. »Winzig« heißt wirklich klein – nicht viel größer als eine Büroklammer. Sie wagten sich nur bei Nacht hinaus, denn ihre Jäger, wie die Dinosaurier, beherrschten den Tag. In der Trias standen die Chancen der kleinen Säuger gegenüber den monströsen Reptilien nicht besonders gut. Aber eines Tages sollten sie das Erdreich besitzen.
Die Säugetiere besaßen einen neuen Hirnbereich: den Neocortex. Wie der Rest ihres Körperbaus war dieser Bereich anfangs klein, doch er wuchs schnell – und ermöglichte es ihnen, sich in größeren Gruppen sozial zu organisieren. Neu an den Plazentatieren war auch, dass sie ihre Jungen säugten und aufzogen. Im Kosmischen Kalender fällt der Muttertag auf den 26. Dezember.
Evolution durch natürliche Selektion bedeutet, dass besser an ihre Umwelt angepasste Lebewesen vermutlich eher überleben und Nachwuchs hinterlassen. Intelligenz wirkt dabei als starker Selektionsvorteil. Der Neocortex faltete sich in mehrere Lagen, was mehr Oberfläche für die Informationsverarbeitung bot. Die Gehirnlappen bildeten Furchen aus, was zusätzliche Fläche für Rechenleistungen brachte.
Das Gehirn veränderte die Form, wurde größer und bekam mehr Falten. Am 31. Dezember gegen 19 Uhr spaltete sich unser Evolutionsweg von dem unserer nächsten Verwandten, den Schimpansen, ab. Sie entwickelten sich zu Waldtieren, die sich gegenseitig pflegen, den Verlust von Freunden und Verwandten beklagen, mit Schilf als Werkzeug nach Ameisen als Futter angeln, ihre Jungen darin unterrichten und zusammen den Sonnenuntergang bewundern. Doch wir wissen fast nichts darüber, wie sie zur Zeit unseres letzten gemeinsamen Vorfahren waren.
Ein 2011 in China gefundenes, 160 Millionen Jahre altes Fossil lässt vermuten, dass die ersten Säugetiere wie Spitzmäuse aussahen.
Was unterscheidet uns Menschen, die 99 Prozent der Gene mit den Schimpansen teilen, so stark von ihnen? Warum haben wir als Einzige der fünf Milliarden Arten, die jemals auf der Erde lebten, eine Lebensform entwickelt, die Zivilisationen hervorbringt, die Welt verändert und Raumfahrt betreibt? Vor nicht allzu langer Zeit verblüffte uns das Feuer. Irgendwie verwandelten wir uns in Wesen, die in Lichtgeschwindigkeit kommunizieren, die in Partikel, Atome und Zellen blicken, die die Ursprünge der Zeit erforschen und die das Licht von Milliarden von Lichtjahren entfernten Galaxien am Rand der Ewigkeit einfangen.
Vor etwa sieben Millionen Jahren führte etwas zu einer Veränderung im winzigen Maßstab, die sich auf den gesamten Planeten auswirkte und schließlich auch auf andere. Die größte Zelle des Menschen, das Ei, sieht man mit bloßem Auge kaum. Die kleinste, die Spermazelle, ist zu klein dazu. Doch im Kern fast jeder Zelle befindet sich eine codierte Botschaft aus drei Milliarden Basenpaaren oder Sprossen, die gewundene Leiter der Doppelhelix.
Das Schicksal des Planeten wurde durch ein Ereignis auf einer einzigen Sprosse verändert, das nur 13 Atome betraf. Wie klein sind 13 Atome? Sie sind zusammen eine Billiarde Mal kleiner als ein Salzkorn. In der DNS eines unserer Vorfahren fand vor einigen Millionen Jahren eine Mutation statt, und das sorgt zum Teil dafür, dass Sie gerade diese Worte lesen können.
Jegliches Selbstwertgefühl, alles, was wir lernen und herstellen, ist das Ergebnis dieser Änderung an einem Basenpaar eines einzelnen Gens, an einer Sprosse einer Leiter mit drei Milliarden Sprossen. Sie ließ den Neocortex wachsen und sich noch stärker falten. Vielleicht legte ein kosmischer Strahl zufällig den Schalter um, oder es war ein Übertragungsfehler von einer Zelle zur anderen. Was immer zu dieser Veränderung unserer Art führte, die sich schließlich auf alle anderen Arten dieser Erde auswirkte: Es geschah kurz nach dem Abendessen am Silvestertag unseres Kosmischen Kalenders.
So gesehen beruht unsere Fähigkeit zur Loyalität und zur Sorge um zunehmend größere Gruppen, die Fixierung auf bestimmte Glaubenssysteme, die Möglichkeit, uns die Zukunft vorzustellen, die Macht, die Welt zu verändern und im Kosmos Antworten zu suchen – schon der Name, den wir unserer Art gaben, Homo sapiens, lateinisch für »verstehender Mensch« – vielleicht lediglich darauf: eine einzelne Sprosse in der mikroskopisch kleinen Leiter zu den Sternen.
59 Minuten der letzten Stunde des Kosmischen Kalenders gehörten unseren Vorfahren, dem archaischen Homo sapiens, Jägern und Sammlern in kleinen Gruppen, die, wie Carl Sagan es formulierte, »nur durch Erde, Ozean und Himmel begrenzt waren«.
Mich erstaunt, wenn Menschen achselzuckend alles auf »die menschliche Natur« schieben. Sie meinen meist Gier, Arroganz und Gewalt. Doch wir sind seit einer halben Million oder mehr Jahren Menschen. Und meistens waren wir nicht so. Woher wir das wissen? Durch die Berichte von Forschern und Anthropologen, die Jäger-Sammler-Gesellschaften seit Jahrhunderten begegnen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Krisen haben schon immer das Schlechteste in uns zum Vorschein gebracht. Doch alle stimmen überein, dass die Menschen relativ harmonisch miteinander und mit der Umwelt lebten.
Wir teilten das wenige, was wir hatten, denn wir wussten, dass unser Überleben von der Gruppe abhängt. Besitz über das Nötige hinaus bedeutete uns nichts, denn er war auf der Wanderschaft nur Last. Wir begannen uns von unseren Primatenvorfahren mit ihren um Dominanz kämpfenden Alphamännchen zu unterscheiden. Es gibt Hinweise darauf, dass Geschlechtergleichheit herrschte und die Ressourcen gerecht geteilt wurden. Die meisten Gesellschaften handelten im Bewusstsein, dass sie einander brauchen.
Die höchste Tugend unter unseren Jäger-Sammler-Vorfahren war Demut, als hätten unsere Vorfahren erkannt, dass ein überheblicher Jäger eine Gefahr für die Gruppe bedeutete. Wenn er mit seiner Beute zu Hause angab, dann wurde behauptet, das Fleisch sei zäh und schmecke nicht. Wenn das sein Verhalten nicht änderte, dann griffen sie zur schlimmsten Sanktion – sie isolierten ihn. Was er auch tat, sie verhielten sich, als gäbe es ihn nicht.
(Manchmal frage ich mich, ob nicht ein ritualisiertes Echo aus uralten Zeiten in uns fortwirkt, wenn wir jemanden zur Berühmtheit hochjubeln, sie oder ihn dann in Ungnade fallen lassen und schließlich aus dem öffentlichen Leben verbannen.)
Und wo war Gott? Überall. In den Felsen, in den Flüssen, in den Bäumen, in den Vögeln, in allem Lebendigen. Das war eine halbe Million Jahre lang die Natur des Menschen.
UM 23 UHR 52 AM SILVESTERABEND des Kosmischen Kalenders, oder vor einigen 100 000 Jahren, lebten in Afrika alle Vertreter der Gattung Homo sapiens – alle 10 000. Wenn ich höre, dass es von einer Art nur noch 10 000 gibt, dann mache ich mir um sie Sorgen. Hätte damals ein Außerirdischer auf einer Erkundungsmission die Erde besucht, hätte er vielleicht angenommen, wir wären eine bedrohte Art. Nun zählen wir Milliarden. Was ist passiert?
In der Blombos-Höhle machten unsere Vorfahren einen gigantischen Sprung nach vorne, und vielleicht auch an vielen anderen, bisher unentdeckten Orten. Die Blombos-Höhle am Indischen Ozean an der Südspitze Afrikas ist unser ältestes Chemielabor und der früheste Beleg für eine der größten Anpassungsfähigkeiten unserer Art: die Fähigkeit, etwas aus der Umwelt für einen neuen Zweck zu verändern.
Das erste Kunstwerk? Dieses Ockerstück aus der Blombos-Höhle in Südafrika ist das bisher älteste Artefakt menschlicher Kultur. Es wurde vor etwa 70 000 Jahren bearbeitet.
Eine Höhlenmalerei in der Nähe von Valencia in Spanien, entstanden um 5000 v. Chr., zeigt eine menschliche Gestalt, die mit einem Rauchtopf Bienen vertreibt, um ihnen den Honig zu stehlen. Der Künstler nutzte zur Darstellung des Bienenstocks ein Loch in der Wand.
In der Höhle fanden sich Mischtiegel aus Gehäusen von Meeresschnecken, Speerspitzen, Gerätschaften zur Verarbeitung von Ocker, gravierte Knochen, harmonisch zusammengefügte Perlenstränge, Eierschalen von Schildkröten und Straußenvögeln und feines Werkzeug aus Knochen und Stein. Wer waren diese ersten Chemiker? Wir. In der Blombos-Höhle wurden bis jetzt keine Knochen, nur sieben menschliche Zähne gefunden. Sie zeigen uns, dass uns diese Menschen anatomisch glichen. Und nicht nur anatomisch.
70 Gehäuse von Meeresschnecken in ähnlicher Größe und Farbe und mit einem Loch an derselben Stelle zeugen von regelrechter Perlenproduktion. Die Blombos-Menschen experimentierten mit einem eisenreichen Mineral: Ocker. In Abalone-Schalen mischten sie den Ocker mit Tierknochenmehl und Holzkohle und formten daraus längliche Klötzchen. Damit hätte man Dinge oder Menschen mit roten Farbtupfen schmücken oder Tierhäute konservieren, es für medizinische Zwecke, zum Schärfen von Werkzeugen oder vielleicht als Insektenschutzmittel verwenden können.
Tatsächlich kam etwas – nach unserer Kenntnis – völlig Neues ins Spiel. In den Ocker ritzte man ein geometrisches Muster ein. Kunst. Kein Mittel zur Verteidigung, zur Nahrungsgewinnung oder um einem Gefährten zu gefallen. Symbolträchtig oder zufällig: Die charakteristischen Kreuzschraffuren ähneln einer Leiter oder einer … Doppelhelix. Es ist das früheste Artefakt menschlicher Kultur. Man hatte eine Methode gefunden, etwas Menschliches zu hinterlassen. Ein Kommunikationsmittel, so rätselhaft es 70 000 Jahre später auch wirkt. Hier in der Blombos-Höhle entstand etwas sehr Machtvolles.
In den Zehntausenden Jahren danach brachen einige unserer Vorfahren aus Afrika auf, um den Planeten zu erkunden, und hinterließen Belege für ihren Wunsch, dass man sich an sie erinnern möge. Ein besonders denkwürdiges Zeugnis menschlicher Geschicklichkeit ist in Spanien in den Cuevas de la Araña (Spinnenhöhlen) nahe dem heutigen Valencia zu sehen. Eine menschliche Gestalt klettert ein Seil oder eine Leiter empor, um mithilfe eines Rauchtopfs den Honig aus einem Bienenstock zu plündern. In der Literatur geht man davon aus, dass es ein Mann sei, was vermutlich nur ein Relikt aus jener Zeit ist, als Mensch und Mann gleichgesetzt wurden. Ich finde, das Bild des Honigdiebs spricht eher für eine Frau.
NUR EIN PAAR TAUSEND JAHRE ZUVOR hatten die Menschen überall auf der Welt etwas entscheidend Neues entdeckt. Statt zu jagen, nach Nahrung zu suchen und den wandernden Herden zu folgen, lernten sie, Nahrung anzubauen und wilde Tiere zu zähmen. Das änderte alles. Unsere Vorfahren taten einen entscheidenden Schritt: Sie ließen sich nieder und bauten Häuser. Sie erfanden neue Werkzeuge – Technologie –, pflanzten und ernteten auf der eigenen Scholle. Die Beziehungen zur Natur und untereinander änderten sich für immer.
Die neolithische Revolution, die Domestikation von Pflanzen und Tieren, ist die Mutter aller Revolutionen, denn alle anderen lassen sich darauf zurückführen. Die Konsequenzen reichen über unsere Zeit hinaus. Wie die meisten Umstürze zog auch dieser sowohl großartige als auch entsetzliche Veränderungen nach sich. Das Wort »Heimat« bekam wohl eine neue Bedeutung. Lag sie zuvor dort, wo wir gerade wanderten, verband sich nun ein bestimmter Ort damit. Mit der Zeit wuchsen die Siedlungen, bis etwa 20 kosmische Sekunden vor Mitternacht der nächste Sprung erfolgte.
Willkommen in einer der ersten Städte: Çatalhöyük, eine Siedlung in der anatolischen Hochebene der heutigen Türkei. Ein Tag vor 9000 Jahren, es ist Abend und jeder ist zu Hause. In dieser Nacht leben in dieser Urstadt etwa so viele Menschen wie einst in ganz Afrika. Çatalhöyük besteht aus festen Wohnhäusern und ist fast 20 Fußballfelder groß. In den 90 000 Jahren, seit die Menschen in der Blombos-Höhle erste chemische Versuche unternahmen, hat sich einiges verändert.
In den Ruinen von Çatalhöyük wurden weibliche Statuetten, einige stehende und einige sitzende wie diese, gefunden. Manche Archäologen erkennen darin Fruchtbarkeitsgöttinnen, andere meinen, dass damit ältere Frauen der Gemeinschaft geehrt wurden.
Eine künstlerische Darstellung der Urstadt Çatalhöyük vor etwa 9000 Jahren. Noch gab es keine Straßen oder Haustüren.
Die Stadt ist noch so neu, dass es keine Straßen gibt – oder Haustüren. Der einzige Weg in die Wohnung führt über das Dach des Nachbarn. Über eine Leiter betritt man durch die Dachluke die eigene Behausung.
In Çatalhöyük fehlt noch etwas: Es gibt keinen Palast. Den bitteren Preis der Ungleichheit für die Erfindung der Landwirtschaft muss die menschliche Gesellschaft erst noch bezahlen. Hier gibt es keine Dominanz der Wenigen über die Vielen. Es gibt nicht das eine Prozent, das Reichtum anhäuft, während die meisten anderen nur überleben oder nicht einmal das. Das Ethos des Teilens ist hier lebendig. Es gibt Hinweise auf Gewalt gegen Frauen und Kinder, aber die Schwächsten essen das Gleiche wie die Stärksten. Wissenschaftliche Analysen der Ernährung der hier lebenden Frauen, Männer und Kinder zeigen eine bemerkenswerte Ähnlichkeit. Die Häuser gleichen sich, ohne farblos zu sein. Den Raum dominiert ein riesiger Auerochsenkopf mit spitzen Hörnern, der an der reich bemalten Wand hängt. Die Mauern sind mit Zähnen, Knochen und Tierfellen geschmückt.
Die Wohnungen in Çatalhöyük wirken ausgesprochen modern. Der einheitliche Grundriss ist höchst zweckmäßig und modular. Es gibt Nischen für Arbeit, Essen, Unterhaltung und Schlafen. Holzbalken tragen die Decke. Hier leben Großfamilien mit sieben bis zehn Menschen.
Der Ocker, den unsere Vorfahren 100 000 Jahre zuvor in Afrika entdeckten, dient in Çatalhöyük zur Ausschmückung der Innenräume, für Wandgemälde mit Auerochsen, Leoparden, einem Läufer, Geiern, die Fleisch aus einem kopflosen Kadaver reißen, und Jägern, die einem Hirsch nachstellen. Auch bei der Totenverehrung spielt Ocker eine bedeutende zeremonielle Rolle.
Eine Prozession mit einem Leichnam verlässt Çatalhöyük in Richtung eines weiten, offenen Platzes in der Ebene. Eine hohe Plattform erwartet sie. Die Teilnehmer legen den Leichnam auf der Plattform ab und geben ihn den Raubvögeln und Elementen preis. Eine Person wacht darüber, dass die Knochen zurückbleiben. Geier kreisen über der Plattform, ein Sturm zieht auf. Die Zeit vergeht. Wenn nur noch das nackte Skelett übrig ist, holt eine Prozession es wieder ab. Es wird in eine Fötuslage gefaltet und mit rotem Ocker geschmückt, bevor es im Boden unter dem Wohnzimmer begraben wird. Manchmal werden die Gräber wieder geöffnet, vielleicht bei einem Ritual, und der Schädel wird mitgenommen. Ich frage mich, ob diese Menschen mit dem Tod besser zurechtkamen als wir.
Der rote Ocker dient noch einem weiteren wichtigen Zweck: Geschichte und Kartografie. Ein Künstler malt die Umrisse der Dächer, die wie ein einziger großer Organismus dem nahen Vulkan gegenüberstehen. Zum ersten Mal entwerfen Menschen ein zweidimensionales Abbild ihrer Umgebung in Raum und Zeit. »Vom Vulkan aus gesehen steht hier mein Haus.« Und mit ein paar hingeworfenen Strichen, die aufsteigenden Rauch andeuten, sendet der Künstler eine Nachricht über 9000 Jahre hinweg: »Ich war hier, als der Vulkan ausbrach.«
DAS EXPERIMENT IN ÇATALHÖYÜK und anderen Urstädten erwies sich als erfolgreich. Innerhalb weniger Tausend Jahre entstanden überall Städte. Wenn sich Menschen verschiedener Kulturen an einem Ort versammeln, dann werden Ideen ausgetauscht und neue Möglichkeiten geboren. Die Stadt ist wie ein Gehirn, ein Brutkasten für neue Ideen.
Im Amsterdam des 17. Jahrhunderts mischten sich Menschen der alten und neuen Welt wie niemals zuvor. Die gegenseitige Befruchtung führte zu einem Goldenen Zeitalter der Wissenschaft und Kunst. In Italien verkündeten Giordano Bruno und Galileo die Existenz anderer Welten. Für ihre Häresie mussten sie allerdings büßen. Doch schon 50 Jahre später wurde der Astronom Christiaan Huygens, der dieselben Ansichten vertrat, in Holland mit Ehren überhäuft.
Licht war das Leitmotiv der Epoche; das Licht der Gedanken- und Religionsfreiheit; das der Forschung, die den Menschen des Planeten brutal klarmachte, dass sie einen einzelnen Organismus bewohnen; das Licht, das die Gemälde dieser Zeit, besonders von Vermeer, so wunderbar macht; und das Licht als Objekt wissenschaftlicher Forschung.
LINKS: Antoni van Leeuwenhoek sah und zeichnete als Erster Leben unter einem Mikroskop. Er nannte die Lebewesen »animalcula« (»winzige Tiere«). RECHTS: Im Cosmotheoros (1698) zeigte Christiaan Huygens die Sonne (Sol) und die sie umkreisenden Planeten.
Damals lebten in Amsterdam drei Männer, deren Leidenschaft für Licht sie dazu anregte, Geräte zu erfinden und zu vervollkommnen, die dem Licht etwas scheinbar Unmögliches entlockten. Sie konzentrierten oder streuten Lichtstrahlen durch ein gewölbtes Glas – die Linse. Die Sehhilfe eines Textilhändlers, mit der er die Qualität von Stickereien beurteilte, wurde das Fenster zu verborgenen Welten.
Antoni van Leeuwenhoek enthüllte mit einer einzelnen Linse den Kosmos der Mikrobenwelt. Er untersuchte damit Speichel, Samenflüssigkeit und Teichwasser und entdeckte ganze Gesellschaften von Lebewesen, die bis dahin völlig unbekannt waren.
Sein Freund Christiaan Huygens benutzte zwei Linsen, um Sterne, Planeten und Monde zu sich heranzuholen. Als Erster sah er, dass die Ringe den Saturn nicht berührten, und erkannte ihre wahre Natur. Er entdeckte den Saturnmond Titan, den zweitgrößten Mond unseres Sonnensystems. Er erfand die Pendeluhr und vieles andere wie den Filmprojektor und Zeichentrickfilme. Mit ihm werden wir später auf unserer Reise noch eine ganze Nacht verbringen.
Huygens erkannte in den Sternen andere Sonnen mit eigenen Planeten und Monden. Für ihn bestand das Universum aus unendlich vielen Welten, von denen viele belebt waren. Doch warum gab es in den heiligen Büchern keinen Hinweis darauf? Warum sollte Gott uns das verschweigen? Gott war in diesem Punkt kategorisch: Er erwähnte außer uns keine anderen Kinder.
Während dieser Widerspruch bei den Aufklärern für Unbehagen sorgte, sprach nur einer das Thema offen an. Auch dieser Mann war ein Genie des Lichts. Als der Früchtehandel seines verstorbenen Vaters Bankrott ging, verdiente er seinen Lebensunterhalt mit dem Schleifen der Linsen, mit denen die verborgenen Welten gefunden wurden, die großen wie die kleinen.
Der 1632 geborene Baruch de Spinoza war Mitglied der jüdischen Gemeinde in Amsterdam. Doch mit Anfang Zwanzig begann er, öffentlich von einer neuen Art von Gott zu sprechen. Sein Gott war kein zorniger Tyrann, der vorschrieb, welche Rituale man durchführen, was man essen oder wen man lieben musste. Spinozas Gott war das physikalische Gesetz des Universums. Seinen Gott interessierten keine Sünden, seine Thora war das Buch der Natur.
Die Gemeinde der Amsterdamer Synagoge zeigte sich von diesen Äußerungen, die sie als gottlos empfand, begreiflicherweise entsetzt. Zahlreiche ihrer Mitglieder waren vor der Inquisition und ihren Folterknechten aus Spanien und Portugal geflohen, wo sie gezwungenermaßen konvertieren und häufig hilflos zusehen mussten, wie ihre Angehörigen gequält und ermordet wurden. Amsterdam bot diesen Juden Zuflucht. Spinozas radikale Ideen konnten sie nur als Bedrohung der mühsam errungenen Sicherheit sehen. Sie exkommunizierten den jungen Rebellen und beschlossen, ihn auszustoßen, so wie das unsere Jäger-Sammler-Vorfahren wohl aus anderen Gründen gemacht hätten.
Ihr Dekret von Juli 1656 war eine Umkehrung der Aufforderung im 5. Buch Mose, 6:4,6–7, die ihnen und ihren Vorfahren befiehlt, den Herrn mit allem zu lieben, was sie haben. Ich lernte diese Worte als Kind und erinnere mich noch immer daran.
Höre, o Israel: Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Und diese Worte, die ich dir an diesem Tag befehle, sollen in deinem Herzen sein:
Und du sollst sie gewissenhaft deinen Kindern lehren, und von ihnen sprechen, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du unterwegs bist und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst.
Die Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Amsterdam wendeten in ihrem Urteil eine Variation dieser Glaubensformel an, um ihre Wut auf Spinozas »teuflische Ansicht« und »abscheuliche Häresie« auszudrücken: »Verflucht sei er am Tag und verflucht sei er bei Nacht; verflucht sei er, wenn er sich hinlegt, und verflucht sei er, wenn er aufsteht. Verflucht sei er, wenn er hinausgeht, und verflucht sei er, wenn er hereinkommt.«
Die Ängste der Gemeinde sind verständlich. Sie hatte auf der iberischen Halbinsel erlebt, wie sich ihre Welt in einen Albtraum verwandelte, und sehnte sich nach Frieden und Akzeptanz. Trotzdem liegt darin eine gewisse Ironie. Die Thora lehrt uns, dass Gott in jeder einfachen Handlung unseres Alltags gegenwärtig ist. Und ist es nicht genau das, was Spinoza meinte, indem er Gott überall sah, in allem – in der gesamten Natur?
Deshalb hegte Spinoza einen Widerwillen gegen Wunder. Im sechsten Kapitel des Theologisch-politischen Traktats von 1670 erläutert er ausführlich, warum er ihre angebliche Bedeutung nicht ertrug. Suche nicht in den Wundern nach Gott, sagt Spinoza. Wunder verstoßen gegen die Naturgesetze. Wenn Gott der Verfasser der Naturgesetze ist, sollte Gott dann nicht am besten darin erkannt werden? Wunder sind Fehldeutungen von Naturereignissen. Erdbeben, Überflutungen, Dürren dürfen nicht persönlich genommen werden. Gott spiegelt nicht die Hoffnungen und Ängste der Menschen wider, sondern ist die schöpferische Kraft hinter dem Universum, der man am besten in der Erforschung der Naturgesetze begegnet.
Tausende Jahre lang, bereits bald nach der Erfindung der Landwirtschaft, war das Heilige für uns von der Natur getrennt. Wir lernten, dass wir isoliert vom Rest des Lebens geschaffen wurden und dass Gott verlangt, unsere Natur zu leugnen und zu überwinden, die in dieser Weltsicht voller Sünde ist. Spinozas Gott zu huldigen, hieß dagegen, die Naturgesetze zu studieren und zu ehren.
Die Bestrafung und Ausstoßung aus der jüdischen Gemeinde ertrug Spinoza gelassen. Wie heute gab es auch damals Menschen, die durch religiöse Vorstellungen bedroht wurden. Jemand griff Spinoza mit dem Messer an, doch dem Angreifer gelang es nur, den Umhang seines Opfers aufzuschlitzen, ehe er floh. Spinoza ließ das Kleidungsstück nie flicken und trug es als Ehrenzeichen. Er zog schließlich nach Den Haag, wo er weiterhin Linsen für Mikroskope und Teleskope schliff.
Sein Traktat enthielt aber noch Brisanteres als die Ablehnung von Wundern. Spinoza schrieb, nicht Gott habe die Bibel diktiert, sondern sie sei das Werk von Menschen. Für Spinoza war eine offizielle Staatsreligion mehr als spiritueller Zwang. Die übernatürlichen Ereignisse, die zentral für die großen religiösen Traditionen waren, hielt Spinoza für nicht mehr als organisierten Aberglauben. Er glaubte, dass dieser Wunderglaube für eine freie Gesellschaft der Bürger eine Gefahr darstelle.
Niemand hatte so etwas zuvor laut ausgesprochen. Spinoza wusste, dass er selbst für die Freidenker Hollands zu weit ging. Das Theologisch-politische Traktat führte Ideen ein, die für die amerikanische und viele andere Revolutionen grundlegend waren, wie die elementare Notwendigkeit, in einer demokratischen Gesellschaft Staat und Kirche zu trennen. Das Traktat erschien anonym, mit fiktivem Erscheinungsort und Verlag. Trotzdem machte das Buch Spinoza in ganz Europa bekannt. Er starb 1677 mit 44 Jahren, vermutlich weil er beim Linsenschleifen jahrelang Glasstaub eingeatmet hatte.
Im November 1920 pilgerte ein anderer Mann, der sich leidenschaftlich für Licht interessierte, zur bescheidenen Werkstätte nahe Den Haag, die als Zeugnis für den großen Einfluss von Spinozas Philosophie erhalten wurde. Der für sein neues Naturgesetz weltbekannte Wissenschaftler wurde oft gefragt, ob er an Gott glaube. Albert Einstein antwortete darauf, er glaube an Spinozas Gott, der sich in der Harmonie des Seienden zeige, aber nicht an einen Gott, der sich mit Schicksalen und Handlungen der Menschen abgebe.
UNSER VERSTÄNDNIS DER NATURGESETZE übersteigt Spinozas kühnste Vorstellungen. Doch wie können wir unser gestörtes Verhältnis zur Natur verbessern? Lassen Sie mich hierzu eine Parabel über eine der längsten Symbiosen des Lebens erzählen. Dafür gehen wir im Kosmischen Kalender zum Nachmittag des 29. Dezembers zurück.
In dieser längst vergangenen Zeit gab es zwei Königreiche. Sie schlossen einen Bund, der ihnen unermessliche Reichtümer einbrachte. Es war über fast 100 Millionen Jahre eine wunderbare Beziehung – dann entwickelte sich in einem der Königreiche eine neue Art von Wesen. Seine Nachfahren plünderten die Reichtümer und brachen den Bund. In ihrer Arroganz wurden sie zur tödlichen Gefahr für beide Königreiche … und sich selbst.
Dies ist die wahre Geschichte zweier von dem halben Dutzend Reichen der Natur – dem Reich der Pflanzen und dem der Tiere.
Pflanze zu sein, ist nicht einfach. Für einen Ortsgebundenen ist Sex eine Herausforderung. Verabredungen gibt es nicht. Man wirft seine Samen in den Wind. Man wartet nur darauf, dass dieser weht. Mit viel Glück landen einige der Pollen auf dem weiblichen Reproduktionsteil einer anderen Pflanze – dem Stempel einer Blüte.
Die Pflanzen spielen dieses Glücksspiel einige 100 Millionen Jahre – bis die Insekten auftauchen und Cupido spielen. Das Ergebnis ist eine der großartigsten Koevolutionen des Lebens. Die Insekten besuchen die Blüten wegen einer proteinreichen Pollenmahlzeit, dabei bleibt unweigerlich etwas Pollen an ihrem Körper haften. Für die nächste Mahlzeit besuchen sie eine andere Blüte und bestäuben wiederum unabsichtlich diese mit dem anhaftenden Pollen und ermöglichen so die Fortpflanzung.
Eine Holzbiene mit goldenen Pollenkörnchen am Körper
Dabei gewinnen beide, Blumen und Insekten, und das löst eine Reihe evolutionärer Entwicklungen aus. Pflanzen beginnen neben Pollen auch einen Zuckernektar zu produzieren. Nun kommen die Insekten auch noch zum Nachtisch. Sie werden rundlicher, bekommen pelzige Körper und sogar kleine Pluderhosen an den Füßen, mit denen sie mehr Pollen angeln.
Daraus zieht noch ein anderes Königreich der Tiere einen Vorteil. Wir. Unsere Vorfahren lieben Honig, wie die Gestalt mit dem Rauchtopf in der spanischen Höhle und viele andere alte Darstellungen zeigen. Sie genießen ihn und finden sogar heraus, wie sie daraus Met herstellen und sich berauschen können.
Auch die Vögel und Fledermäuse drängen in das Pollengeschäft, aber sie haben nie denselben Erfolg wie die Insekten und besonders die Bienen. Wir haben viele Gründe, den Bienen dankbar zu sein – Schönheit zum Beispiel. In der Konkurrenz um ihre Reproduktionsdienste setzen die Pflanzen neben dem Nektar noch auf weitere Strategien: Aroma und Farbe.
So sieht eine Biene die Blüte einer Pferdeminze. Mittels Ultraviolettfotografie können auch wir das so sehen.
Bienen besitzen drei Fotorezeptoren, ähnlich unseren Augen, nur sind ihre anders. Wir nehmen Rot, Blau und Grün wahr, sie sehen Ultraviolett, Blau und Grün. Rot sehen sie nur in den Wellenlängen von Orange bis Gelb.
Wir schulden den Bienen noch wesentlich mehr Dank. Jeder dritte Bissen Essen – und das gilt auch für Fleischesser – wird nur durch sie möglich. Sie vergrößern nicht nur die verfügbare Nahrungsmenge, sie verantworten auch einen Großteil der Biodiversität, die unsere Nahrungsversorgung sicherstellt.
Und nun kommen wir zum traurigen Teil der Parabel, in dem ein neues Mitglied aus dem Reich der Tiere in diesen alten Bund hineinpfuscht, durch Unkenntnis und Gedankenlosigkeit, durch Gier und Kurzsichtigkeit. Man ahnt wohl, wo das hinführt und wer daran schuld ist.
UNSER LEBENSSTIL ALS JÄGER UND SAMMLER entwickelte sich 500 000 Jahre lang im Gleichgewicht mit der Natur. Ja, Tiere starben wegen Überjagung aus, aber unsere Vorfahren verursachten nie eine globale Katastrophe. Die Erfindung der Landwirtschaft vor 12 000 bis 10 000 Jahren veränderte uns. In gewissem Sinn leben wir seitdem in einem post-agrarischen Stresssyndrom. Wir hatten noch nicht genügend Zeit, eine Strategie zu entwickeln, um mit der Natur und miteinander in Harmonie zu leben. Die neolithische Revolution mit ihrer Möglichkeit, unsere Lebensmittelproduktion zu steigern, war Segen und Fluch zugleich. Sie führte zu einem Bevölkerungsanstieg und zur kritischen Situation von heute.
Ich stelle mir vor, dass irgendwo ein Denkmal für alle abgebrochenen Zweige des Lebensbaums steht: der Saal des Aussterbens. Man muss eine leblose Einöde durchqueren, um dieses imposante, nüchterne und tragische Gebäude ohne Fenster zu finden, ohne Garten, der seine Endgültigkeit erträglicher machen könnte. Ein schauriger Lichtstrahl fällt durch die Kuppel der zentralen Rotunde auf den mit Sand bestreuten Granitboden. Sechs große Tore führen zu Sälen mit Dioramen der Lebensformen, die in den sechs Massenaussterben verschwanden, die das gesamte Leben der Welt in Gefahr brachten.
Noch vor ein paar Jahren kannte man nur fünf Massenaussterben. Daher tragen nur fünf der sechs Säle Namen. Sie sind über den Torbögen eingraviert: Ordovizium, Devon, Perm, Trias, Kreidezeit. Sie erinnern an die gewaltigen chemischen, geologischen und astronomischen Ereignisse, die so viel Tod verursachten. Nun erhält der sechste Saal einen Namen, er wird nach uns getauft: Anthropozän. »Anthropos« ist das griechische Wort für »Mensch«, »zän« das Suffix für »neu«. Wir leben nun offiziell im Zeitalter des durch Menschen verursachten Massenaussterbens.
DIESEN SAAL HEBEN WIR UNS JEDOCH FÜR SPÄTER AUF. Wir stehen erst am Anfang dieser Entdeckungsreise und wir Menschen haben schon oft Hürden überwunden. Erst vor Kurzem vollbrachten wir etwas, was Einstein noch für unmöglich hielt. Er irrte sich, da er unsere Fähigkeiten unterschätzte. Wir sollten nicht dasselbe tun. Einstein verstand den Kosmos als Erster als Ozean aus Raum und Zeit. Er erkannte, dass Materie kleine Wellen durch die Raumzeit schicken kann. 1916 vermutete Einstein, dass weit entfernte, gewaltige Explosionen von Materie im Universum noch viel größere Wellen auslösen könnten – Gravitationswellen.
Hier ist einer der seltenen Fälle, an denen selbst Einsteins Vorstellungskraft scheiterte. Er verneinte rundweg, dass es möglich sei, in einem Versuch die Existenz von Gravitationswellen zu beweisen. Warum nicht? Stellen Sie sich vor, Sie sollten die Breite eines Haares in einer entfernten Galaxie messen. Einstein hielt die Gravitationswellen für zu schwach, als dass sie in den enormen Weiten des Kosmos erfasst werden könnten. Bis sie diese Weiten durchquert hätten, wären sie für uns nicht mehr wahrnehmbar.
Ein Jahrhundert lang bemühten sich theoretische und experimentelle Physiker um einen direkten Beweis für ihre Existenz. Waren sie kleiner als ein Atom, kleiner als ein einziges Teilchen, ein Zehntausendstel des Durchmessers eines einzigen Protons? Wir konnten die Spur zur Quelle zurückverfolgen – der Kollision von zwei Schwarzen Löchern, eine Milliarde Lichtjahre entfernt.
Wissenschaftler begannen 1967 mit einem Projekt, das sie Laser-Interferometer Gravitationswellen-Observatorium (LIGO) nannten. Sie brauchten ein massives Ereignis, das die Raumzeit störte – wie zwei kollidierende Schwarze Löcher –, und zwei empfindliche Detektoren, die den Zusammenprall eine Milliarde Lichtjahre entfernt registrieren konnten. Die Kollision löste einen Raumzeit-Tsunami aus, der den Raum in alle Richtungen ausdehnte. Die Zeit verlangsamte sich, ehe sie beschleunigte und wieder langsamer wurde.
Für etwas so Schwaches benötigt man wirklich große Ohren, deshalb muss jeder der Detektoren vier Kilometer lang sein. Man braucht zwei davon, um die Gravitationswelle von lokalen Störungen zu unterscheiden. Der zweite Detektor liefert die Bestätigung. Da die beiden Detektoren in Livingston (Louisiana) und Hanford (Washington) auf verschiedenen Seiten des Kontinents liegen, können die Forscher den winzigen Unterschied in der Ankunftszeit der Signale berechnen und so ihre Quelle anvisieren – die eine Milliarde Lichtjahre entfernte Kollision der Schwarzen Löcher.
Wie die Welle auf dem Meer wird auch die Gravitationswelle auf ihrer Reise gestreut. Als Einstein vor 100 Jahren seine revolutionäre Idee hatte, war diese Gravitationswelle noch 100 Lichtjahre von der Erde entfernt und umspülte sanft den Gelben Zwerg HD 37124 und seine Planeten und Monde in unserer eigenen Galaxie. Ob es in diesen Welten jemanden gab, der sie bemerkte?
In dieser künstlerischen Darstellung kollidieren zwei Schwarze Löcher. Vor 1,1 Milliarden Jahren löste eine solche Kollision eine Gravitationswelle aus, die die LIGO-Observatorien 2015 registrierten. Das neue Schwarze Loch hat die 20-fache Masse der Sonne.
Als die Gravitationswelle auf die LIGO-Detektoren traf, war der kosmische Tsunami zu einem Hauch abgeflaut. Nur ein leises Zirpen, aber genug, um ihre Existenz zu belegen und den ersten direkten Beweis für Schwarze Löcher zu erbringen. Die leitenden Wissenschaftler des Projekts erhielten 2017 den Physik-Nobelpreis.
Dieses fast 50 Jahre dauernde, äußerst ambitiöse wissenschaftliche Vorhaben und seine Generationen übergreifende Dauer erinnern mich an den Bau der gigantischen Kathedralen in der Vergangenheit. Sie symbolisieren eine Selbstlosigkeit im Dienste der Menschheit, die mich hoffen lässt.
Das Projekt Breakthrough Starshot plant, ultraleichte Kleinstsonden mit einer Geschwindigkeit von über 160 Millionen Stundenkilometern in nur 20 Jahren zu Proxima Centauri zu schicken, dem erdnächsten Stern außerhalb unseres Sonnensystems.
WÄHREND ICH HIER SCHREIBE, arbeiten Forscher und Ingenieure an Breakthrough Starshot, der ersten Erkundungsmission der Menschen zum nächsten Stern, deren Ende sie vermutlich nicht erleben werden.
In etwa 20 Jahren wird eine Armada von 1000 interstellaren Sonden von der Erde aufbrechen. Angetrieben von Laserlicht, das sie mit Segeln auffangen, werden sie nur ein Gramm wiegen und nur erbsengroß sein. Doch sie werden alles haben, was auch unsere ersten interstellaren Sonden, die Voyagers, an Bord hatten – und viel mehr. Jede Nanosonde wird in den Welten eines anderen Sterns erste Erkundungen ausführen und diese visuellen und wissenschaftlichen Informationen zur Erde senden können.
Voyager 1 ist seit über 40 Jahren mit der beeindruckenden Geschwindigkeit von 61 000 Stundenkilometern unterwegs. Dies erreichte sie durch ein Gravitationsmanöver am Jupiter, an dem sie im ersten Jahr ihrer Odyssee vorbeiflog. Aber im Maßstab einer Galaxie reicht das nicht. Schnell, doch viel zu langsam, um irgendwohin zu kommen.
Die Nanosonden von Starshot werden die Voyagers in nur vier Tagen überholen. Erstaunlich, ja, aber Starshot erreicht nur 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Die Sterne liegen sehr weit auseinander. Der nächste, Proxima Centauri, ist vier Lichtjahre entfernt. Das entspricht einer Reisedauer von 20 Jahren. Im System von Proxima Centauri gibt es eine Welt in der habitablen Zone, womöglich mit Wasser und Leben. Es könnte noch mehr bisher unentdeckte Welten in diesem System geben. Unsere Robotergesandten werden uns ihre Reiseberichte in Funkwellen mit Lichtgeschwindigkeit von diesen Welten schicken. Diese werden vier Jahre benötigen, um uns zu erreichen. Was werden sie uns in etwas über 40 Jahren offenbaren?
Einige von uns werden diese neuen Seiten im Buch der Natur noch lesen.
Von der Blombos-Höhle zum Ritt auf dem Sternenlicht in nur wenigen Minuten des Kosmischen Kalenders: Wir befinden uns tatsächlich an einem kritischen Scheideweg unserer Geschichte. Aber es ist nicht zu spät. Wir haben bewiesen, dass wir die Hoffnungen unserer größten Denker übertreffen können. Die vergangenen und zukünftigen anderen Welten, die wir besuchen, und die Geschichten der Forscher, die wir erzählen werden, beweisen, dass wir in der Lage sind, das Stadium unserer technologischen Jugend zu überleben, unsere kleine Heimat zu schützen und sicher durch den Ozean der Raumzeit zu reisen – nicht länger von Erde, Meer oder Himmel beschränkt.