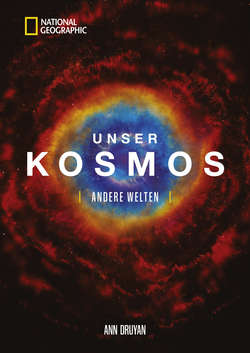Читать книгу Unser Kosmos. Andere Welten. - Ann Druyan - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
| 2 | O MÄCHTIGER KÖNIG
ОглавлениеDie Herzen werden aber nicht durch Waffen,
sondern durch Liebe und Edelmut gewonnen.
BARUCH DE SPINOZA, ETHIK, 1677
Halte nicht das Korn zurück und warte auf höhere Preise,
wenn die Menschen hungrig sind.
ZARATHUSTRA ZUGESCHRIEBEN
Der Eingang zur Pir-e Sabz, einer heiligen Tropfsteinhöhle der Zoroastrier im heutigen Zentraliran. Der Sage nach hat Nikbanu, die Tochter des letzten Sassanidenkönigs, hier Zuflucht gesucht. Die Tropfen in der Höhle sollen ihre kummervollen Tränen sein. Die Tropfen gaben dem Schrein seinen Namen: Tschak Tschak.
Drei Schädel aus einer Epoche, als drei verschiedene Arten unserer Vorfahren zur gleichen Zeit am selben Ort lebten: Homo habilis, Homo erectus und Australopithecus robustus (v. l. n. r.). Sie wurden von den Expeditionsteams Richard Leakeys gefunden und lebten alle vor etwa 1,5 Millionen Jahren.
Fast 10 000 Jahre nach der Erfindung der Landwirtschaft machen wir unsere ersten Trippelschritte, um den Kosmos zu erkunden, gerade jetzt, wo unser Kurzzeitdenken und unsere Gier drohen, unsere Zivilisation zu Fall zu bringen. Wir wissen, dass wir uns ändern müssen, um das zu vermeiden. Aber ist das möglich? Ist unsere Spezies in der Lage, sich zu verändern? Oder treibt uns etwas zur Selbstzerstörung an?
Diese Frage quälte Carl Sagan und mich. Wir beschlossen, den Beweisen zu folgen, wohin sie uns auch führen würden. Nach Jahren des Forschens und Nachdenkens entstand das Buch Schöpfung auf Raten (1993), aus dem Teile für dieses Kapitel übernommen wurden. Die Frage von damals wirkt heute dringlicher denn je.
Wenn unser Gedächtnis bis zum Beginn des Lebens zurückreichen würde, dann wäre das Rätsel kleiner. Doch wir stehen erst am Anfang, die Erfahrungen unserer Spezies vor unseren bewussten Erinnerungen zu rekonstruieren – und was lange vor unserer Existenz als Art zu angeborenen Defiziten geführt haben könnte.
Wir Menschen sind wie eine Familie aus Amnesieopfern, die sich Geschichten über ihre Vergangenheit ausdachten, bis sie Mittel fanden, diese zu rekonstruieren – die Wissenschaften. Wir schaufeln noch immer Erde in ein Sieb, um nach Stücken aus Feuerstein und Tierknochen zu suchen, also den wenigen dauerhaften Artefakten unserer menschlichen Ursprünge.
In der Wonderwerk-Höhle in Südafrika wurde eine der ältesten Feuerstellen gefunden. Um sie versammelten sich vor bis zu einer Million Jahre unsere Vorfahren und entwickelten die Sozialstrukturen, die wir noch heute bei uns sehen.
WENN ES AUF DER ERDE HEILIGE ORTE für unsere Spezies gibt, dann gehört die Wonderwerk-Höhle in den Kurumanheuwels in der südafrikanischen Provinz Nordkap sicher dazu. Sie ist die älteste bekannte Fundstelle, an der Menschen das Feuer für ihre Zwecke bändigten. Dort versammelten sich vor einer Million Jahren unsere Vorfahren, um die menschliche Kultur zu entfachen.
Die Höhle hat die Ausmaße eines Ballsaals. Selbst groß Gewachsene gehen hier aufrecht mehr als 120 Meter bis in den hintersten Winkel hinein. Wissenschaftler vieler Disziplinen sind bereits hier gewesen, um die Höhle mit Lasern zu scannen, jeden Millimeter Pollen und Sediment mit Lumineszenz-Verfahren und Technik zur Isotopen-Datierung zu untersuchen. Alles in dem Bemühen, die Puzzleteile der Geschichte dieses Orts zusammenzusetzen und herauszufinden, wer wir einst waren.
Die mikroskopisch kleinen Aschestückchen sagen uns, welche Feuer natürlich und welche absichtlich entstanden sind. Die Überreste der vor Hunderttausenden von Jahren erloschenen Feuer tief in der Höhle zeigen, dass unsere Vorfahren an diesen Feuern kochten und sich wärmten. Jeder von uns gehört zur Gattung Homo. Wir sind Homo sapiens – sogenannte »weise Menschen«. Unsere Urahnen, die sich in der Wonderwerk-Höhle versammelten, waren Homo erectus – »aufgerichtete Menschen«. Sie waren noch nicht »wir«, doch wir tragen ihr Erbe in uns. Wir wissen nicht viel über sie. Wir vermuten aber, dass sie sich im Alter oder bei Krankheit umeinander kümmerten. Wir wissen, dass sie geschickte Werkzeugmacher waren.
Besuchen Sie alle Welten des Sonnensystems – jeden Kometen, Asteroiden, Mond und Planeten. Sie werden nur in einer davon ein Feuer entzünden können – in unserer. Das ist nur möglich, weil es in der Atmosphäre genügend Sauerstoff gibt – erst seit den letzten 400 Millionen Jahren oder den letzten zehn Tagen des Kosmischen Jahres. In der Wonderwerk-Höhle zähmten unsere Ahnen die Macht des Feuers und wurden für ihr Geschick reich belohnt. Damals fingen wir an, unsere Nahrung weich zu kochen, was unserem Körper mehr Energie lieferte, als wir für das endlose Kauen des ungekochten und daher viel zäheren rohen Fleisches verbrauchten. Das Feuer wärmte uns und vertrieb die Raubtiere. Wir versammelten uns nachts um die Feuer, aßen zusammen und erzählten uns die Geschichten, die uns und unserer Sippe eine geteilte, angelernte Identität gaben und die Kinder mit den Älteren verband.
VON ALLEN LEBEWESEN ZÄHMTE NUR DER MENSCH DAS FEUER. (Auch Pflanzen entwickelten Überlebensstrategien, um sich bei Bränden gegen Konkurrenten durchzusetzen, aber sie können Brände weder entzünden noch löschen.) Die zentrale Rolle des Feuers für das Denken und die Kultur des Menschen erreicht ihre höchste Anerkennung im Glauben und den Riten einer der ältesten Religionen.
Zur Zeit des biblischen Propheten Abraham, vor vermutlich 4000 Jahren, gab es auch im Land der Perser, dem heutigen Iran, einen Propheten. Die körperliche Manifestation von Zarathustra war das Feuer. Jeder zoroastrische Tempel ist dem Feuer geweiht, und eine der wenigen rituellen Verpflichtungen besteht darin, über die Jahrhunderte hinweg eine ewige Flamme zu hüten. Das Feuer symbolisiert die Reinheit Gottes und das Licht des erleuchteten Geistes.
Der Gott der Zoroastrier, Ahura Mazda, fordert nicht viel, weder rituelle Opfer noch Geld. Er fordert von den Menschen lediglich eine hell leuchtende Flamme, reine Gedanken sowie gute Worte und Taten. Doch die meisten Menschen können selbst diese einfachen Anforderungen nicht erfüllen, haben schlechte Gedanken und sagen schlechte Dinge. Manche verüben Verbrechen. Warum?
Wir haben noch keine befriedigende Antwort auf diese Frage. Die Zoroastrier gehörten zu den ersten, die sie zu beantworten versuchten. Alles Schlechte der Welt – die von Menschen verübten Verbrechen genauso wie Naturkatastrophen und Krankheiten – werden durch Ahura Mazdas Gegenspieler verursacht, seinen bösen Zwilling Ahriman. Ahura Mazda zählt auf die Hilfe der Menschen, um Ahriman zu besiegen. Jeder Mensch kann durch seine Taten entscheiden, ob sich in der Zukunft des Universums die Waage zum Guten oder zum Schlechten neigt.
Dieses Teilrelief aus dem antiken Persepolis zeigt Ahriman, bei den Zoroastriern das Urbild des Bösen, wie er einen Stier anfällt.
In Persepolis ist ein plastisches Flachrelief mit einer Darstellung Ahrimans zu sehen. Die persischen Könige erbauten die prächtige Anlage im 6. Jahrhundert v. Chr., als sie die einzige Supermacht der Erde waren. Ahriman hat kleine, kurze Hörner, einen langen spitzen Schwanz und gespaltene Hufe. Erinnert das an unsere Vorstellungen vom Teufel? Über 1000 Jahre war der Zoroastrismus von Griechenland bis Indien die vorherrschende Religion. Kein Wunder, dass er die nachfolgenden Religionen beeinflusste.
Ahura Mazda ist ein Gott, der Hunde, aber keine Katzen mag. Wenn ein Zoroastrier aus Versehen einen Hund tötet, kann er das nur sühnen, indem er 10 000 Katzen tötet. Ahriman hingegen liebt Katzen. Ist es ein Relikt dieser Vorliebe, dass Katzen mit Hexen, den Handlangerinnen des Teufels, in Verbindung gebracht werden?
WIE SOLLTE MAN DAS BÖSE in der vorwissenschaftlichen Welt besser erklären als mit der beständigen Missgunst eines Ahriman?
Stellen Sie sich vor, Sie wären im alten Persien und kümmerten sich gerade um Ihren Laden, als der Familienhund, ein Saluki, sich vom seit Jahren geliebten, treuen Familienbeschützer in ein geiferndes Monster verwandelt. Er wird plötzlich bösartig. Er knurrt, entblößt die Fangzähne, Schaum bildet sich im Maul und tropft von seinen vampirhaften Eckzähnen. Er springt auf, bewegt sich gezielt in Richtung Ihrer sieben Monate alten Tochter und späht in deren Korb. In einer Schrecksekunde begreifen Sie, dass sich Ihr Hund auf Ihr Baby stürzt. Wie sollte man diese schreckliche Verwandlung anders als mit dämonischer Besessenheit erklären?
Aber das ist nicht die Geschichte von Gut und Böse, vom Kampf zwischen Gott und Dämon. Es ist die Geschichte vom Jäger und seiner Beute. In diesem Fall ist der Jäger mikroskopisch klein. Krankheitserreger sind diabolisch kluge Jäger – sie erlegen ihre Wirte, nachdem sie sie zur Verbreitung ihrer Krankheit genutzt haben. Nur weil er zufällig vor ungefähr drei Wochen oder einigen Monaten einer mit Tollwut infizierten Fledermaus begegnete, wird dieser arme, unglückliche Hund ohne eigenes Verschulden zum Hauptdarsteller einer Horrorgeschichte.
Wenn die Krankheitserreger in der Blutbahn sind, rasen die Viren zum Hirn und befallen das limbische System. Die Tollwutviren oder Lyssaviren, benannt nach der Verkörperung des Wahnsinns und der Raserei in der griechischen Antike, manipulieren dort meisterhaft die Verschaltungen, die Wut auslösen. Der Hund wird zum zähnefletschenden Wolf, aus dem er sich einst entwickelte. Schwadronen von Viren belagern die Nervenzellen, dringen in sie ein und bringen die Maschinerie des Nervensystems in ihre Gewalt. Durch den Angriff der Viren auf die Nervenzellen wird das Tier zum herz- und furchtlosen Monster ohne Treue oder Liebe.
Eine Schwadron zylinderförmiger Viren schert aus und steuert die Nerven in der Hundekehle an. Das limbische System ist erobert, nun wird ein Virentrupp abgeordnet, um die Speichelproduktion zu steigern. Seine Aufgabe ist es, dem Hund die Schluckfähigkeit zu nehmen. Das maximiert die Chancen, dass Speichel mit Viren vom Hund auf das nächste Ziel übertragen wird. Ströme von Speichel fließen aus dem Maul des Hunds auf seine Brust und den Boden, was die Aussicht der Viren verbessert, neue Opfer zu finden.
Wie koordinieren Viren eine so ausgeklügelte Serie von taktischen Angriffen? Woher weiß das Virus, in welchem Teil des Hirns die Wut sitzt? Wir wissen das erst seit Kurzem. Das ist die Macht der Evolution durch natürliche Selektion. Eine zufällige, hochspezialisierte Mutation – etwa die Fähigkeit eines Virus, die Kehle des Opfers zu lähmen – wird sich bei ausreichender Zeit durchsetzen. Wenn sie die Überlebenschance des Virus erhöht, wird sie weitervererbt. Das Lyssavirus braucht in jeder Generation nur einen Überträger, um die bösartige Flamme am Leben zu erhalten.
Das Lyssavirus ist ein Meister der Manipulation, vom unheimlichen Wissen über die Neurologie der Beute bis zur Systematik und Präzision seines Angriffs. Das Eindringen in sein Opfer und seine Versklavung erinnern an den akribischen Kriegsplan eines der berühmtesten Generäle der Geschichte. Das Lyssavirus ist ein genialer Stratege.
Wir sind unsichtbaren Kräften ausgeliefert: Viren, Mikroben, Hormonen, unserer DNS. Unsere Vorfahren wählten die einzige Erklärung, die sie für das plötzliche dämonische Verhalten eines Hundes oder für das eines Kindes fanden, das mit 20 Jahren plötzlich begann, sich wie auf Geheiß von Kreaturen seltsam zu verhalten. Was sonst konnte das sein außer einem Teufelsfluch?
Das zylinderförmige Lyssavirus besitzt Glykoproteinstacheln – in diesem Computermodell rosa –, mit denen es sich an Zellen festhakt. Es zerstört die Persönlichkeit des befallenen Wirts.
NACHDEM WIR NUN UNS VERBORGENE biologische Mechanismen verstehen, können wir da noch an unserer Vorstellung vom Bösen festhalten? Die eigentlichen Taten mögen böse sein, aber diejenigen, die von unsichtbaren Kräften gesteuert werden, sind so unschuldig wie dieser arme Hund. Wir können das Geschehen nur verstehen, wenn wir Ahura Mazda und Ahriman oder eines ihrer Ebenbilder nicht mehr als Erklärung anbieten, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Aber die Verkörperungen des Bösen und die übernatürlichen Avatare des Guten dominieren weite Teile der Populärkultur; nach einiger Zeit der Verdrängung triumphieren sie fast unvermeidlich.
Versetzen wir uns in einen Außerirdischen oder Archäologen in ferner Zukunft, der etwas über unsere Zivilisation zu erfahren versucht. Das 21. Jahrhundert erlebte eine beispiellose wissenschaftliche und technologische Entwicklung. Die Menschen streckten wie nie zuvor ihre Fühler in Raum und Zeit des Universums aus. Sie drangen in Nanowelten vor, die in den Tiefen der Materie verborgen liegen, und schufen dreidimensionale Erfahrungswelten. Nutzten sie diese neu erworbenen Kräfte für Entdeckungsreisen in die von der Wissenschaft enthüllten Welten oder um das Wissen der Öffentlichkeit über die Natur zu vertiefen? Kaum. Man verwendete sie hauptsächlich zur Konstruktion bedrohlicher Roboter für zerstörerische Kämpfe bis zum Tod – ritualisierte Inszenierungen der Gladiatorenkämpfe zwischen Ahura Mazda und Ahriman, die die massenhafte Vernichtung von Städten und zahllosen Leben zur Folge hatten.
Und die ganze Zeit über bauten sie am sechsten Saal im Monument des Aussterbens. In einem seltenen Fall von Einsicht benannten sie ihn nach sich selbst – Anthropozän. Die Gänge des Neubaus wuchsen stetig durch immer neue Tableaus vernichteter Arten und Lebensräume, bis wir Menschen mit einem Schlag aufwachten – aber weswegen?
LENKEN UNS DIE VIER MILLIARDEN JAHRE LEBENSDREHBUCH, die in unseren Zellen niedergeschrieben sind? Ist die Existenz nur ein Kampf zwischen den genetischen Anweisungen konkurrierender Organismen – in dem wir, die Pflanzen und die Tiere kaum mehr als oder gar nur reine Schachfiguren sind? Lassen sich Geschichte und Leben darauf reduzieren? Ist DNS gleich Schicksal? Wir ringen noch immer mit dieser Frage. Unser Wissen über uns und die uns umgebende Natur ist keineswegs vollständig.
Carl und mich beeindruckte die Kraft einer speziellen Chemikalie, bei einem anderen Lebewesen eine spezifische Handlung auszulösen. Eine sterbende Honigbiene sondert Ölsäure ab. Der Geruch dieses »Todespheromons« zeigt den anderen Bienen an, dass diese Biene von Leichenträgerinnen hinausgeschafft werden muss. Es verblüffte uns, dass selbst eine gesunde, mit etwas Ölsäure betupfte Biene wie eine Leiche entfernt wird, so heftig sie auch protestiert. Das gilt selbst für die Königin, die für das Volk eine entscheidende Rolle spielt.
Wir waren erschüttert. Was heißt das für unsere eigenen Rituale? Erkennen Bienen die Infektionsgefahr durch die Verstorbene für das Volk? Haben Bienen eine Vorstellung vom Tod?
Während Jahrmillionen ihrer Kollektiverfahrung verströmten Bienen immer nur im Todeskampf Ölsäure. Erst in der letzten Zehntelsekunde des Kosmischen Kalenders erforderte Ölsäure eine spezielle Reaktion. Das dadurch ausgelöste sofortige Bestattungsverhalten ist die perfekte Anpassung an die Bedürfnisse der Bienen.
Sechs der 350 000 Käferarten der Welt. Die natürliche Selektion ist ein unvergleichlicher Künstler. V. L. N. R.: Sternotomis bohemani, Neptunides stanleyi, Proctenius chamaeleon, Donacia vulgaris, Goliathus meleagris und Carabus intricatus (Dunkelblauer Laufkäfer).
Ähnliche unmittelbare Verhaltensweisen, ohne offensichtliche Anweisung, finden wir bei vielen Tieren. Die Gans stupst ein aus dem Nest gerolltes Ei wieder zurück – ein Verhalten mit naheliegendem Wert für die Erhaltung der Gene der Gans. Sie rollt sogar alles aus der Umgebung des Nests zurück, was entfernt an ein Ei erinnert. Da stellt sich die Frage: Versteht sie, was sie da macht?
Was ist mit der Motte, die ständig gegen das Fenster fliegt, angelockt durch das Licht auf der anderen Seite? Der Lichtreiz als angeborenes Verhalten bildete sich über Jahrmillionen heraus. Durchsichtiges Glas gibt es erst seit etwa 1000 Jahren. Daher hat sich in der Motte noch kein Programm entwickelt, um solche Irrtümer zu vermeiden.
Hat ein Käfer Verstand? Hat die Evolution, die so viele verschiedene Käferarten hervorbrachte, völlig dabei versagt, ihre Entscheidungsfähigkeit, ihr Denken und ihre Emotionen zu schärfen? Oder ist ein Käfer nur ein Roboter, dessen DNS-Chips ihm jegliches Potenzial für Originalität, Spontaneität oder Improvisation rauben? Sind auch wir so?
In jedem dieser Fälle scheint die DNS-Codierung das Handeln der Tiere zu steuern. So gesehen könnte man die Annahme bejahen, dass Bienen, Käfer und sogar Gänse Maschinen ohne Verstand sind. Doch was ist mit uns, dem Tier Homo sapiens?
Das ist die Art von Frage, über die ein junger französischer Soldat an einem frostigen Abend im November 1619 grübelte, als er die Nacht in einem überheizten Zimmer in Bayern verbrachte. Er ging ins Bett, löschte das Licht – und konnte nicht schlafen. Gedanken quälten ihn und ließen ihn nicht los. Jahre später behauptete er, der Heilige Geist sei in ihn gefahren und hätte ihm eine neue Art des Denkens offenbart. Als er sie begriffen hatte, suchte er Wege, sie mit anderen zu teilen.
Der junge Mann war René Descartes. »Cogito ergo sum« – »Ich denke, also bin ich«, ist seine bekannteste Aussage. Die Idee, die ihn in dieser Nacht überkam, wurde für die moderne Zivilisation maßgebend. Seine Aufgabe sei, so Descartes, die Philosophie mit der Wissenschaft zu vereinen. Um zu wissen, was real ist, muss man eine Idee durch die exakten Techniken der Wissenschaft überprüfen und eine mathematisch auszudrückende Bestätigung suchen.
Der Kern von Descartes’ Ideen ist ein Merkmal der modernen Welt: Zweifel. Wie radikal muss seine Idee im frühen 17. Jahrhundert gewirkt haben! Galileo war wegen seiner mathematisch verifizierbaren Beobachtung, dass sich die Erde um die Sonne dreht, gerade verurteilt und eingesperrt worden! Seit 1000 Jahren kontrollierte die Kirche erfolgreich den öffentlichen Diskurs. Es gab keine Debatte über die wörtliche Auslegung des Alten und Neuen Testaments. Der Glaube stand nicht infrage; für Zweifel gab es keinen Raum. Doch Descartes sah im Zweifel den Ausgangspunkt für Wissen.
Descartes war kein Atheist – zumindest nicht öffentlich. Er bestätigte wiederholt die Existenz Gottes und glaubte, dass nur Menschen unsterbliche Seelen haben. In Bienen, Motten und Käfern sah er nur kleine Maschinen. Uhren waren zu dieser Zeit noch etwas Besonderes – der neueste Stand der Technik. Für Descartes waren Insekten und andere Wesen so elegant und effizient wie ein Uhrwerk, ein seelenloser Mechanismus.
Heute verschieben wir mit Descartes’ Prinzip des Zweifels die Grenzen immer weiter. Machen wir einen Schritt vorwärts und fragen, ob andere Tiere denken. Treffen sie Entscheidungen? Was würden sie sagen? Die Gänsemutter rollt irrtümlich einen Ball in das Nest zu den Eiern, aber sobald die Küken schlüpfen, zeigt sie eine einzigartige Verbundenheit mit ihnen. Ihr Geruch, der Klang ihres Piepsens, ihr Aussehen – nur diese Kombination von Eigenschaften weckt ihr mütterliches Interesse. Sie würde sie nie mit einem Ball oder gar mit anderen Küken verwechseln – welche Intelligenz! Wir hingegen, die wir uns selbst sapiens, »weise«, nennen, tun uns schwer, zwei Bruten von Küken auseinanderzuhalten.
Zurück zum Käfer, einer kleinen Kreatur mit einem ganzen Repertoire an Fähigkeiten. Er besitzt die komplette Palette an sensorischen und reproduktiven Fähigkeiten. Er kann laufen, fliegen und reagiert auf seine Umgebung: Wenn man auf ihn zugeht, richtet er sich auf oder flieht. So winzig er auch ist, er besitzt doch Fähigkeiten und spezialisierte Organe, um all das zu vollbringen.
Wenn man über Bewusstsein bei Insekten spricht, werden viele Wissenschaftler nervös. Dafür gibt es einen guten Grund: unsere Neigung, andere Arten zu vermenschlichen. Aber vielleicht haben wir das überkompensiert. Mein Gefühl ist, dass die Grenze zwischen Roboterprogrammierung und dem Bewusstsein eines Käfers weniger scharf scheint, als wir glauben. Der Käfer entscheidet, wann er Nahrung zu sich nimmt, vor wem er wegläuft, wen er sexuell attraktiv findet. Spricht das nicht für ein gewisses Bewusstsein in seinem winzigen Gehirn?
Die Bedeutung der Frage reicht weit über das Schicksal dieses Käfers hinaus. Wenn er nach sorgfältiger Abwägung noch immer roboterähnlich wirkt, weil seine Überlebensfunktionen durch DNS programmiert sind, wie sicher können wir dann sein, dass das nicht auch auf uns zutrifft? Und wenn wir bereit sind, die Handlungen von Menschen als von der DNS bestimmt zu sehen, als in unserer Natur angelegt, wo bleibt dann der freie Wille? Wie können wir dann von Gut und Böse sprechen? Geht es uns dann besser als den Zoroastriern, die glaubten, dass mit Ahura Mazda und Ahriman unkontrollierbare Kräfte ihr Verhalten bestimmen? Gibt es dennoch Hoffnung, dass wir unser Handeln und Schicksal selbst gestalten können – nicht durch Gene, sondern durch unsere Ideale gesteuert?
EINE GESCHICHTE GIBT MIR HOFFNUNG. Es ist die Sage vom Menschen, der sich extrem gegensätzlich verhielt. Was davon wahr ist, ist schwer zu beurteilen. Die Wirren eines Religionskriegs trüben den Blick auf sein Leben und verdunkeln die Wahrheit. Generationen versuchten, die Lebensgeschichte dieses Mannes und alles, was er schrieb und baute, aus der Geschichte zu tilgen. Trotzdem erinnert man sich noch an ihn. Was sind aber Geschichte oder Mythos, wenn Träume Karten sind?
Etwa 200 Jahre nach Zarathustra, im 4. Jahrhundert v. Chr., kam ein junger Mann aus der tiefsten Provinz, aus Mazedonien und errichtete in weniger als einem Jahrzehnt ein Reich, das sich von der Adria bis über den Indus hinaus nach Indien erstreckte. Auf seinem Weg zerschlug Alexander der Große die angeblich unbesiegbare Armee der Perser. Die Unterwerfung des Reiches der Achämeniden, des größten, das es jemals gab, weckte den Appetit auf weitere Eroberungen: Indien lockte.
Nachdem er das heutige Pakistan und ein Stück vom Nordwestens des Subkontinents erobert hatte, rebellierten 324 v. Chr. seine Männer. Ihr Hunger auf ein Reich war nicht so groß wie der Alexanders, zudem hatten sie Heimweh. Daher packten sie ihre Sachen und gingen. Nach ihrem Abzug beschloss der Hindu-Krieger Chandragupta, sich selbst an einer Reichsgründung zu versuchen. In nur drei Jahren schuf er das Maurya-Reich, das schließlich den größten Teil des nördlichen Indien und das heutige Pakistan umfasste.
Seleukos I. Nikator, ein Gefolgsmann Alexanders, meinte, er könnte dort Erfolg haben, wo sein zwischenzeitlich verstorbener Befehlshaber gescheitert war. Er überquerte mit einer Armee den Indus und griff Chandragupta an. Aber der Feldzug war ein Desaster. Seleukos erkannte bald, dass eine Ehe, die Chandraguptas Familie mit seiner verbinden würde, weitaus vernünftiger war. Die Allianz wurde mit der Schenkung Hunderter von Elefanten und allerlei Aphrodisiaka gefestigt und legte den Grundstein für einen dauerhaften Austausch zwischen Indien und Griechenland.
Chandragupta erwies sich als exzellenter Verwalter. Er ließ große Bewässerungsanlagen und moderne, mit Metall armierte feste Straßen bauen, die sein Reich für Handel und Truppen erschlossen. Auf Chandragupta folgte sein Sohn Bindusara, dessen Herrschaft aber nur eine Übergangszeit zwischen zwei Giganten darstellte.
Einigen Berichten zufolge hatte Bindusaras Sohn, der um 304 v. Chr. geborene Ashoka, durch eine Krankheit in seiner Kindheit eine pockennarbige Haut. Bindusara sei davon abgestoßen gewesen und habe ihn vom Hof verbannt. Vielleicht dient diese Geschichte aber nur zur psychologischen Erklärung für die späteren monströsen Verbrechen Ashokas.
Als Bindusara starb, brach unter den Söhnen seiner vielen Frauen der Kampf um den Thron aus. Um ihn zu erlangen, ermordete Ashoka, je nach Quelle, zwischen einem und 99 seiner Brüder. Wenn wir zugunsten Ashokas annehmen, dass er nur einen Brudermord beging, so war dieser doch von ungeheurer Grausamkeit: Ashoka stieß seinen Bruder in eine lodernde Feuerstelle.
Dies wird zum Markenzeichen der Herrschaft Ashokas: Es reicht nicht aus, den Feind zu vernichten, er muss dabei auch unvorstellbare Qualen erleiden. Es beginnt damit, dass Ashoka in das Zimmer seines sterbenden Vaters stürmt. Bindusara will einen anderen Nachfolger, vermutlich den Sohn, den Ashoka in den Feuertod stößt. Der verhasste Sohn steht vor dem sterbenden Vater, trägt die Insignien des Herrschers und erklärt verächtlich: »Jetzt bin ich der Herrscher!« Laut einigen Berichten wird Bindusara rot vor Zorn, sinkt auf sein Kissen zurück und stirbt. Stellen wir uns vor, wie Ashoka es genießt, den Vater in den letzten Augenblicken unglücklich zu machen. Dass er ein herzloser junger Herrscher ist, da sind sich alle Legenden und selbst die Historiker einig.
Nach einigen Jahren sind alle anderen Thronanwärter tot. Seltsamerweise richtet sich Ashokas Wut nun gegen die vielen Obstbäume, die den Palast umgeben. Er befiehlt, sie alle zu fällen. Als sich die Minister dagegen sträuben und auf weitere Beratung drängen, bekommt Ashoka einen seiner berühmten Wutanfälle. »Gut!«, brüllt er die verängstigten Minister an, »lasst uns stattdessen eure Köpfe abschneiden.« Die Wächter zerren sie zur Enthauptung hinaus. Doch das ist erst der Anfang.
Ashoka lässt sich einen noch prächtigeren Palast mit fünf riesigen Flügeln bauen. Als dieser fertig ist, lädt er die prominentesten Bürger seines Reiches ein. Zum Imperium gehört nun, außer der Südspitze und zwei kleinen Flecken an der Ostküste, der gesamte Subkontinent. Das Entzücken und die Erregung über die eigene Wichtigkeit, die die Eingeladenen überkommt, sind kaum vorstellbar. Welche Ehrfurcht muss sie bei der Pracht des neuen Palastes ergreifen, welch ein Privileg, zu den ersten Besuchern zu gehören.
Dieses tibetisch-buddhistische Gemälde zeigt Ashoka nach seiner Bekehrung. Seine Gesten und Kleidung sind vom Buddha beeinflusst. Da er so viel Hass auslöste, wurden in Indien alle zeitgenössischen Darstellungen von Ashoka zerstört.
Im großen zentralen Lichthof wird jeder Gast von einem Gastgeber begrüßt, der ihn in einen der fünf Flügel führt. Erst als keine Aussicht auf Entkommen mehr besteht, erfahren die Geladenen, dass jeder Flügel einer der – aus Ashokas Sicht – fünf qualvollsten Todesarten geweiht ist. Als sich das mit der Zeit herumspricht, erhält der Palast den Namen Ashokas Hölle. Ashoka beseitigt so alle potenziellen Rivalen und hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck im Volk. Seine Bosheit kennt keine Grenzen.
Nur das Volk von Kalinga weiß davon nichts. Die blühende Region an der Nordostküste Indiens hat keinen König. Sie ist ein offenes, kulturelles Zentrum und vermutlich gleicht sie vor dem Hintergrund ihrer Zeit am ehesten einer demokratischen Gesellschaft. Kalinga hat einen freien Handelshafen. An einer Unterjochung durch einen despotischen Sadisten besteht kein Bedarf.
Bis jetzt entging Kalinga einer Einverleibung in Ashokas Reich. Doch im achten Jahr seiner Herrschaft macht Ashoka Ernst. Die Angegriffenen wissen, dass man mit einem Verrückten keinen Frieden schließen kann. Der mutige Widerstand reizt Ashoka zu abscheulichsten Gräueltaten.
Ashoka belagert Kalinga mit seiner Armee ein Jahr lang, bevor es ihm gelingt, die Wälle der ausgehungerten und geschwächten Stadt zu stürmen. Es folgt ein brutaler Kampf Mann gegen Mann. Ashokas Männer stecken die Häuser in Brand, ermorden Wehrlose und verüben jede erdenkliche Art von Barbarei. Am Ende sind 100 000 Bürger und Soldaten tot. 150 000 überlebende Kalinga werden deportiert, um eine geschlossene, nach Unabhängigkeit strebende Gruppe in Ashokas Reich zu vermeiden.
Nun genießt Ashoka seinen Triumph: Gemächlich spaziert er über das Schlachtfeld, auf dem so viele Leichen liegen, dass er und seine Wachen kaum einen Fuß vor den anderen setzen können. Tote, so weit das Auge reicht.
Aus der Ferne kommt eine zerlumpte Gestalt auf den Sieger zu. Angespannt greifen Ashokas Generäle nach ihren Schwertern. Als der Fremde sich nähert, sehen sie, dass er etwas Kleines in seinen Armen hält. Der Mann scheint seltsam furchtlos zu sein, nicht im Geringsten eingeschüchtert vom Despoten. Die Wachen halten sich bereit, um den Mann zu töten, aber Ashoka befiehlt ihnen, innezuhalten. Der Mut des Mannes erregt seine Neugier, und der Gewaltherrscher weiß, dass von diesem dürren Bettler keine Bedrohung ausgeht. Als dieser vor ihm steht, zeigt er Ashoka, was er in seinen Armen trägt – den leblosen Körper eines Babys, ein Opfer von Ashokas Triumph. Der Bettler hebt das tote Kind dicht vor Ashoka, sieht dem Mörder direkt in die Augen und sagt: »O König, du, der du so mächtig bist, kannst nach Belieben Hunderttausenden das Leben nehmen. Zeig mir, wie mächtig du wirklich bist – gib nur ein Leben zurück, diesem toten Kind.« Ashoka schaut auf die winzige Leiche und die ganze Freude über seinen Sieg ist wie weggeblasen. Der Rausch der Macht, die wie eine Droge für ihn ist, verflüchtigt sich.
Wer war dieser Bettler, der es wagte, Ashoka mit seinen Verbrechen zu konfrontieren? Wir wissen nur, dass er ein Anhänger des Buddha war, eines damals kaum bekannten Philosophen, der 200 Jahre zuvor gelebt hatte. Der Buddha predigte Gewaltlosigkeit, Bewusstheit und Erbarmen. Seine Anhänger verzichten auf Besitz, ziehen umher und verbreiten die Lehren des Buddha durch ihr Beispiel. Der Bettler auf dem Schlachtfeld soll einer von ihnen gewesen sein. Mit seinem Mut und seiner Weisheit dringt er zum Herzen dieses herzlosen Mannes vor.
Ashoka starrt auf das Leichenfeld, Abscheu und Reue erfassen ihn. Am Ort seines brutalsten Verbrechens lässt er eine Säule errichten, eine von vielen, an deren Spitze vier Löwen in die vier Himmelsrichtungen blicken. In Brahmi-Schrift ist eines der ersten Edikte Ashokas eingraviert: »Alle sind meine Kinder. Ich wünsche mir für meine Kinder Wohlergehen und Glück, und das wünsche ich mir für alle.«
Um seine revolutionären Ideen in seinem Riesenreich zu verbreiten, ließ Ashoka seine Lehren in Steine und Säulen meißeln. Etwa 150 davon wurden gefunden, wie dieses Stück mit einem Edikt, das in der wichtigen altindischen Schrift Brahmi geschrieben ist.
In seinem 13. Edikt schreibt er über sein schlechtes Gewissen: »Direkt nach der Annexion Kalingas begann Seiner Heiligen Majestät eifriger Schutz des Gesetzes der Frömmigkeit, seine Liebe zu diesem Gesetz und der Verankerung des Gesetzes. Daher wuchs die Reue Seiner Heiligen Majestät über die Eroberung der Kalinga, da die Eroberung eines Landes Gemetzel, Tod und Verschleppung der Menschen mit sich bringt. Das ist für Seine Heilige Majestät Grund für tiefste Reue und Bedauern.«
Aber Ashoka erfüllt nicht nur Reue für seine vielen Verbrechen. Ein neuer Anführer kommt zum Vorschein, einer, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.
Ashoka schließt Friedensverträge mit den kleinen Nachbarländern, die er zuvor bedroht hatte. Er regiert Indien weitere 30 Jahre und nutzt diese Zeit, um Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und sogar Hospize zu bauen. Er führt die Bildung für Frauen ein und öffnet das Mönchswesen für sie. Es gibt eine kostenlose Gesundheitsfürsorge mit Arzneien für alle. Ashoka lässt für Dörfer und Städte Brunnen graben, Bäume pflanzen und entlang den Straßen Unterstände bauen, damit die Reisenden Schutz finden und Tiere Schatten bekommen. Er ordnet die Gleichbehandlung aller Religionen an, außerdem, die Urteile von zu Unrecht Eingesperrten oder streng Bestraften zu überprüfen. Er schafft die Todesstrafe ab.
Ashokas Empathie umfasst bald alles Lebendige. Er verbietet Rituale mit Tieropfern und jeglichen Jagdsport. Er gründet in ganz Indien Tierkliniken und rät seinen Untertanen, Tiere respektvoll zu behandeln. Ashoka verletzt damit nicht das Gesetz der Verwandtenselektion der Evolutionsstrategie, wonach wir vor allem um das Überleben derjenigen besorgt sein sollen, mit denen wir die meisten unserer Gene teilen. Er bezieht in die Definition, wer mit ihm verwandt ist, einfach alles ein.
Und Ashoka hat noch eine Idee, die ihrer Zeit 1000 Jahre voraus ist. Ashoka ist nicht der Meinung, dass der Sohn des Königs unbedingt auch König werden muss. Er glaubt, dass die Nation durch die erleuchtetste Person regiert werden sollte, nicht vom Thronfolger.
Das alles heißt nicht, dass er in seinem Leben nie mehr gewalttätig oder grausam ist. Berichten zufolge kam es gegen Ende seiner 36-jährigen Herrschaft wieder zu Gemetzeln und mörderischen Wutanfällen, wie schon in seiner Jugend. Aber die Belege deuten darauf hin, dass er seine wegweisende aufklärerische Herrschaft weiterführt.
Auf den Säulen mit den Edikten Ashokas befanden sich oft vier Löwen, die auf einem Rad mit 24 Speichen standen. Dieses buddhistische Symbol ziert auch das Zentrum der Flagge des unabhängigen Indien.
Lomas Rishi ist eine von vier heiligen Höhlen in den Granithügeln des nordöstlichen Indien. Der elegante Eingang führt in eine schlichte Höhle mit bemerkenswerter Akustik. Ashoka besuchte sie im 3. Jahrhundert v. Chr.
NACHDEM ASHOKA IN HOHEM ALTER GESTORBEN WAR, bestand die Maurya-Dynastie nur noch für 50 Jahre. Die Tempel und Paläste aus seiner Herrschaftszeit und die meisten Säulen, die er errichten ließ, wurden von religiösen Fanatikern der folgenden Generationen zerstört, da sie ihn für gottlos hielten. Für sie gehörte eine Beibehaltung der herrschenden Hierarchie zur Religion. Doch trotz aller Bemühungen seiner Kritiker lebt sein Vermächtnis dank der Wiederentdeckung der Edikte im 18. und 19. Jahrhundert weiter. Als im 20. Jahrhundert das moderne Indien gegründet wurde, wählte es Ashokas Löwen als Staatswappen.
Dass der Buddhismus zu einer der einflussreichsten religiösen Philosophien aufstieg, wird Ashoka zugeschrieben. Einige Jahrhunderte vor der Geburt Jesu wurden Ashokas Edikte in der Sprache Jesu, Aramäisch, und anderen Sprachen in Stein gehauen, um Mitleid, Barmherzigkeit, Demut und Friedensliebe zu lehren. Wir wissen, dass seine Abgesandten nach Alexandria und in andere Städte im Nahen Osten reisten und so womöglich seinen Einfluss noch vergrößerten.
Die Lomas-Rishi-Höhle in den Barabarhügeln in Indien ist einer der wenigen Tempel Ashokas, die noch existieren. Der Tempel ist überraschend schlicht, nur einige Inschriften sind zu finden. Das Besondere an ihm sind die außergewöhnliche Resonanz und das lang nachhallende Echo. Die Schallwellen prallen an den polierten Wänden ab und verklingen dann langsam, bis die Wände sie völlig absorbiert haben – und kein Ton mehr übrig ist. Stille.
Doch Ashokas Traum scheint mir das Gegenteil davon zu sein. Sein Echo wird mit der Zeit immer lauter.