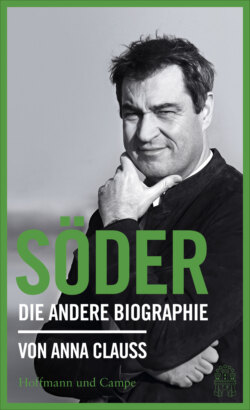Читать книгу Söder - Anna Clauß - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zuckerwasser und Peitsche
ОглавлениеHelmut Schmidt rauchte Kette. Helmut Kohl hatte eine Schwäche für Pfälzer Saumagen, Kirschsahnetorte und, wie Willy Brandt, diverse Geliebte. Angela Merkel hält nach Sitzungen zu später Stunde gerne ein Glas Rotwein in der Hand. Würde der bayerische Ministerpräsident dereinst Kanzler, bekäme das Land ein Staatsoberhaupt mit ungewöhnlichem Laster: Söder trinkt Cola zum Frühstück.
Den restlichen Tag auch. Das amerikanische Zuckerwasser ist Söders Treibstoff. Egal ob der Ministerpräsident bei einer Podiumsdiskussion in einem historischen Kino, auf einer Pressekonferenz oder bei einem Hintergrundgespräch Rede und Antwort steht, an seinem Platz wartet immer ein Glas Cola neben dem Mikrophon.
Markus Söder verfügt dank oder trotz der aufputschenden Wirkung seines Lieblingsgetränks über eine körperliche Konstitution, die nicht jedem Politiker in die Wiege gelegt ist. Er braucht kaum Schlaf, absolviert Termine am laufenden Band, verfolgt parallel pausenlos die Nachrichtenlage auf seinem Handy.
Jeden Tag um 5.30 Uhr klingelt sein Wecker, »spätestens«, wie er betont. Die Tageszeitungen hat er schon am Vorabend digital gelesen, er macht dann meist Rückenübungen und Gymnastik zur Stärkung der Muskulatur. Um 7 Uhr, »spätestens«, verlasse er das Haus. Um 7.15 Uhr, »manchmal auch um 7.20 Uhr«, sei er im Büro. »Ab 6 Uhr bin ich SMS-fähig, und ab 7 Uhr muss man mit meinem Anruf rechnen.« Der Landwirt in der Regierung, Finanzminister Albert Füracker, und Florian Herrmann, der Leiter der Staatskanzlei, seien dann schon ansprechbar, bemerkt Söder hochachtungsvoll. Es gäbe auch andere, die brauche man um diese Uhrzeit noch nicht zu kontaktieren.
Nach 22 Uhr führe er keine Telefonate mehr, erst recht keine »schwermütigen Gespräche mit Gläschen in der Hand. Ich trinke keinen Alkohol«. So etwas gäbe es bei ihm nicht. Dass der Bierautomat beim Bayerischen Rundfunk, wo Söder einst sein Volontariat gemacht hat, bereits um zehn Uhr morgens leer war, sei ihm ein abschreckendes Beispiel gewesen. Manchmal im Urlaub, am Meer vielleicht, genehmige er sich zum Essen ein Glas Weißwein, »aber nur zum Nippen. Am Ende bleibt es doch immer bei einer Cola light«.
Bayern, glaubt Söder, habe sich in den letzten Jahren »sehr verändert«. Man achte heutzutage mehr auf die Work-Life-Balance, vielen sei es wichtig, körperlich gesund und fit zu bleiben. Dass keiner seiner Minister in der Öffentlichkeit oder auf Empfängen Bier trinkt und selbst bei der 75-Jahr-Jubiläumsfeier der CSU im September 2020 alkoholfreier Sekt ausgeschenkt wurde, hält Söder für völlig normal. Er mache da keine Vorgaben. Aber: »Von einem Minister erwarte ich natürlich ein Mindestmaß an Selbstkontrolle«, sagt Söder. Das hat sich rumgesprochen.
Wer sich als Journalist mit einem Mitglied der Staatsregierung zum Hintergrundgespräch in einer Wirtschaft verabredet, muss sein Helles allein trinken. Wenn das Interview um kurz vor Mitternacht beendet ist, kann es sein, dass der Minister sich im Anschluss noch ins Büro chauffieren lässt, es gäbe so viel zu tun.
Markus Söder macht auch gerne mit seinen Untergebenen Sport. Mit Michael Frieser duelliert er sich gelegentlich auf dem Tennisplatz, mit Florian Hahn spielt er Badminton, mit Dorothee Bär, Albert Füracker und Florian Herrmann unternimmt er am Wochenende Radtouren, und sein Pressesprecher Wolfgang Wittl hat ihn zum Tischtennis herausgefordert. »Früher hätte man gesagt, lass uns essen gehen«, sagt Söder. Das sei passé. Er glaubt, »dass körperliche Fitness die Voraussetzung für geistige Konzentration« sei. Und die ist Söder wichtig.
Kaum ein Tag verging in der Coronapandemie, an dem Söder nicht in den Abendnachrichten auftauchte, in einer Talkshow saß oder eine digitale Pressekonferenz gab. Gleichzeitig veröffentlichte er Durchhalteparolen, Appelle zu mehr »Vorsicht und Umsicht« oder Videobotschaften an seine Follower in den sozialen Netzwerken. Die Reaktionen in der Anfangszeit der Pandemiebekämpfung grenzten an Heldenverehrung. »Gratuliere dem Land Bayern zu so einem tollen Menschen«, schreibt einer auf Facebook. Umsichtig, durch- setzungsfähig, klar und verständlich, kompetent, eloquent, informativ, vorausschauend, fähig, souverän, ent- schlossen – in den Kommentaren unter seinen Posts gab es kaum ein positives Attribut, das dem Politiker Söder nicht zugeschrieben wurde.
»Sie sind der wahre Bundeskanzler«, schrieb einer auf Facebook. Und: »Der beste Politiker, den Deutschland hat« hieß es dort nicht nur vereinzelt. »Sie haben meinen größten Respekt!«, meinte einer aus Brandenburg. »Ich wünsche, Ihre Kollegen der übrigen Bundesländer würden Ihrem Beispiel folgen«, kommentierte eine Saarländerin.
Die Krise katapultierte Markus Söder auf Augenhöhe mit Angela Merkel. Der Bayer und die Kanzlerin waren in den Pressekonferenzen zur Pandemiebekämpfung meist die dominierenden Figuren. Viel Respekt brachte der Diplomphysikerin Merkel ihre aus dem Ärmel geschüttelte, wissenschaftlich korrekte Erklärung des R-Wertes ein. Söders Botschaften klangen einfacher, martialischer, aber auch wesentlich einprägsamer. »Wer gläubig ist, soll beten, dass es Deutschland nicht zu hart trifft.« Und: »Das ist ein Stresstest für unser Gesundheitssystem.« Oder: »Corona ist wie ein Funke, der jederzeit ein Buschfeuer entzünden kann.« Dass Merkel die Kanzlerin ist und nicht Söder der Kanzler, merkte man vor allem daran, dass sie zuerst sprach. Während ihre Sätze phrasenhaft und zuweilen müde wirkten, war Söder Herr der Lage.
Es war pures Glück, dass Markus Söder neben der Kanzlerin die neuen Maßnahmen verkünden durfte. Zufällig hatte Bayern den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz turnusgemäß bis Ende September 2020 inne. Und Söder machte etwas daraus. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sprach als stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ebenfalls auf jeder Corona-Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Wie viele Auftritte von ihm haben sich ins kollektive Gedächtnis des Landes eingegraben?
»Krisenzeiten sind Söder-Zeiten«, sagt Söders ehemaliger Berater Michael Backhaus. Der langjährige Hauptstadtjournalist, der unter anderem beim Stern als Leiter der Bonner Parlamentsredaktion und in der Chefredaktion der Bild am Sonntag in Berlin gearbeitet hat, leitete Söders Kommunikationsabteilung im Finanz- und Heimatministerium. Die zahlreichen innerparteilichen Gegner, so erinnert sich Backhaus, hätten stets gehofft, Söder werde sich bei der Bewältigung schwerer Krisen als politisches Leichtgewicht entpuppen. Zum Beispiel, als Horst Seehofer ihn nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 mit der Koordination der Fluthilfemaßnahmen beauftragte. Oder als er Söder 2008 die Rettung der Bayerischen Landesbank infolge der Finanzkrise überließ. Statt zu scheitern, erledigte Söder beide Aufgaben mit Bravour. »In Wahrheit waren das seine Gesellenstücke«, sagt Backhaus. Der Unterschied von heute zu damals ist, dass die Menschen außerhalb Bayerns davon Notiz nehmen.
Söder erzählt gerne, wie er sich zu Beginn der Pandemie gleich nach dem Aufstehen die aktuellen Infektionszahlen des Robert Koch-Instituts habe durchfunken lassen und sich dabei gefühlt habe, wie ein Feldherr im Krieg, der bangen Mutes die Gefallenen zählt. Bei seinen Liveschalten in die Abendnachrichten war im Hintergrund häufig das Münchner Siegestor eingeblendet, darauf gut leserlich die Inschrift »Dem Bayerischen Heere«. Es wirkte, als müsse Söder mit seinen Truppen einem unsichtbaren Gegner die Stirn bieten.
Dass seine Krisenrhetorik und seine zuweilen monumentalen Auftritte zu Beginn der Pandemie nicht abschreckend oder übertrieben wirkten, lag daran, dass er zum ersten Mal eine Rolle verkörperte, die er sich nicht mühsam antrainieren musste. Er war vollkommen authentisch als Imperator, der nicht mehr die Bienen retten musste, sondern die Menschheit vor einer Pandemie. Mit der Ausbreitung des Virus änderte sich der Zeitgeist in Deutschland. Er wurde kälter, erbarmungsloser, autoritätsgläubiger. Zu Markus Söders Gunsten.
Dass er trotz aller Inszenierungslust Glaubwürdigkeit ausstrahlte, könnte auch mit Söders persönlicher Virusangst zusammenhängen. Seine Warnungen vor Leichtsinn und Unachtsamkeit waren nie gespielt. Vor zwei Dingen fürchte sich der Ministerpräsident, sagt einer aus dem CSU-Parteivorstand, der Söder lange kennt: »Krankheit und Kontrollverlust.«
Mitarbeiter, die hustend zur Arbeit erscheinen, schicke der Chef umgehend nach Hause – schon vor Ausbruch der Pandemie. Söders Pressesprecherin, die ihn seit über zehn Jahren auf Schritt und Tritt begleitet, trägt in ihrer Tasche schon immer Handdesinfektionsmittel für den Chef von Termin zu Termin. Neu sind nur die medizinischen Mundschutzmasken, die Söders Bodyguards stets griffbereit haben – sollte sich zum Beispiel ein Bürger unter freiem Himmel oder an einem Ort ohne Maskenpflicht dem Ministerpräsidenten nähern und ihn um ein Selfie bitten.
Söder hat sich für diesen Fall eine clevere Choreographie ausgedacht. Bürger oder Bürgerinnen mit Fotowunsch sollen sich nicht neben, sondern mehrere Meter vor den Ministerpräsidenten stellen und ihren Selfie-Arm ausfahren. Der Kopf des Souvenirjägers ist dann zwar etwas größer im Bild als der des ebenfalls Abgelichteten. Aber da die meisten Menschen ohnehin kleiner sind als der Zweimetermann Söder, wirken die hintereinander positionierten Personen auf dem Selfie annähernd gleich groß. Und nah, obwohl der empfohlene Corona-Mindestabstand von 1,50 Metern locker doppelt oder dreifach gewahrt ist.
Dass die Themen Krankheit und Tod den Ministerpräsidenten stark umtreiben, hängt mit seinen früh verstorbenen Eltern zusammen. Renate Söder war Dialysepatientin und verstarb 1994 mit nur 56 Jahren. Ihr Sohn Markus wurde im Januar 2020 54 Jahre alt. Die Geschichte vom plötzlichen Tod der Mutter drei Wochen vor seinem Einzug in den Bayerischen Landtag erzählte Söder in einer Rede auf dem CSU-Parteitag im Dezember 2017. Es war der Tag seiner Nominierung zu Horst Seehofers Nachfolger als Ministerpräsident.
»Ich dachte, die Welt gehört den Mutigen«, sprach Söder, »aber als von einem Tag auf den anderen meine Mutter verstarb, war plötzlich alles anders.« In ihrem leeren Krankenhauszimmer stand am Tag ihres Todes nur noch eine kleine Tasche. Eingerollt daneben die Wahlkampfplakate des Sohnes. Renate Söder hatte damit stolz ihr Krankenhauszimmer dekoriert.
Das Bild des verlassenen Sterbezimmers seiner Mutter muss sich Markus Söder stark eingeprägt haben. »Es gibt Dinge im Leben, die kannst du nicht ändern«, weiß er seitdem. Manche Menschen macht diese Erkenntnis geduldiger. Söder hingegen scheint Ohnmacht zu ängstigen. Kontrolle ist ihm wichtig, erst recht, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Söders Personenschützer gehen neuerdings sogar neben ihm schwimmen, sollte sich der Ministerpräsident zum Frühsport ins Wasser wagen. Es könnte ja was passieren.
Sein Vater verstarb 2002 nach einem Herzanfall. Er lag im Koma, auf einer Palliativstation nahm die Familie Abschied. Söder ist dem Vater erst in dessen letzten Lebensjahren wirklich nahegekommen. Max Söder war gelernter Maurermeister, hatte ein kleines Unternehmen in Nürnberg. Als Junge wollte er Lateinlehrer werden. In der Lebenslotterie zog er aber ein anderes Los. 1930 geboren, musste Max nach dem Krieg auf dem Bau mithelfen. Mit enormem Fleiß und harter Arbeit, so erzählt es Söder, hat er es zu einem eigenen Geschäft gebracht. Dass man sich im Leben anstrengen müsse, dass man nichts geschenkt bekomme, »das habe ich von daheim verinnerlicht«, sagt Söder.
Fleiß und Einsatzbereitschaft erwartet Söder auch von seinen Mitarbeitern und Ministern. Wer täglich bereit ist, Höchstleistungen zu vollbringen, der hat seine Treue und Loyalität sicher. Ab sechs Uhr morgens traktiert er seine Mitarbeiter mit SMS und Arbeitsaufträgen. Wer ein »Gumo«, die Abkürzung für »Guten Morgen« erhält, kann annehmen, dass er in der Wertschätzung des Chefs am oberen Ende rangiert. Mit Lob oder Begrüßungsformeln hält sich der Ministerpräsident als höchster Einpeitscher von Beamten und Bürgern in der Regel nicht auf. Rekordverdächtige neun Pressesprecher und Pressesprecherinnen beschäftigt Söder in der Staatskanzlei – unter Horst Seehofer waren es halb so viele. »Ich kommuniziere, also bin ich.« Das scheint die Philosophie des bayerischen Ministerpräsidenten zu sein. Mit der er allerdings zu Beginn der zweiten Corona-Welle im Herbst 2020 zusehends an Grenzen stieß.
Als Mitte Oktober die Infektionszahlen plötzlich wieder nach oben zu schnellen begannen, stießen Söders Appelle zu mehr »Vorsicht und Umsicht«, seine Forderungen nach »weniger Alkohol und weniger Party« bei vielen Bürgern im Freistaat auf taube Ohren. Der Dauerwarnton nervte nur noch. Die Stimme des Ministerpräsidenten hatte sich in eine Art Tinnitus verwandelt, den man ignorieren musste, um ihn loszuwerden. In der bayerischen Grenzregion Berchtesgaden schossen die Corona-Kennzahlen derart in die Höhe, dass Markus Söder seine Gesundheitsministerin anwies, einen regionalen Lockdown zu verhängen. Den ersten in Deutschland zu dieser Zeit.
Söder wirkte nicht mehr wie der souveräne Krisenmanager, sondern wie ein selbstgerechter Deichgraf, der Kritikern Majestätsbeleidigung und seinem Volk kollektive Unvernunft unterstellte. Alkoholverbote, hohe Strafen für Maskenverweigerer, Sperrstunden für die Gastronomie, seine Drohung, dass Weihnachten »einsam« werden würde. Statt die Bürger zum Mitmachen zu motivieren, hielt Söder an seinen autoritären Erziehungsmethoden fest, mit denen er in der Anfangsphase der Pandemie Erfolge gefeiert hatte. Aber er merkte nicht, wie er das Gefühl für die Stimmung im Land allmählich verlor.
Als er auf einer der zahlreichen Corona-Pressekonferenzen verlautbarte, man könne ja »zum Beispiel zu Hause« mit der Partnerin tanzen, brachte er nicht nur Klubbetreiber gegen sich auf. Vor allem demonstrierte er erschreckende Empathielosigkeit. Dass es Menschen im Freistaat gibt, die keine Energie mehr, keine finanziellen Rücklagen, keine Urlaubstage mehr haben, um die Zumutungen eines erneuten Lockdowns auszuhalten, schien ihn wenig zu bekümmern. Dass nicht alle Menschen dafür gemacht sind, früh ins Bett zu gehen und zu Hause Cola light zu trinken, kam ihm offenbar ungeheuerlich vor.
In seiner Regierungserklärung zur Corona-Lage Ende Oktober gab es eine einzige Stelle, an der er emotional wurde: als es um ihn selbst ging. Söder las aus Drohbriefen von Corona-Leugnern vor. Während er minutenlang wüste, an ihn gerichtete Mordphantasien vortrug, wurde es im Plenum des Landtags ganz still.
Jetzt komme es auf die Gemeinschaft an, twitterte Söder eine Woche später. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte gerade beschlossen, Deutschland den ganzen November lang herunterzufahren. »Wir sind eine Solidargemeinschaft und kein Egoland«, wusste Söder plötzlich. Auch eine »große Parlamentsbeteiligung« zu den notwendigen und harten Corona-Maßnahmen kündigte er an. Offensichtlich hatte er gerade noch rechtzeitig bemerkt, dass er wie der übermütige Ikarus der Sonne gefährlich nahegekommen war.
In den Monaten zuvor hatte sich der Ministerpräsident jedenfalls wenig um parlamentarische Mitsprache gekümmert. Einmal erzählte er stolz, der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag Ludwig Hartmann hätte ihn per SMS um die Aufnahme von Covid-19-Patienten aus Italien gebeten, was er, Söder, umgehend umgesetzt hätte. Dabei vergaß er, dass sich Demokratie in der Regel im Parlament abspielt statt auf dem Handy. Wäre Söder Sonnenkönig im Freistaat, wäre das Smartphone sein Zepter. Und die Minister gut bezahlte Dienstboten.
Sein Kabinett tagt jeden Dienstag in der Münchner Staatskanzlei. Während der Coronapandemie allerdings nicht mehr im dafür vorgesehenen Ministerratssaal, sondern im Kuppelsaal des historischen Gebäudes, weil nur dort die Abstandsregeln einzuhalten sind. Der Fußboden ist mit rotem Marmor aus dem Tegernseer Tal, hellem Juramarmor aus dem Altmühltal und schwarzem Granit aus dem Bayerischen Wald ausgelegt. Es hallt wie in der Hölle. Die hundertfach amplifizierte Bestimmerstimme des Ministerpräsidenten scheint nicht aus seinem Körper zu kommen, sondern vom Himmel zu fallen. Je weniger reden, desto besser. Meistens redete Söder.
Selbst Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml, eine ausgebildete Ärztin, war nicht mehr als eine Statistin. Zu Beginn der Pandemie bekam sie bei Pressekonferenzen noch nicht mal ein eigenes Pult. Markus Söder verkündet in der Regel ohnehin alles Wichtige selbst. Die Minister zu seiner Linken und Rechten müssen minutenlang schweigen, bevor sie noch ein paar Details apportieren dürfen wie hechelnde Hunde den Stock des Herrchens.
Schon vor Ausbruch der Pandemie ließ er die Pressesprecher aller bayerischen Ministerien jeden Montagmorgen in die Staatskanzlei kommen und sich die Termine der Woche präsentieren. Die besten übernahm er selbst. Im Krisenmodus lief erst recht alles über seinen Schreibtisch.
In einer Videobotschaft zu Beginn der Coronakrise sagte Söder einmal: »Es kommen ganz spannende Zeiten auf uns zu«, bevor er sich, ganz Medienprofi, dann doch noch korrigierte: »schwierige Zeiten«.