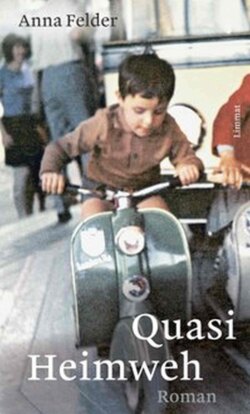Читать книгу Quasi Heimweh - Anna Felder - Страница 5
2
ОглавлениеDie Lehrerin so zu begleiten war in der Schweiz eigentlich nicht einmal üblich: Ich erinnere mich an meine schweizerischen Kolleginnen, ich weiß noch von Fräulein Wullschleger mit ihren übergenauen Bewegungen einer Kurzsichtigen, wie sie jedem einzelnen Schüler ganz ernst die Hand gab und ihnen half, die Windjacke zu schließen, den Daumen in den wollenen Handschuh zu stecken (die Mütter holten ihre Kinder nie von der Schule ab, auch in der Stadt war es da nicht Brauch); aber dann ging sie allein weg, mit ihrer prall gefüllten Mappe, ohne Kinder hinterdrein, und rannte ein wenig schwerfällig die Treppe hinunter. Ich fragte mich, ob ihr Mann oder ihr Freund ihr die Mappe getragen hätte; Fabio, dachte ich, hatte das nie getan: Es war ihm gewiss nie eingefallen.
Manchmal sagte ich zu meinen Schülern: «Heute kommt ihr nicht mit; heute nicht»; und sie, neugierig wie immer: «Warum nicht? Warum nicht heute? Peng peng.» Wenn sie das Auto erblickten, das unten auf mich wartete, jubelte es vielstimmig durcheinander: «Nimm uns auch mit, sag es ihnen doch, dass wir ein bisschen mitfahren dürfen!» Mein Bruder blieb dann jeweils im Auto sitzen, am Steuerrad, glücklich wie die Kinder, dass er Ginos Wagen fahren konnte. Gino dagegen stieg aus, und er war so groß und so mächtig, dass es eine ganze Weile brauchte, bis er draußen stand; aber dann begann er jedes Kind geduldig auszufragen, Namen und Vornamen, und ob ich lieb sei mit ihnen:
«Sag mal, stimmt’s, dass sie nie mit euch schimpft? Stimmt’s, dass sie gar nicht schimpfen kann?»
«Und du, kannst du denn schimpfen?»
«Huh!»
Sie lachten, wenn auch nicht sehr überzeugt, und hielten sich vorsichtig außer Reichweite; denn Gino sah wirklich wie ein Riesenkerl aus, mit schwarzen buschigen Brauen, die ganz von selbst, wenn es sie ankam, ein drohendes Huh hätten sagen können. Aber darunter verbargen sich zwei gutmütige kleine Augen, zwei Haselnüsschen, die einen unverwandt anschauten, auch wenn man es nicht merkte; man musste sie suchen, seine Augen, wie in einem Schatten, der im Dunkeln flüchtig vorüberstreift auf demselben Gehsteig: Wenn man sie entdeckt hat, ist es schon zu spät, und man trägt noch immer diesen Blick auf sich, der einen schon vorher anstarrte.
«Heute fahren wir nach Auenstein», sagte Gino.
«Zum Essen?»
Ich saß nämlich gern in solchen Landgasthäusern, im «Bären», im «Sternen»: mit den Doppelfenstern und den Kissenrollen auf dem niedrigen Sims schon im Herbst; man braucht nur daran zu denken, und schon möchte man ausrufen: «Wie kalt es ist, gehen wir doch hinein.» Drinnen stehen die klobigen Tische und Bänke, aus ungebeiztem Holz wie die runden Bretter, auf denen das Brot geschnitten wird (und bei dem einen ist vielleicht ringsum die erste Bitte des Vaterunsers eingekerbt); mit Holz sind auch die Wände verkleidet, und daran die Schaukästen mit den Bechern und Bildern des Turnvereins, alle in weißen Leibchen und dünnen Hosen, bei der Kälte, auch der Sohn der Wirtsleute. Aber hier drin ist es warm, man möchte dösen wie die andern, einige wenige schweigende Männer mit der an beiden Enden gestutzten Zigarre, dem Schweizer Stumpen, mitten im Mund, und mit der Wollmütze auf dem Kopf, die gar nicht neugierig sind, uns zu sehen, sie sitzen da und drehen uns den Rücken zu, die Ellbogen auf dem Tisch, und trinken langsam ihren Zweier Weißwein. Auf der Bank neben der Tür sitzt auch die Großmutter mit ihrer schönen Leinenschürze und strickt, und sie versucht nun von Zeit zu Zeit ein paar Worte zu sagen; denn sie befiehlt hier, mit siebzig, sie hat dicke Beine unter der Schürze, wie zwei kleine Fässchen, die sich fast nicht mehr rühren, sitzt auf der Bank und hält ihre Gäste alle brav beisammen, die auch morgen und übermorgen kommen werden, ihren Zweier zu trinken: Im «Sternen» ändert sich nichts, die Stunden gehen nicht vorbei, ein Tag ist Donnerstag, ein Tag ist Samstag, draußen friert es oder es taut, aber die Wirtsfrau sitzt da auf der Bank und hält die Becher fest und das Bild des Turnvereins, sie ist wie eine Glocke, die in einem fort dieselbe Stunde schlägt.
In Auenstein gab es keinen «Sternen», aber es gab den Fluss, der die Landschaft weit machte, hindehnte in ruhige Fernen; die Geräusche drangen nicht von Ufer zu Ufer, waren weggeglättet von einer Wasserfläche, die langsam ohne Laut vorbeiglitt, ohne Stimme, und auch den Himmel und den Schatten der Bäume in der Strömung mitzog.
«Ist das nicht der Po», hatte Gino zu uns gesagt, «ein Stück Po-Ebene?»
Denn Gino, Gino Berger, der Schweizer war, hier in der Gegend geboren und aufgewachsen, die wir erst kennenzulernen begannen, fühlte sich mit Italien durch viele Erinnerungen aus seiner Kindheit verbunden: italienische Erinnerungen, wie sein Vorname, aus der Zeit, als er die Ferien bei den Eltern seiner Mutter verbrachte, die aus der Lombardei stammte; Italien lebte noch in ihm aus der Ferne nach wie jene glücklichen Jahre, in denen er jeden Sommer zum Hätschelkind der Großeltern wurde, ihrem Stolz, weil er zwei Sprachen konnte; und so hatte er sich einen Winkel seiner Kindheit, den Fluss von damals hier an dieser Stelle der Aare erfunden, und er liebte es, mit uns zusammen Worte und Wendungen wachzurufen, die er als Kind zu Hause gelernt hatte und nun in jedem Klang mit einer ganzen versunkenen Welt wiederentdeckte.
Ich aber bekam in Auenstein nicht seine Po-Ebene zu sehen, es gelang mir nie: Das Stauwehr war da, das Bänkchen und der volle Abfallkorb; da war, an dem Abend, ein Fischer in kniehohen Stiefeln; und nachher, als die Dunkelheit auch das flache Hinfließen des Wassers, all die atmende Stille der Landschaft in sich ausgelöscht hatte, nachher war niemand mehr da und nichts, es war alles weg: keine Aare mehr, noch die Po-Ebene, mein Haus nicht, nicht Gino und nicht mein Bruder, nicht meine Uhr, die fünf oder zehn zeigte: keine Luft mehr, nur Nachtblau; nicht Bäume am Ufer, nur flüssige Schatten; Wasser und Strom waren Leere, die Welt dahin, ertrunken; schwarz.
Eine solche Landschaft erscheint uns vielleicht im Traum, ein Maler mag sie malen, aber wir können nicht im Auto hinfahren, um sie uns anzuschauen, und dann die Mandarinenschalen in den Abfallkorb werfen. Eine Landschaft ist echt oder nicht, sie ist wirklich oder geträumt, lebt in der Zeit oder in der Sehnsucht. Ich weiß noch: Der Garten, an den man zurückdenkt, und das Haus und Fabio, wenn man fort ist, sind nicht die echten: Sie selbst sind verschieden, gehen gradaus ihres Weges (auch der Garten, der weiterwächst), wir aber sehn sie bald so und bald anders, einmal groß, einmal klein, erinnern uns an ein Kleid oder eine Wand, aber das Ganze sehen wir doch nie recht, weil es sich ständig verändert, und je mehr wir uns darauf besinnen, je stärker bewegt es sich, wie wenn man hinter jemandem herrennt, der immer rascher läuft, und das Halstuch flattert ihm nach: Er dreht nach rechts, dreht nach links, man holt ihn ein, aber er hat schon wieder einen Vorsprung, man braucht nur das Halstuch zu sehen bei der Wegbiegung und rennt wieder los, und so ist es mit dem Verlangen, das uns nach Hause zieht und hier «Heimweh» heißt, man braucht nur einen Namen auszusprechen, braucht nur Fabio zu sagen und rennt, aber er ist nicht da.
Darum vielleicht hatte Gino diesen Ort nach einer Erinnerung so genannt: Denn man sah es ja, dass es in Auenstein nicht seine Po-Ebene gab, und doch hatte man Lust, sie hier zu suchen.
Seit jenem Abend sagten wir, wenn wir merkten, dass einer mit den Gedanken woanders war: «Was ist los, hast du wieder die Po-Ebene bekommen?»
Der Unterricht hörte um vier auf: Aber meine Schüler, alles Kinder italienischer Gastarbeiter, hätten mich auch zehnmal hin und zurück von der Schule zum Bahnhof begleitet, so viel Zeit hatten sie noch, bis die Eltern vielleicht spät am Abend von der Arbeit nach Hause kamen. Es waren sogenannte Schlüsselkinder, Kinder also, die den Hausschlüssel in der Tasche oder an einer Schnur um den Hals tragen, weil Vater und Mutter tagsüber fort sind.
In vielen Dörfern und Städtchen gab es zwar Kinderhorte, von Schwestern oder auch Privatleuten geleitete Heime, die eigens für die Freizeit der Schlüsselkinder eingerichtet worden waren; aber es war schwierig, solche Quecksilber nach der Schule beieinanderzuhalten: Sie trieben sich, unter dem Vorwand, mich ein Stück weit begleiten zu dürfen, lieber mit einem Fußball auf der Straße herum. Die Fabriken, die Bauplätze und Werkstätten schlossen Punkt fünf: Für die Kinder war es ein Fest, sich in den dichtesten Stoßverkehr zu stürzen, mit den Arbeitern auf den Fahrrädern um die Wette zu laufen: Ich musste mich daran gewöhnen und es mit ansehen, wie sie mir mitten im Lärm davongewirbelt wurden, heil und unschuldsvoll von einem Gehsteig zum andern, und dabei noch Muße fanden, die VW und Fiat zu zählen (siebenundzwanzig Seicento, sagten sie mir dann); ich hielt die Allergetreuesten fest, die sich an den Griff meiner Mappe klammerten.
So viele Rad fahrende Italiener wie in diesen Gegenden der deutschen Schweiz hatte ich noch nie gesehen: fast alle abends mit einem Bündelchen auf dem Gepäckträger oder mit einem Korb vor der Lenkstange, einer Art Salatkorb: Schaute man genauer hin, so erkannte man die Zipfelmütze und die Wollschärpe ihres Kindes, das schon ganz weich und schwer vor Schlaf eben aus der Krippe kam wie aus einem warmen Backofen.
Die Straße, die in Aarau zum Kinderhort führte, schien eine Versammlung von Liebespaaren; es waren die Väter, die unter den Laternen warteten und ihren an die Gartenmauer angelehnten Bambino einmummelten: Sie kleideten ihn, hüllten ihn fest und zu fest ein, als hätte er jeden Abend Zahnschmerzen; beide stumm, Vater und Kind, weil das noch Arbeit war, Pflicht, das Warten abends bei der Krippe, der Weg, den man bis nach Hause zurücklegen musste, und die vielen Stunden, die sie den Tag durch voneinander trennten.