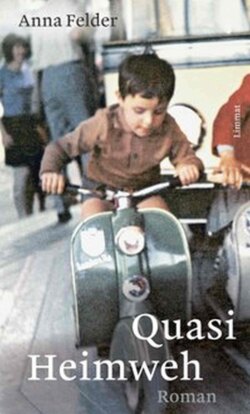Читать книгу Quasi Heimweh - Anna Felder - Страница 7
4
ОглавлениеMit Giannis Freunden unterhielt ich mich oft über meine Schüler: Aber sie wollten nicht, dass ich von den Aufsätzen erzählte, von dem, was wir zusammen lasen, von den Zeichnungen, die ich geschenkt bekam und die ich über alles liebte und nicht einmal Bethli gab; sie wollten Daten wissen, wollten Zahlen, und da war es dann jedes Mal, als ob man Funken schlüge über die leeren Nussschalen: Hitzige Diskussionen entbrannten, bei denen der Name und die Geschichte meiner Kinder nichts mehr bedeuteten, sondern nur noch die Regierung, die Industrie, die Politik etwas galten. Fredi, der Jus studierte (und den wir jetzt beim Vornamen nannten), hatte alle Ziffern im Kopf und wusste die Einwohnerzahl einer jeden Gemeinde: so viele Schweizer, so viele Ausländer, so viele Italiener; mit seinen Zahlen hatte er die Sache besser im Griff als wir alle: Es genügte, sagte er, da und dort ein paar Nullen wieder zurechtzurücken, er schwor es. Und ich dachte, dass alles, was ich im Augenblick tun konnte, nur das eine war: dass ich mit den Eltern von Sergio redete, meinem kleinen Sizilianer in Döttingen; dass ich sie dazu brachte, sich beim Schweizer Lehrer für das häufige Fernbleiben ihres Kindes zu entschuldigen; und dass sie Sergio dann weiter in Döttingen zur Schule schickten, damit er bei ihnen aufwachse, und dass sie ihn nicht zu den Großeltern nach Italien abschoben. Aber es war schwierig, so zu reden, schwierig, dass sie nicht auch mir misstrauten: Sie selbst waren nicht in die Schule gegangen, was sollten sie da ihr Kind hinschicken?
Ich hätte nochmals bis Samstag gewartet, um sie zu Hause antreffen zu können; in die Schule hätten sie keinen Fuß gesetzt, nie und nimmer, und nicht nur aus Zeitmangel; so wäre ich denn nochmals hingereist, am Samstagnachmittag, im gelben Postauto mit dem Schweizer Kreuz, und darin die vielen üppigen Frauen, die zwei Plätze belegen, weil sie breitbeinig sitzen, die gewaltige Einkaufstasche an den Bauch gedrückt; zu Fuß wäre ich wieder die Hauptstraße des Dorfes hinaufgegangen, das so sauber aussah wie für eine Ausstellung, mit den von der Hand eines geduldigen Kindes, des Ersten der Klasse, sorgfältig aneinandergereihten Häuserwürfeln, mit dem Brunnentrog aus Stein oder aus einem hohlen Baumstamm, den roten Geranien auf jedem Fenstersims, dem schmiedeeisernen Wirtshausschild mit dem Bären, dem Posthorn, dem Stern; die Leute hinter den Geranien würden am Saum der Gardine zupfen – ein Wimperschlag – und mir nachschauen; und dann würde ich in eine Gasse mit ärmlicheren Häusern einbiegen, eins wie das andere, und überall hinge Wäsche zum Trocknen und stünden zahllose Occasionsfahrräder in den Ecken und Winkeln der Flure und Gänge herum, und die schönen italienischen Stimmen würden mich zwei oder dreimal vor die falsche Türe locken; und schließlich wäre ich dann wieder der ungebetene Gast, der Eindringling in der ranzigen Luft einer Küche, von wo ich durch aufgerissene und zugeschlagene Türen einen Blick erhasche auf die ungehaltene Gebärde eines Mannes, der auf der schlafverschwitzten Decke sich die Augen wach reibt; und bin nun da und frage mich, wer wohl Sergios Vater sei unter den vielen im Unterleibchen, die auf der Bank sitzen, das Päckchen Parisiennes herumreichen und sich die Sendung für die Gastarbeiter in der Schweiz anhören, «L’ora per voi», in diesem Stück Sizilien mitten in Döttingen; hergekommen auch ich, um mich vors Radio zu setzen und das Madonnenbild, aber doch nicht allein deswegen, ich suche Sergios Eltern und weiß nicht mehr recht, was sagen, auch ich möchte lieber zuhören und Sergios kleine Schwester auf meine Knie heraufziehen; sie warten jetzt alle ab, ich beginne zusammen und durcheinander mit «L’ora per voi» zu reden, überflüssig ist auch mein Mantel geworden, den sie an den Haken bei der Tür aufhängen als etwas Geheiligtes – und noch Verdächtiges – einer Lehrerin, die in den Büchern studiert hat, mit ihrem Akzent aus dem Norden, eine Unverheiratete, ohne Kinder, die Geld ausgibt für die Kleider und Gutes sagt von der Schule und von den Schweizern; ja, gewiss, auch ich eine Italienerin, Tradate-Schuhe, Borotalco und dunkle Augen, aber habe ich sie etwa auch, ich, die Schwiegereltern, für die man sorgen muss, dort unten in Poggioreale? Und die Geschwister und die ganze Familie, die von Monat zu Monat auf die Postanweisung warten; was weiß ich schon von den Schwestern, die sie unter die Haube zu bringen, von den Kindern, die sie großzuziehen haben, und die zur Welt gekommen sind, weil Gott es so wollte; wer weiß, ob ich sie wirklich verstehe, ich mit den Tintenflecken an den Fingern und den Bildchen, die ich in die Hefte einklebe; wer weiß, vielleicht wäre es besser, ich suchte mir auch einen Mann, wie es alle tun, und wartete zu Hause auf die Kinder, die der Herrgott schicken wird, ich könnte mir das leisten, vielleicht sogar ohne in die Fabrik zu gehen, und würde das Mittagessen kochen, die Hemden bügeln, die Kleinen stillen – und nun messen sie mich mit den Blicken, all die Männer, schauen mir auf die Beine, die geschminkten Lippen, sie haben inzwischen den Pullover mit dem Rollkragen übergestreift und sich die Haare angefeuchtet, sie sind jetzt lauter ledige Burschen, die sich entschuldigen, dass sie sich nicht rasiert haben, jeder und keiner von ihnen ist Sergios Vater, sie sagen den Frauen, sie sollen mir einen Kaffee machen, und ich muss auch von dem Likör trinken, muss ihre Parisiennes rauchen, denn ich gehöre doch mit dazu; und Sergio ist gekommen, die Rollschuhe über die Schulter gehängt, er antwortet brav, ein folgsamer Junge; schade, dass Salvatore und Nuccia nicht auch dabei sind, das Fräulein würde sie sehen; aber ich käme ja wieder, abgemacht, sie bleiben alle noch hier in der Schweiz, hinunter reisen sie dann in den Ferien, aber hier kann man arbeiten, es geht einem besser als dort, und es gibt die Migros, wo man alles billig einkauft: ob ich nicht die Pommes-frites-Pfanne und die Wurstschneide- und die Espresso-Maschine gesehen habe; auch hier gibt es nette Leute, der Lehrer von Sergio ist streng, doch wenn das Kind es verdient, so hat er ja recht, sie wollen gar nichts behauptet haben, aber … Aber ich weiß es schon, sie werden nicht zum Lehrer gehen, um mit ihm über Sergio zu reden, und auch sie haben recht, was hat das alles mit dem Reglement und der Sprache zu tun, ihr Kind wird auch in Italien groß werden, sie werden ihm ein Haus in Poggioreale bauen; es wird ein Handwerk lernen auch ohne Deutschunterricht; und sie wollen mir ihren Marsala einschenken, und ich soll doch bitte von der Lyonerwurst aus der Migros versuchen.
Ich hatte gelernt, mit dem amtlichen Kursbuch der Schweizerischen Bundesbahnen und der Postautos umzugehen, weil ich jeden Tag, und fast immer zweimal, von einem Dorf zum andern, von einer Gemeinde hinüber zu einer andern Gemeinde im Kanton herumfahren musste. Wir waren, wir sechs italienischen Lehrer, dem Vizekonsulat in Baden unterstellt, das uns jedes Semester die Ortschaften und den Stundenplan für unser Fach zuteilte: «Italienische Sprache und Kultur»; vier Wochenstunden in jedem Dorf für die Italienerkinder, die regelmäßig die schweizerischen Gemeindeschulen besuchen, damit sie, wenn sie nach Italien zurückkehren (aber auch sonst), sich nicht völlig fremd fühlen in ihrer Heimat: Es war zeit- und kräfteraubend, so hin und her von einer Schule zur andern bis zu abgelegenen Dörfern, die manchmal nur zu den unbequemsten Stunden im Postauto zu erreichen waren.
Ich zum Beispiel musste im ersten Semester am Montag und am Donnerstag von halb acht bis halb zwölf, 1. und 2. Kurs, in Zurzach sein und am Nachmittag dann bis halb sechs in Seon, was wegen der Anschlüsse eine Fahrt von zwei Stunden bedeutete. Meine Mahlzeit war ein Schinkenbrot unterwegs, dazu aß ich drei Reihen Blockschokolade, an der ich mir fast die Zähne ausbiss.
An den anderen Tagen pendelte ich von Brugg nach Küngoldingen, weiter nach Döttingen: Mein Kalender war ein Karussell von Dörfern und kleinen Industriestädten, die mich in einem Glasgebäude empfingen, an das der Architekt soeben noch die letzte Hand angelegt hatte, sauber wie ein Kühlschrank und mit den Lautsprechern und dem Gong fürs Pausenzeichen, Schulhäuser, die die Kinder nur in Pantoffeln betraten; oder in einem dunklen Kellergeschoss, wo ständig die Glühbirnen fieberten, wo die Heizkörper mehr zur Dekoration dienten und wir durch die schmalen Oberlichter nach und nach gelernt hatten, Frau Doktor und all die Leute, die über den Hof daherkamen, an ihren Schuhen zu erkennen. Die Knaben hatten eine besondere Vorliebe für diese verwitterten Räume, in denen meistens vielerlei Sägen, Hobel und Hämmer herumlagen, die ihnen bis in die feinste Schraube vertraut waren: die Zimmer für den Werkunterricht; «Handarbeit» stand an der Tür, und mir schien es jedes Mal, auch wenn die Werkzeuge nicht die gleichen waren, ich käme wieder in Fabios Labor.
Fabio, über sein Werkzeug gebeugt, mit den vorstehenden, zu einem Knoten verschlossenen Lippen, die mir gefielen, in seinem weißen Arbeitskittel, wenn er das Fleisch briet, in Gedanken versunken, eigensinnig, unnachgiebig, ganz in seine Arbeit vertieft, auf die ich eifersüchtiger war als auf alles sonst – und ich konnte nicht davon ablassen, ihn zu quälen und mich dazu, ich wusste, dass ich ihn deswegen liebte, weil er so hartnäckig war, so ganz aus einem Stück und ganz sich selbst wie ein starrköpfiges Kind mit dem Hammer in der Hand.
Ich wollte den Zauberbann brechen, dass er etwas sage, dass er endlich rede; auch ich wollte Bescheid wissen; und zu Hause noch fragte ich ihn ganz krank vor Neugierde aus; aber es war, als ob man sich mit bösartigen Pinzetten in seinen schönen Kopf hineinzwängte: Ich tat ihm weh dabei, und doch konnte er es mir nicht sagen, er schaute mich an, strich mir übers Haar, begriff nicht, warum ich weinte, hatte mich gern.
Jetzt, wenn mir die Tränen kamen in der Werkstatt der Handarbeit, jetzt war es, weil ich ihn so fern wusste, Fabio, weit weg auch in der Zeit, auch in Gedanken weit von diesem Ort am Rheinufer, der einen leichten Anstrich mondänen Lebens hatte: Das mochte von der Grenze herrühren, in der Mitte des Flusses, von den Thermalbädern mit den fremden Kurgästen; wie fern stand ihm das alles, Fabio, das Grab der heiligen Verena, die da lächelt mit dem viereckigen Kamm in der einen Hand und in der andern das Krüglein, unten in der Gruft der Stiftskirche, und die Votivkränze der jungfräulichen Bräute; die kleinen Kaufläden mit den beschlagenen Doppelfenstern, die Plätze mit der Bank rund um den Stamm des Lindenbaums, die komplizierten deutschen Inschriften, «Metzgerei Schmidli, Lindenhofplatz», die er nicht einmal hätte entziffern können.
Für mich dagegen gab es das jetzt und war so echt wie die auf seinem Tisch gerade ausgerichteten Bleistifte und Taschenmesser, wie jeder Winkel in seinem Zimmer mit dem Plattenspieler, der Griechenlandkarte und dem Amaro Giuliani, das Zimmer, das ich durch die abgeteilten Fensterscheiben im Nu ganz klar vor mir erblickte: Dies machte mir plötzlich Angst, dass ich so in ein Luftloch stieß, mitten unter den in zwei Sprachen lärmenden Kindern, dies, dass ich mich fragte, wo sie denn hinfließt, die Zeit.
Es war nicht immer leicht, sich in der Schule zu verständigen: Die Kinder redeten oft, auch unter sich, schweizerdeutsch und fanden dann mit mir den italienischen Ausdruck nicht. Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Brugg: Es war in einer Pause, als die Schüler wild im Hof herumtollten: Auch die Schweizer tobten, während ich mir doch immer vorgestellt hatte, die Kinder aus dem Norden seien stille, gesetzte, brillentragende kleine Erwachsene, wie ich sie im Hotel in Riccione als Feriengäste im Gedächtnis hatte. Die Lehrer kümmerten sich überhaupt nicht um sie, ließen sie gewähren (da hätten wir also ihren Freiheitskult, die Achtung vor dem Individuum) und spazierten unter dem Vordach in Mönchssandalen auf und ab wie Kinder in der Krippe auf dem Dreirad, wenn es regnet, in Gesellschaft einiger Frauen mit weißen Zoccoli und mit gekreuzten Armen, die als Büstenhalter dienten: Es waren die Kolleginnen, wie sie mir nachher sagten, die Lehrerinnen, lauter Fräulein mit dem Namen auf dem Türschild. Ich musste über den Hof gehen und sah mich vorsichtig um in meiner Angst, die Kinder könnten mich bei ihren heftigen Spielen über den Haufen rennen; ich war stehen geblieben, so gut und wo ich konnte, und schaute dem bunten Schwarm von Buben und Mädchen zu (hier trugen sie nicht wie bei uns die schwarzen oder weißen Ärmelschürzen mit der Schleife um den Hals, sie waren ganz wie zu Hause gekleidet); ich zählte sie, wie wenn ich eine Margerite abzupfte: der ja, der nein, diese nein, diese ja; nein, nein, nein, ja: Vor allem die kleinen Italienermädchen waren leicht zu erkennen, fast immer die dunkelsten (oder waren es Spanierinnen?), mit der Haut aus einer andern Substanz, viel aufgelöstem Haar und darin dann immer etwas aufgesteckt, ein Band, ein Schmetterling aus Plastik, und mit goldenen Ohrringen, alles schon kleine Bräute; wenn man sie aber reden hörte, waren es alles Mädchen aus Brugg, die munter mit- und nachplapperten, genau wie die anderen, und die nicht einmal imstande waren, mir im ersten Augenblick auf Italienisch zu sagen, wo mein Schulzimmer war.