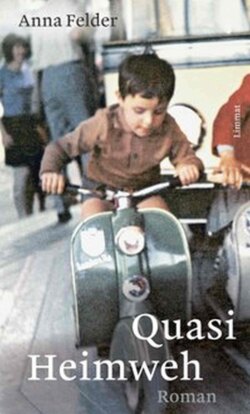Читать книгу Quasi Heimweh - Anna Felder - Страница 6
3
ОглавлениеSeitdem ich meinem Bruder in die Schweiz nachgereist war, lebten wir zusammen in einer am Hügel gelegenen, ganz in die Länge gezogenen Wohnung zuoberst in einem Holzhaus, das mich jedenfalls sehr schön dünkte. Gianni hatte es mit seinem Spürsinn entdeckt und sich für wenig Geld im Dachgeschoss eingemietet, «halb geschenkt», denn das Haus sollte demnächst abgerissen werden: Wann, konnte man uns nicht sagen, aber wir mussten uns bereithalten, von einem Tag auf den andern zu packen.
Wir sind im Herbst dort eingezogen: Ich sehe noch die drei Apfelbäume vor dem Haus: Sie schienen zusammengeschrumpft, waren völlig entblättert, aber sie trugen herrlich rote Äpfel, wie wir sie in der Schule zeichneten. Ein ganzes Jahr sind wir dort geblieben: Die Ersten, die wegmussten, sind dann die drei kümmerlichen Bäume gewesen mit ihren roten Früchten. Ich kann mich an gar nichts Schöneres erinnern als an das lange, lange Zimmer, wo wir uns zum ersten Mal gesetzt haben, um zusammen zu essen und zu plaudern; vielleicht erinnere ich mich so gut daran, weil ich damals wirklich glaubte, noch einmal von vorn zu beginnen, in einer neuen Stadt, mit meinem Koffer voll von frisch gebügeltem und gestärktem Zeug. Und später, als vieles in unserem Leben mir wieder wehgetan hatte, war mir das Zimmer noch lieber geworden.
Die Decke war sehr niedrig, aber man merkte es nicht, weil wir da so hoch im obersten Stockwerk schwebten und mit all dem Himmel durch die lange Fensterfront das Licht der ganzen Stadt für uns hatten. Wegen dieser langgestreckten Form hatten wir unseren Aufenthaltsraum schon gleich das erste Mal «den Zug» genannt; wir sagten zu unseren Freunden: «Kommt doch herauf, in den Zug», wie wenn wir sie zu einer Reise einladen würden; man sah auch den Fluss unten, nur ein winziges Wassergeblinzel zwischen den Bäumen, aber es gab es doch, darauf kam es an, es war wie die Unterschrift unter einem Bild.
Unser Zug wirkte noch länger, weil er fast durchwegs von einem Ende zum andern mit Balken unterteilt war, klotzigen Tannenstämmen, senkrecht und schräg im Zickzackmuster vom Fußboden bis zur Decke, auf die sich Gianni, ein bisschen krumm wie er war, gern mit bergauf hochgelagerten Beinen verkroch, um seine Pfeife zu rauchen. Auf der einen Seite des Balkenwerks war der Boden eine Stufe höher, so dass wir erster und zweiter Klasse fuhren: Die erste war der tiefer gelegene Teil mit Fenstergalerie, wo wir alle Wollkissen ausgebreitet hatten, die uns von der Mutter geschenkt worden waren; in der zweiten drüben musste man auf dem Boden sitzen.
Wir hätten alle unsere Freunde über Nacht beherbergen können, Bethli und Fredi, die beiden kleinen Tessiner, Gino und die anderen Freunde in Italien, wenn wir genügend Matratzen gehabt hätten, um sie reihenweise wie in einem Massenlager unterzubringen.
Für uns zwei hatten wir vorn und hinten am Zug zwei angehängte Stübchen, beide nicht viel größer als ein Bett; an meiner Tür waren unten Löcher ausgeschnitten, vier runde Glotzaugen, durch die ich vom Bett aus sah, ob im Zug das Licht brannte. Die elektrischen Einrichtungen hatte Gianni besorgt: Mit seinem Autofimmel, wie früher als Kind, als wir noch zusammen in einem Zimmer schliefen, hatte er an allen Ecken und Enden Autolampen und Scheinwerfer aufgestellt, die den Raum nur zu grell beleuchteten. In der Küche war alles Nötige, sogar eine Dusche hinter dem Vorhang.
Wenn wir abends mit unseren Freunden auf den Kissen der ersten Klasse saßen und miteinander plauderten, kam es vor, dass Bethli sich in die Küche verzog und duschte. Dann mussten wir, um weiterzureden, mit unseren Stimmen das Wasserrauschen übertönen, das trotz verschlossener Türen Palmolive-Seifenbläschen über unsere Worte versprühte. Wir unterhielten uns auf Italienisch, weil Gianni und ich zu wenig Deutsch konnten. Gino, der Älteste unter uns, war für alle, auch weil er schon ein bisschen Bauch ansetzte, wie der große Bruder; es gab Dinge, die er eher als die andern sagen durfte: Und an einem der ersten Abende, als Bethli sich hinter dem Vorhang zu schaffen machte, hatte er ihr auf Deutsch zugerufen, ob sie Hilfe brauche. Bethli hatte so getan, als höre sie nicht, und hatte ins Plätschern und Gluckern hinein zu singen angefangen.
Damals wusste ich noch wenig von Bethli: Sie arbeitete in der gleichen Firma wie mein Bruder, zusammen mit Gino, der eine höhere Stellung hatte und besser als die andern verdiente, und mit den beiden Tessinern (sie war es dann, später, die auch Fredi zu uns brachte, einen Studenten aus Aarau). Ich wusste, dass ihre Familie nach St. Gallen verzogen war und dass sie zurzeit hier allein lebte, ohne Dusche. Sie machte viele Fehler, wenn sie mit uns redete; es war ein Schul-Italienisch, das aus lauter Adverbien, Ausnahmen, Pronomen bestand; sie sagte: «Gianni andrà lontanamente», «io voglio restare svegliata», «mio amico non viene», «nostri bambini andono a scuola con sette anni»; aber sie hatte viel Mut und eine große Lust, die fremde Sprache zu sprechen, was uns dagegen fürs Deutsche abging.
Mir gefielen ihre Fehler, sie wurde dadurch ein wenig unvertraut und noch abenteuerlicher; wie ihre Kleider, die immer ein bisschen zu knapp waren, gehäkelt, gestrickt, mit besonderen Glasknöpfen als Garnitur, die Gianni nicht ausstehen konnte; und auch ihre Schmucksachen mochte er nicht leiden, die ebenfalls, so behauptete er, alle hausgemacht waren, sonntags früh auf dem Jungfraujoch mit dem Pickel herausgeschlagene Steine und Steinchen, an einer Kette aufgehängt. Gianni konnte nicht begreifen, dass ein Mädchen in ihrem Alter stundenlang gebannt vor den Schaufenstern der Konditoreien stehen bleiben konnte, um die Häuschen aus Schokolade zu betrachten, mit dem Schornstein und der Tür aus kandiertem Zucker und Hänsel und Gretel aus rosarot-grünem Marzipan; und dass sie dann sogar imstande war und uns so was schenkte: Lebkuchenherzen mit einem Gebet darauf, einem Spruch oder was es immer sein mochte, «Zweifle nie an mir, mein Herz gehört nur dir», alles in gotischer Schrift, und rundherum ein Kranz von gotischen Blümchen.
«Alles Krimskrams, alles Kindereien, Bambinate, Bambinathli», fluchte Gianni, wenn sie wieder gegangen war, «was kümmert es mich schon, dass sie den Sommer lieber hat als den Frühling, dass die Astern ihr nicht gefallen? Was braucht man das den Leuten zu erzählen?»
Und ich merkte dabei, dass er immer hingehört hatte, während er so tat, als sei er in die «Automobil-Revue» vertieft, noch aufmerksamer als ich, obwohl Bethli, wie er sagte, ihm auf die Nerven ging. Ich trug den Krimskrams, die bunten Steinchen, in mein Stübchen hinüber, wo schon kein Platz mehr war, und wenn ich wusste, dass Bethli zu Besuch kam, trug ich mindestens zwei von den Herzen wieder zurück auf das Fensterbrett der ersten Klasse. Jedes Mal wunderte ich mich aufs Neue, dass Bethli kleiner war als ich; denn wenn sie nicht neben mir stand, sah ich sie immer nur voller, auffälliger als mich selbst, wobei aus ihr irgendwas weitersprach, auch wenn sie schwieg: Ein Gesicht, einen Ausdruck hatten auch ihr dichtes Haar, ihre Arme, der Bauch in dem ein wenig zu eng anliegenden Rock: alles andere als eine Bohnenstange in Hosen. Wenn sie mit einer schweren Gebärde der Hand bis hin in die Nackenbeuge die Haare zurückwarf, ging ihr plötzlich ein großes, breites, glattes Gesicht auf, das ganz aus waagrechten, erstaunlich ruhig fließenden Linien bestand: ein Gesicht, das auf einmal erwachsen war, vielleicht das Gesicht ihrer Mutter, heimlich herangereift unter dem Honighaar. Ein so weites Gesicht hatte ich nur in dem von Fabio entdeckt, wenn er mir den Kopf in den Schoß legte: Sitzend sah ich so von oben, unmittelbar vor mir, wie sich ihm in einem jähen Wunder die Stirn, die Augen, die Lippen abflachten, süß und besänftigt entglitten in ein gelöstes Gesicht ohne Umriss.
Das erste Mal, als sie uns mit Fredi bekanntmachte, hatte ich mich gefragt, ob sie ein Paar wären; ich weiß noch, wir waren damals zum Essen in die Stadt gegangen, Bethli mit uns beiden: Fredi sollte später zu uns stoßen. Wir warteten auf ihn in einem großen Lokal, wo es nach Zigarre roch, mit einer Drehtür und grünen Jassteppichen auf den Tischen, und viele massige Männer spielten wortlos Karten und brachen dann plötzlich in heftiges Geschrei und Husten aus. Die Kellnerinnen, alle mit dem vorgewölbten weißen Spitzenzünglein der Schürze über der Geldbörse, hatten nicht viel zu tun, aber sie sahen müde aus, lehnten sich mit der Hüfte und dem Ellbogen an die Theke, plauderten miteinander und behielten dabei die Kartenspieler im Auge, die immer wieder mit einer angedeuteten Bewegung, indem sie das leere Glas in die Höhe hoben, ein weiteres Bier, die dritte oder vierte Stange bestellen konnten. Eine nicht mehr ganz junge war darunter, die während der ganzen Zeit, als wir auf Fredi warteten, sich mit dem Finger in den Ärmelausschnitt des schwarzen Pullovers aus und ein fuhr, teilnahmslos im Takt wie ein Pendelchen, das die Minuten schlug. In der Mitte des Raumes saß an einem runden Tisch, dem Vater gegenüber, ein schwachsinniger aufgeschwommener Junge, mit Händchen und einer Fistelstimme wie ein Neugeborener; es war ihm vermutlich beigebracht worden, er solle keinen Zucker essen und seine Schachtel Assugrin bei sich haben: Denn er hatte dem Vater die Zuckerwürfel für den Tee hinübergereicht und dann mit unsäglicher Aufmerksamkeit die Tablettchen aus der Dose genommen und ins Glas fallen lassen (den Tee servierten sie für gewöhnlich in unzerbrechlichen Glasbechern, ähnlich wie die zum Zähneputzen).
Fredi, der damals für uns noch Herr Senn hieß, hatte mich, so lang er war, mit einer derart tiefen Verbeugung begrüßt, dass ich meinte, er küsse mir die Hand; und da ich nicht recht wusste, wie das bei einem Handkuss vor sich ging, fragte ich mich dann noch eine ganze Weile, ob er es vielleicht doch wirklich getan hatte. Wir waren zum Essen in einen Nebenraum hinübergewechselt, eine verwinkelte Puppenstube mit vielen kleinen Tischen, alle gedeckt und mit Blumen und brennenden Lämpchen in den Fensternischen; und hier nun bedienten uns Kellner, fast alles Italiener. Mein Bruder schwieg, er war vielleicht verärgert, dass er sich nicht wie Herr Senn zum Essen umgezogen hatte: Er sah älter aus, machte ein Gesicht à la Po-Ebene, eine trockene undurchdringliche Miene, und ließ die Schultern hängen wie unser Vater auf den Fotografien; ich mochte es sogar gern, wenn Gianni so finster war: Er kam mir dann viel erwachsener vor als ich, wie ein Schatten, der uns alle stumm bemitleidete: Er rieb sich die Stirn und die Augen, als ob er die Gedanken verscheuchen wollte, die in seinem Innern mahlten, und daraus hervor tauchte dann ein fahles fliehendes Gesicht wie ein Nieskrampf, ausgehöhlt in den Augen, die düsterer als ein Abgrund wurden. So war es jenen Abend an mir zu reden: Herr Senn nämlich richtete dauernd Fragen an mich, vielleicht auch nur aus Höflichkeit: Er redete zu laut, ganz erregt vor Wagemut, Sätze in einer fremden, im Grammatikbuch gelernten Sprache nun von sich zu geben: Was er sagen wollte, lief durch ein Übersetzungsmaschinchen und kam wie gedruckt heraus, so dass ich bei meinen Antworten das Gefühl hatte, nicht mit ihm zu reden, sondern ein Formular auszufüllen. (Aber dann flocht er gern bei jeder Gelegenheit «lo giuro, lo giuro» ein, ich schwöre es, wie ein geborener Italiener, und wiederholte es sehr unbefangen, vermutlich um sich vor Bethli aufzuspielen.) Er hatte eine blonde Haarsträhne, die ihm in die Stirn fiel, und schöne Musikerhände: Ich stellte ihn mir an dem Abend als kleinen Jungen vor, wie die Schüler, die Schweizer, denen ich jeden Morgen unterwegs begegnete: schmächtig, mit einem Haarbüschel in der Stirn und ernstem Blick hinter der Brille hervor, in der Hand den Geigen- oder Cellokasten. Zu Bethli sprach er immer schweizerdeutsch, rasend schnell und mit ganz anderer Stimme: Ich versuchte zu erraten, was zwischen ihnen war, ob Zärtlichkeit, heimliches Einverständnis oder sonst was. Was sie sich wohl schon gesagt, wie sie einander kennengelernt, ob sie eifersüchtig waren, welche Erinnerungen sie miteinander hatten. Mir wäre es komisch vorgekommen, so einen Freund zu haben, mit Haaren wie ein Junge und der dazu noch deutsch spricht: der mir vielleicht die Hand geküsst hätte, bevor er mir einen dicken glänzenden Ring an den Finger ansteckte. (Aber hatten sie dann den Ring, so wusste ich schon, wie sie sich die Finger drückten: Täglich traf ich sie in der Bahn, die Pärchen halbwüchsiger Verlobter, die sich an allen vier Händen gepackt hielten, wie mit Zangen so fest für immer, für immer.)
Was uns fehlte, in unserem Zug, war mein schöner Zeichentisch: Die Leute, die im Parterre wohnten, hatten uns für den Winter ihren orangerot gestrichenen Gartentisch geliehen, an den wir uns zum Essen setzten, und sechs gleiche Stühle dazu; aber die Schulbücher, meine Hefte, die Bücher, die Gianni aus Italien mitgebracht hatte und die, die er in der Libreria Italiana in Zürich kaufte, um sie dann auch mir und Gino weiterzugeben, die stapelten wir am Boden auf, in zwei hohen Bergen; mit unseren Freunden saßen wir so zwischen den zwei Stößen am Kaminfeuer in einem weißen Lichtfleck: Von oben umhüllte uns der Strahl eines von Giannis Scheinwerfern; die Hände wärmten wir uns, indem wir Nüsse knackten: Der eine von den beiden Tessinern, der noch mehr Bauer war, brach sie mit seinen breiten kräftigen Händen auch für Bethli und mich auf; drei aufs Mal konnte er in der geballten Faust knacken.
Die beiden kleinen Tessiner brachten uns keinen Krimskrams mit: Sie kamen mit einem Panettone Selma oder mit den Nüssen, einer Flasche Grappa oder mit einer Salamiwurst, die sie unter der Jacke versteckten; sie trugen mir alles in die Küche, «nur eine Kleinigkeit», sagten sie, «l’è nagott, l’è ‘1 minim», und strichen mit dem Italienischen ihre Mundart voll Knoten und Warzen, glatt, schlimmer noch als die unsrige.
Sie hatten mir erzählt, dass sie hier «herein», «in dentro», also in die deutsche Schweiz, gekommen waren, um die Sprache besser zu lernen; aber deutsch, sagte mir Gianni, redeten sie nicht einmal im Geschäft; und zum Schatz, «a morosa», gingen sie übers Wochenende ins Tessin, wenn sie nach Hause zurückkehrten: Der eine hatte eine richtige feste «morosa», die im Ospedale Civico in Lugano arbeitete, und wir wussten es, dass wir uns von Zeit zu Zeit ein Stück vom Panettone der Mariangela abschnitten. «Hast du es ihr erzählt, deiner Mariangela, dass du da bei zwei hübschen Mädchen sitzt und ihren Panettone isst? Hast du es ihr erzählt von Bethli, die drüben duscht?» (Und in dem Augenblick war vielleicht Mariangela, das arme Ding, gerade im Begriff, sich die weiße Ärmelschürze umzubinden, um ihren Nachtdienst anzutreten.) Wer uns die drei Nüsse mit der bloßen Hand aufbrach, war aber doch der andere, der Bauer von den beiden.