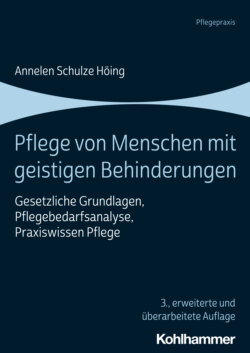Читать книгу Pflege von Menschen mit geistigen Behinderungen - Annelen Schulze Höing - Страница 67
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wahrnehmung und Selbstbild
ОглавлениеDie Auseinandersetzung mit und die eigene Wahrnehmung des Alternsprozesses verläuft bei Menschen mit geistigen Behinderungen unterschiedlich. Oft wird der eigene körperliche Abbau entweder nicht wahrgenommen oder aber verleugnet, so dass Klienten sich überschätzen und dadurch auch gefährden. Der Lebensradius nimmt ab, sie haben weniger Handlungsmöglichkeiten als früher und können manches nicht mehr selbst tun, die körperlichen Grenzen werden enger (vgl. Ding-Greiner & Kruse, 2010). Unterschiede zeigen sich auch in Bezug auf das Selbstbild und die Verarbeitungsmöglichkeiten altersbedingter Körperveränderungen und Leistungseinbußen. Gruppenleiter, die mit älteren geistig behinderten Klienten das Seminar »Selbstbestimmt älter werden« durchführten, berichten in diesem Zusammenhang von folgender Erfahrung:
Die Eigenwahrnehmung des biologischen Alters und die soziale Alterseinschätzung der Teilnehmer klaffen teilweise weit auseinander.
Während des Seminars konnte die überwiegende Anzahl der Teilnehmer ihr biologisches Alter exakt angeben, ordnete sich jedoch auf einer Skala der Lebensstadien (Kind – Jugendlicher – junger Erwachsener – Erwachsener – alter Mensch) bei den 20- bis 25-Jährigen ein. Obwohl die älteren Menschen mit geistigen Behinderungen körperlich schon lange erwachsen sind, werden sie von ihrer Umgebung offensichtlich nicht als Erwachsene angesehen und entsprechend behandelt. Das aus der lebenslangen Behandlung als Kind resultierende inkongruente Selbstbild macht es dem älter werdenden Menschen mit geistigen Behinderungen schwer zu verstehen, dass bei ihm altersbedingt körperliche Alterungsprozesse (z. B. Verschlechterung des Hör- und Sehvermögens, Abnahme der Leistungsfähigkeit) einsetzen (vgl. Wunder, 2011).
Welche Veränderungen kommen auf die Mitarbeitenden und die Einrichtungen zu?
Kommen die Klienten »in die Jahre«, ist neben pädagogischen Kenntnissen auch Fachwissen auf dem Gebiet der Gesundheits- und Altenpflege und Gerontopsychiatrie notwendig, um adäquat auf altersbedingte Veränderungen eingehen zu können. Es ergeben sich für Mitarbeitende folgende neue Aufgabenstellungen:
• Übernahme einer Lotsenfunktion in Bezug auf gesundheitliche Bereiche ( Kap. 3.2 Vorsorgeuntersuchungen)
• Einholung von Expertisen zu pflegerischen Fragen, z. B. Pflegebedarfserhebung, fachlich fundierte Ziel- und Maßnahmenplanung (alternativ Strukturierte Informationssammlung (SIS) und Maßnahmenplanung (entbürokratisierte Variante))
• Ggf. Anwendung von Assessmentverfahren zum Ermitteln pflegerischer Risiken, falls diese nicht schon durch in Augenscheinnahme erkennbar sind (z. B. Dekubitus- und Sturzrisiko, Schmerzerfassung bei Menschen, die sich nicht äußern können, Demenz)
• Begleitung zu oder Anleitung bei der Durchführung prophylaktischer und therapeutischer Maßnahmen
• Umgang mit gerontopsychiatrisch ausgelösten Verhaltensweisen
• Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit unheilbaren Erkrankungen
• Begleitung von Klienten und Angehörigen in der Sterbephase
• Einführung von Pflegestandards
• (Vermittlung von) Beratung, Schulung zu gesundheitsbezogenen Fragestellungen