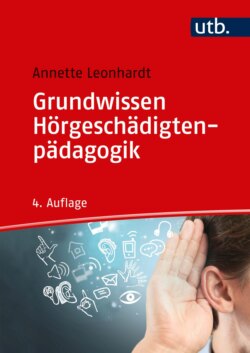Читать книгу Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik - Annette Leonhardt - Страница 11
Оглавление3 Hörschäden im Kindes- und Jugendalter
Die Situation eines Kindes, das von Geburt an hörgeschädigt (gehörlos, hochgradig hörgeschädigt oder schwerhörig) ist, und eines Kindes, das sehr frühzeitig das Gehör verliert, unterscheidet sich grundlegend von den Verhältnissen, die für den im Erwachsenenalter ertaubten oder schwerhörig gewordenen Menschen gelten. In den Kapiteln 1 und 4 sind die Auswirkungen eines Hörschadens auf die emotional-volitive, geistige, körperliche, soziale und sprachliche Entwicklung dieser Kinder beschrieben. Die frühestmögliche Erkennung eines Hörschadens ist unter diesen Gesichtspunkten eine bedeutungsvolle Aufgabe. Deshalb hat der Gesetzgeber die Grundlagen dafür geschaffen, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung ein umfangreiches und an den einzelnen Entwicklungsphasen des Kindes orientiertes Früherkennungsprogramm angeboten wird. Dieses für Säuglinge und Kleinkinder geschaffene Programm umfasst zehn ärztliche Untersuchungen in der Zeit von der Geburt bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres zu festgelegten Terminen. Das Früherkennungsprogramm enthält auch Maßnahmen zur Früherkennung von Hörschäden. Die Untersuchungen sollen nach den Vorgaben der „Kinder-Richtlinien“ von denjenigen Ärzten vorgenommen werden, „welche die vorgesehenen Leistungen auf Grund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen erbringen können, nach der ärztlichen Berufsordnung dazu berechtigt sind und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen“ (Kinder-Richtlinie 2017, 6).
3.1 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen
Anatomie des Ohres
Das, was gewöhnlich als Ohr bezeichnet wird, ist das statoakustische Sinnesorgan (gr. Statikos = auf das Gleichgewicht bezogen; gr. akoustikos = das Gehör betreffend). Wie der Name es bereits ausdrückt, sind hier zwei Sinnesorgane (Hörorgan, Gleichgewichtsorgan) auf engem Raum kombiniert. Sie haben verschiedene Funktionen.
Am Ohr werden drei Abschnitte unterschieden (Abb. 3): äußeres Ohr, Mittelohr und Innenohr.
Abb. 3: Aufbau des Ohres (aus: FORUM BESSER HÖREN: moderne HÖRSysteme, 14)
Das äußere Ohr (Auris externa)Zum äußeren Ohr werden Ohrmuschel und Gehörgang gezählt. Die Ohrmuschel besitzt mit Ausnahme des Ohrläppchens ein Gerüst aus elastischem Knorpel. Sie hat die Form eines Schalltrichters, der sich zum äußeren Gehörgang immer mehr verjüngt, d. h., der Anfangsteil des äußeren Gehörganges wird von einer rinnenförmigen Fortsetzung des Ohrmuschelknorpels gebildet, die durch das Bindegewebe zu einem geschlossenen Gang ergänzt wird (Abb. 4). Den Abschluss bildet das schräg in den Gehörgang eingelassene Trommelfell. Das Trommelfell ist eine häutige Membran mit einem Durchmesser von 9 – 11 mm. Es ist normalerweise so zart, dass die Gebilde des Mittelohres hindurchschimmern (Abb. 5).
Abb. 4: Längsschnitt des äußeren Gehörganges
Abb. 5: Ein rechtes Trommelfell
Das Mittelohr (Auris media) Hauptbestandteil des Mittelohrs (Abb. 6) ist die Paukenhöhle, ein spaltförmiger (schmaler hoher) Raum des Felsenbeins. Es wird lateral vom äußeren Ohr (Trommelfell) und medial vom Innenohr begrenzt. Die Paukenhöhle ist mit Schleimhaut ausgekleidet und beim gesunden Menschen mit Luft gefüllt.
Quer durch den oberen Teil der Paukenhöhle zieht vom Trommelfell zur Wand des Innenohrs die gelenkig miteinander verbundene Kette der Gehörknöchelchen: Hammer, Amboss und Steigbügel. Der Hammer ist durch seinen Handgriff mit dem Trommelfell verwachsen. Sein Köpfchen trägt eine Gelenkfläche, an die sich der Ambosskörper anlagert. Der Amboss sieht ähnlich aus wie ein Backenzahn mit zwei Wurzeln. Der längere dieser Ambossschenkel ist gelenkig mit dem Steigbügel verbunden. Die Fußplatte des Steigbügels ist bindegewebig im ovalen Fenster der Vorhofswand befestigt, so dass sie beweglich bleibt. Zwei Muskeln regulieren die Bewegungen der Gehörknöchelkette: der Hammermuskel, der das Trommelfell spannt, und der Steigbügelmuskel. Beide Muskeln sind Antagonisten: Der Hammermuskel zieht bei Auftreffen eines Schalls das Trommelfell nach innen und drückt das Fußstück des Steigbügels in das Vorhoffenster: Er bewirkt so eine erhöhte Empfindlichkeit der Überleitung. Der Steigbügelmuskel hebelt das Fußstück des Steigbügels aus dem Vorhoffenster heraus und verursacht dadurch eine Dämpfung der Überleitung. Beide Muskeln regulieren also den Spannungszustand des Schallleitungsapparates.
Abb. 6: Querschnitt durch das Mittelohr
Die Ohrtrompete ist eine 3 – 4 cm lange Röhre, auch Eustachische Röhre genannt. Sie geht von der Vorderwand der Paukenhöhle ab und mündet in den oberen Teil des Nasen-Rachen-Raumes. Bei jedem Schluckakt (oder auch beim Sprechen von k-Lauten und Gähnen) wird durch Muskelzug die Ohrtrompete erweitert (Abb. 7), so dass zwischen Mittelohr und Nasen-Rachen-Raum ein ständiger Luftaustausch erfolgen kann. (Somit erfolgt ein Luftdruckausgleich zwischen Mittelohr und Rachen.)
Abb. 7: Öffnung der Tube durch die Muskeln
a) geschlossene Tube
b) offene Tube
Das Innenohr (Auris interna)Das innere Ohr ist in die Felsenbeinpyramide eingelagert (Abb. 8). Es wird wegen seiner verwirrenden Vielfalt auch als Labyrinth bezeichnet. Es besteht aus zwei miteinander in Verbindung stehenden funktionellen Teilen, den Gleichgewichtsorganen (mit Vorhof und den drei Bogengängen) und dem Hörorgan in der Schnecke (Cochlea). Gleichgewichtsorgan und Hörorgan reagieren auf sehr feine Druckänderungen und stehen funktionell in enger Beziehung zueinander. Beide Sinnesorgane befinden sich im häutigen Labyrinth.
Das häutige Labyrinth ist ein System von Blasen und Kanälen, das allseitig von einer sehr harten Knochenkapsel (knöchernes Labyrinth) umgeben ist. Das häutige Labyrinth ist mit Endolymphe (visköse, d. h. klebrige Flüssigkeit) gefüllt. Das knöcherne Labyrinth enthält eine wasserklare Flüssigkeit, die Perilymphe, in der das häutige Labyrinth schwimmt.
Abb. 8: Das Innenohr
Abb. 9: Schema des häutigen Labyrinths: Die endolymphatischen Räume sind hellgrau, der Knochen dunkelgrau und die perilymphatischen Räume weiß
Alle Räume des häutigen Labyrinths stehen durch feine Kanälchen miteinander in Verbindung. Die Perilymphe und die Endolymphe im häutigen Labyrinth stehen nicht miteinander in Verbindung.
Das knöcherne Labyrinth Zentrales Mittelstück des knöchernen Labyrinths ist der Vorhof (Vestibulum). Nach vorn geht das Vestibulum in die knöcherne Schnecke (Cochlea) über und an seiner Rückwand münden die knöchernen Bogengänge. Die laterale Wand des Vorhofes entspricht der medialen Wand der Paukenhöhle und enthält zwei Öffnungen: das ovale Fenster und das runde Fenster.
Das häutige Labyrinth Das häutige Labyrinth besteht aus vier Teilen:
| ■ Sacculus | } | (gehören zum Gleichgewichtsorgan) |
| ■ Utriculus | ||
| ■ die 3 Bogengänge | ||
| ■ der häutige Schneckengang | (gehört zum Hörorgan) |
Utriculus und Sacculus sind zwei kleine Säckchen, die gemeinsam im knöchernen Vorhof liegen. Beide enthalten in einem umschriebenen Wandabschnitt Sinnesepithel. Auch in jedem Bogengang liegt jeweils eine quere Leiste mit Sinnesepithel. Durch Verschieben der Endolymphe werden bei Bewegungen und Lageänderungen des Körpers die Sinneszellen gereizt. Von den Sinneszellen im Vorhof wird die Erregung durch den Vorhofnerv des Gleichgewichts- und Hörnervs (Nervus vestibulocochlearis) zum Gehirn weitergeleitet.
Die häutige Schnecke enthält das Cortische Organ. Das Cortische Organ erstreckt sich in spiraligem Verlauf von der Basalwindung bis zur Kuppelwindung der Schnecke. Es ist das Sinnesepithel des Hörorgans und besteht ebenfalls aus Sinnes- und Stützzellen. Schallwellen, die auf das Trommelfell treffen, versetzen dies in Schwingungen. Diese werden durch die Kette der Gehörknöchelchen zum ovalen Fenster geleitet und durch die Steigbügelplatte auf die Endolymphe des Innenohrs übertragen, wodurch die Sinneszellen des Cortischen Organs gereizt werden. Der Schneckennerv des Gleichgewichts- und Hörnerven (Nervus vestibulocochlearis) leitet die Erregung zum Gehirn. Der Gleichgewichts- und Hörnerv hat also – ebenso wie das Ohr – eine doppelte Funktion.
Der Gleichgewichts- und Hörnerv (Nervus vestibulocochlearis) bildet gemeinsam mit 11 weiteren Hirnnerven das periphere Nervensystem des Kopfes. Das periphere Nervensystem hat die Aufgabe, die nervösen Erregungen weiterzuleiten.
Periphere Nerven enthalten im Allgemeinen sowohl afferente (sensorische) Nervenfasern, die dem Zentralnervensystem (ZNS) Informationen aus der Um- und Innenwelt zuleiten, als auch efferente (motorische) Nervenfasern, deren periphere Zielgebiete Drüsen und die Muskulatur sind.
Hörnerv und zentrale HörbahnenDie von den Sinneszellen des Cortischen Organs zum Ganglion spirale (Ganglien sind Ansammlungen von Nervenzellen, in denen die Nervenfasern ihren Ursprung haben) ziehenden Fasern geben dort die von ihnen geleiteten Reize auch an andere Nervenzellen weiter. Die Nervenfasern des 1. Neurons (Neuron = Gesamtheit der Zellfortsätze mit der dazugehörigen Ganglienzelle) verlaufen gemeinsam als Hörnerv in das Schädelinnere, wo sie in das Gehirn an dessen Unterseite eintreten. (Diesen Vorgang hat der Hörnerv mit den von den Gleichgewichtsorganen kommenden Nervenfasern gemeinsam.)
Nach Eintritt in den oberen Anteil des verlängerten Rückenmarks ziehen die Fasern des Hörnervs in ein aus mehreren Teilen bestehendes Ganglion, das als Nucleus cochlearis bezeichnet wird. Hier beginnt das zentrale Hörsystem.
Vom Nucleus cochlearis ziehen nun zentrale Hörbahnen über verschiedene Kerne (Nuclei) zum Zwischenhirn und von hier zur Hirnrinde, wobei der größere Teil der Bahnen auf die andere Hirnseite hinüber wechselt („kreuzt“). (Ein Prinzip, das bei allen wesentlichen Nervenbahnen zu beobachten ist.)
Eine Vorstellung von der Kompliziertheit der Führung der zentralen Hörbahnen im Gehirn vermittelt die vereinfachende Darstellung in Abb. 10. Die Abbildung zeigt, dass Impulse von einem Ohr zu beiden Hörrindenzentren geleitet werden.
Die Hörrinde liegt anatomisch in einer Querwindung des Schläfenlappens und wird Heschlsche Querwindung genannt. Die gürtelförmig an diese primäre Hörrinde angrenzenden Hirnareale werden als sekundäre Hörrinde bezeichnet.
In der Hörrinde (Abb. 12) findet die bewusste Verarbeitung der Höreindrücke statt.
Abb. 10: Schematische Darstellung der zentralen afferenten Hörbahnen
Abb. 11 (links): Seitenansicht des Gehirns mit Großhirn, Kleinhirn und Übergang zum Rückenmark
Abb. 12 (rechts): Die Hörrinde
Physiologie des Hörens
Unter Physiologie des Hörens versteht man die Lehre von den Hörfunktionen. Diese werden wahrgenommen durch das periphere Gehör- und Gleichgewichtssystem, das zentrale Hörsystem und das zentrale vestibulare System.
Äußeres Ohr Die Schallwellen erreichen das Hörorgan hauptsächlich über die Ohrmuschel, die als Schalltrichter dient (Abb. 3). Der Schall wird hier aufgefangen und gebündelt und gelangt durch den Gehörgang zum Trommelfell. Die auftreffenden Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen.
Der Schall setzt auch den ganzen Schädel in Schwingungen, die direkt auf die Hörschnecke übertragen werden (man spricht von Knochenleitung). Sie spielt physiologisch kaum eine Rolle, doch wird sie zur Diagnose herangezogen und kann zur Hörgeräteversorgung genutzt werden.
Zwischen dem Auftreffen des Schalls am linken und rechten äußeren Ohr liegt (aufgrund ihres Abstandes zueinander) eine minimale Zeitdifferenz. Dadurch werden eine Raumorientierung und die Ortung der Schallquelle möglich.
Mittelohr Die Schwingungen werden über die Gehörknöchelkette weitergegeben (Abb. 6). Der Hammergriff, der mit dem Trommelfell fest verwachsen ist, gibt die Schwingungen an den dahinter liegenden Amboss weiter. Dieser wiederum überträgt die Schwingungen auf den Steigbügel. Der Steigbügel leitet die Schwingungen über die Steigbügelplatte als Druckbewegung an das ovale Fenster weiter. Es entsteht so eine Druckwelle, die die Perilymphe (Flüssigkeit im knöchernen Labyrinth) des Innenohrs in Schwingung bringt.
Die Aufgabe der Gehörknöchelkette ist die möglichst verlustarme Übertragung des Schalls von einem Medium mit niedrigem Wellenwiderstand (Luft) zu einem mit hohem Wellenwiderstand (Flüssigkeit; Abb. 13 und Abb. 14). Dieser Schallwellenwiderstand wird Impedanz genannt.
Die Binnenohrmuskeln (Trommelfellspannmuskel und Stapediusreflexmuskel) sind eine Schutzfunktion des Ohres gegen zu laute Höreindrücke. Sie sind in der Lage, die Schallübertragung der Gehörknöchelkette zu verändern. Teils wird die Übertragung leisen Schalles verbessert, teils die Übertragung lauten Schalles gebremst und die Nachschwingungen der Knöchelchen gedämpft. Wenn der eintreffende Schall zu laut und von langer Dauer ist, kontrahieren sich die Binnenohrmuskeln und versteifen die Gehörknöchelkette.
Abb. 13: Schallaufnahme und -weiterleitung
Abb. 14: Schallweiterleitung (Ausschnitt)
Innenohr Das ovale Fenster gerät durch die Druckbewegung, die durch die Schwingungen der Steigbügelplatte entstehen, ebenfalls in Schwingung. Dadurch entsteht eine Wanderwelle in der Schnecke. Tiefe Frequenzen erzeugen nahe der Schneckenspitze eine Auslenkung, hohe Frequenzen nahe der Basis der Cochlea (Richtung ovales Fenster).
Die Schnecke (Cochlea) ist hauptsächlich ein flüssigkeitsgefüllter Schlauch mit einer Membran (Basilarmembran genannt), die der Länge nach mitten durch sie hindurchläuft. Die Flüssigkeit innerhalb der Cochlea wird in wellenartige Bewegungen versetzt, wenn – wie eingangs erwähnt – die Fußplatte des Steigbügels gegen das ovale Fenster an der Basis der Schnecke vibriert. Diese Wellenbewegung der Flüssigkeit setzt sich der Länge des aufgerollten Schlauches nach fort, um das Ende herum und zurück zur Basis auf der anderen Seite, wo sie vom runden Fenster absorbiert wird (Abb. 14).
Durch ihre Bewegung versetzt die Flüssigkeit die Basilarmembran in wellenartige Bewegung. Diese Bewegung beugt die kleinen Sinneshaare, die sich an den Sinneszellen der Schnecke befinden. (Die Sinneszellen der Schnecke werden Corti-Organ oder Hörorgan genannt.) Die Sinneszellen verwandeln die mechanischen Schwingungen der Basilarmembran in neurale Aktivität, indem sie, wenn sie sich beugen, Nervenenden reizen.
Der physikalische Reiz ist nunmehr in einen Nervenreiz transformiert.
Hörtheorien
Zur Erklärung der Umwandlung von Schallwellen in Empfindungen (Hörempfindungen) gibt es verschiedene Hörtheorien. Diese sind aber nicht in der Lage, gleichzeitig alle Einzelheiten des Hörvorgangs zu erklären. Jede erklärt einen Teil des Vorgangs. Die genaue Erforschung ist infolge der geringen Ausmaße des Hörorgans und der Winzigkeit der von ihm verarbeiteten Kräfte schwierig. Eine der bekanntesten Hörtheorien stammt von Georg von Békésy (1899 – 1972; 1961 Nobelpreis). Seine sogenannte Wanderwellentheorie löste die bis dahin gültige Vorstellung von Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) (Resonanzhypothese) ab. Die Wanderwellentheorie von von Békésy gilt inzwischen auch nicht mehr als ausreichend und wird ergänzt durch eine Verstärkertheorie. Diese geht davon aus, dass erst durch den Einfluss der äußeren Haarzellen eine ausreichend hohe Trennschärfe der Frequenzen erreicht werden kann. Ferner ermöglichen die äußeren Haarzellen eine Verstärkung des ansonsten zu geringen Reizes für die inneren Haarzellen bei einem Schalldruck unter 50 (–80) dB (Götte 2010). Daher werden die äußeren Haarzellen als „cochleäre Verstärker“ bezeichnet.
(Weiterführende Informationen dazu sind Goldstein [2002, 371f], Lenarz / Boenninghaus [2012, 24f], Lindner [1992, 91f], Plath [1992, 37f], Probst [2008 a, 151], Schmidt / Lang [2007, 343f] und Gerrig [2016, 129f] zu entnehmen.)
Reizfortleitung und zentrale SchallverarbeitungSchallintensität, Dauer (Entfernung der Schallquelle), Schallfrequenz(en) und Schallrichtung werden vom Ohr aufgenommen und zur Weiterleitung im Hörnerv kodiert.
Im Verlauf der Hörbahn (Nervenverbindungen zwischen Cortischem Organ [=Hörorgan] in der Cochlea [=Schnecke] des Innenohres und dem Hörzentrum in der Hirnrinde (Abb. 10)) findet bereits eine komplizierte Verarbeitung der aufgenommenen akustischen Informationen statt. Während die Umformung im Mittelohr- und Innenohrbereich noch als analoge Informationswandlung angesehen werden kann, lässt sich die neuronale Weiterverarbeitung der Signale mit einer digitalen und sogar strukturbildenden vergleichen (Lindner 1992, 89).
Wichtige Umschaltstationen der HörbahnenDie Nervenimpulse verlassen die Cochlea in einem Faserbündel (= Hörnerv). Diese Fasern haben Schaltstellen (=Synapsen) im Nucleus cochlearis (Kap. 3.1) des Gehirnstammes. Von da aus laufen 60 % der eintreffenden Informationen zur gegenüberliegenden Gehirnhälfte, der Rest bleibt auf der ursprünglichen Seite. Auf ihrem Weg zum auditiven Cortex (Hörrindenzentrum) durchlaufen die auditiven Signale noch eine Reihe weiterer Kerne (Nuclei).
Bedeutung erste LebensjahreFür die Ausreifung des auditorischen Cortex spielen die ersten vier Lebensjahre die entscheidende Rolle. Ein adäquater akustischer Stimulus ist die Voraussetzung für einen Erwerb der Lautsprache. Im auditorischen Cortex entstehen die Schalllokalisation und die Schallbilderkennung. Die Schalllokalisation gelingt durch das zeitlich verzögerte Eintreffen des Schalls und dem Lautstärkeunterschied zwischen beiden Ohren. Die Schallbilderkennung – für das menschliche Gehör ist das wichtigste Schallbild die Lautsprache – ist eine kognitive Großhirnfunktion, die erlernt ist. (Zur Bedeutung der frühen Hörerfahrung siehe Kral 2012.)
Das akustische Hörrindenzentrum liegt im Bereich des Schläfenhirns in unmittelbarer Nachbarschaft zur Körpergefühlssphäre, zum Brocaschen Sprachzentrum und zum akustischen Sprachzentrum.
3.2 Arten und Ausmaß von Hörschäden
Funktionsstörungen im Bereich des Hörorgans, der Hörbahnen oder der Hörzentren bewirken eine Schwerhörigkeit oder eine Gehörlosigkeit. Das Wissen darüber allein reicht nicht aus, um eine entsprechende (z. B. medizinische oder pädagogische) Intervention einleiten zu können. Ebenfalls wichtig ist es, über Art und Ausmaß des Hörschadens Bescheid zu wissen. Dies ist aus medizinischer Sicht für die Art der Behandlung, aber auch zur Abschätzung des Grades der Behinderung (s. Tab. 1) notwendig. Für den Hörgeräteakustiker bietet die Kenntnis dieser Daten eine wesentliche Grundlage für die Anpassung von Hörgeräten. Dem Hörgeschädigtenpädagogen vermittelt es eine erste Orientierung, wobei aufgrund einer Diagnose, insbesondere bei jüngeren Kindern, nicht voreilig auf mögliche Entwicklungsverläufe geschlossen werden darf. Es sind folgende Arten der Hörschädigung zu unterscheiden:
Arten der Hörschädigung
a) Schallleitungsschwerhörigkeit
b) Schallempfindungsschwerhörigkeit (auch: Sensorineurale Schwerhörigkeit)
c) Kombinierte Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit
d) Gehörlosigkeit
a ) bis d) zählen zu den peripheren Hörschäden. Des Weiteren gibt es zentrale Hörstörungen. Zu den bekanntesten und pädagogisch relevanten gehören
e) die Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS).
a) Schallleitungsschwerhörigkeit (auch Mittelohrschwerhörigkeit oder konduktive Schwerhörigkeit) Schwerhörigkeiten dieser Art sind im schallzuleitenden Teil des Ohres lokalisiert, d. h., dass der Schall das Innenohr nicht ungehindert erreichen kann. Es liegt eine Funktionsstörung des Gehörgangs, des Trommelfells oder des Mittelohres vor, die meist als Folge von Mittelohrentzündungen oder von Infektionskrankheiten, die auf das Mittelohr übergegriffen haben, entstanden sind.
Abbildung 15 zeigt normale Knochenleitungswerte. Daraus kann geschlossen werden, dass das Innenohr und die zentrale Verarbeitung von Schallreizen normal funktionieren. Für die Luftleitung zeigt sich ein Hörverlust, der weitgehend linear verläuft. Die Lage von Knochenleitung und Luftleitung zueinander beschreibt man als Luftleitungs-Knochenleitungs-Differenz. Bei einer Schallleitungsstörung ist der Hörverlust in allen Frequenzen etwa gleich groß; ihre Folge ist leiseres Hören. Diese Art von Schwerhörigkeit ist mittels Hörgeräten gut auszugleichen. Eine lineare Intensitätsverstärkung bewirkt hier, dass das gesamte Sprachfeld in den Bereich des Hörens rückt. Schallleitungsschwerhörigkeiten kann man zudem medizinisch in fast allen Fällen soweit therapieren, dass auch ohne technische Hilfen (Hörgeräte) ein soziales Gehör vorhanden ist. Daher besuchten diese Kinder seit jeher einen allgemeinen Kindergarten oder eine allgemeine Schule. Eine hörgeschädigtenspezifische Begleitung ist dabei zu gewährleisten. Liegt allerdings eine weitere Behinderung vor, so ist mit nachteiligen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung des Kindes weit eher zu rechnen, so dass dies bei der pädagogischen Begleitung und Förderung entsprechend Berücksichtigung finden muss.
Abb. 15: Schallleitungsschwerhörigkeit
b) Schallempfindungsschwerhörigkeit (auch Sensorineurale Schwerhörigkeit) Die Schallempfindungsschwerhörigkeit (auch Sensorineurale Schwerhörigkeit) beruht auf pathologischen Veränderungen des Cortischen Organs oder retrocochleär der nervalen Hörbahn. Deswegen sind zwei Formen zu unterscheiden: die sensorische (auch cochleäre) Schwerhörigkeit und die neurale (auch retrocochleäre) Schwerhörigkeit. Die beiden Schädigungsformen können auch gleichzeitig auftreten.
Das Tonaudiogramm (Abb. 16) weist für Luft- und Knochenleitung den gleichen Hörverlust aus, d. h., es besteht keine Luftleitungs-Knochenleitungs-Differenz.
Aus dem Kurvenverlauf kann man entnehmen, dass die Störung entweder im Innenohr oder von da aus zentralwärts liegt. Um den genauen Ort der Funktionsstörung zu finden, bedarf es einer Differenzialdiagnostik durch spezielle audiologische Tests.
Die Hörschwelle verläuft bei einer sensorineuralen Schwerhörigkeit nicht linear, die höheren Frequenzen sind stärker betroffen. Schallereignisse, insbesondere die Lautsprache, werden zumeist verzerrt wahrgenommen, weil Teilbereiche des Sprachfeldes (insbesondere die hochfrequenten Sprachanteile) unterhalb der subjektiven Hörschwelle liegen. Diese sind jedoch für das Verstehen von Sprache wichtig. Es liegt also eine Beeinträchtigung der auditiven Differenzierungsfähigkeit vor, wodurch z. B. Sprachlaute nicht adäquat aufgenommen werden können.
Abb. 16: Mittelgradige Innenohrschwerhörigkeit beidseits
Eine einfache lineare Verstärkung der Intensität, z. B. durch lautes Sprechen, bietet dem von dieser Art betroffenen schwerhörigen Menschen keine Hilfe. Hörgeräte können eine wirkungsvolle Hilfe sein. Voraussetzungen für einen wirklichen Hörgewinn sind jedoch eine gründliche audiologische Diagnostik durch den HNO-Arzt, eine sorgfältige Anpassung der Hörgeräte durch den Akustiker sowie eine Hörerziehung bzw. ein Hörtraining (Kap. 10.1), die bzw. das auf die individuelle audiologische Situation abgestimmt ist.
Die Ursachen der sensorineuralen Schwerhörigkeit sind vielfältig. Sie kann vererbt sein, kann pränatal eintreten (z. B. Erkrankung der Mutter während der Schwangerschaft an Röteln oder Toxoplasmose), perinatal (z. B. durch Asphyxie) oder postnatal (z. B. durch Meningitis, Encephalitis, toxische Stoffwechselstörungen, häufige und länger andauernde Lärmeinwirkung) (weiterführende Informationen Kap. 3.3).
Überschwellige Hörstörungen Im Zusammenhang mit der sensorineuralen Schwerhörigkeit ist noch auf zwei Formen überschwelliger (bedeutet über der Hörschwelle des Betroffenen liegende) Hörstörungen hinzuweisen, die die Wahrnehmung und die zentrale Verarbeitung hörbarer Schallerscheinungen zusätzlich erschweren: Bei der sensorischen (oder cochleären) Schwerhörigkeit findet man als typisches audiometrisches Merkmal das Recruitment. Bei der neuralen (oder retrocochleären) Schwerhörigkeit tritt die pathologische Verdeckung auf.
Recruitment Das Recruitment wird durch Innenohr-Haarzellenstörungen verursacht und bewirkt einen pathologischen Lautheitsausgleich. Leise Schallerscheinungen werden nicht gehört, wenn sie unterhalb der Hörschwelle liegen. Signale oberhalb der Hörschwelle werden gut erkannt und im Bereich um 80 dB werden sie ebenso laut empfunden wie von Normalhörenden. Da aber der Abstand zwischen (der herabgesetzten) Hörschwelle und der Schmerzschwelle verringert ist, wird die Unbehaglichkeitsschwelle eher erreicht. Das Recruitment ist oft nicht über die gesamte Frequenzbreite verteilt, sondern betrifft nur bestimmte Bereiche des Frequenzspektrums, die den geschädigten Haarzellenabschnitten der Basilarmembran entsprechen. Dadurch erhöht sich die Kompliziertheit der individuellen auditiven Wahrnehmung weiter. Meist ist das Recruitment mit starken Hörverlusten verbunden, so dass bei Kindern die Auswirkungen auf die Sprachentwicklung erheblich sein können. Bei enger Dynamik (das ist der Bereich zwischen Hörschwelle und Unbehaglichkeitsschwelle) kann die Hörgeräteanpassung schwierig sein, weil leicht Verzerrungen auftreten. Bei optimaler Verstärkung kann man jedoch ein gutes Sprachgehör erreichen.
Pathologische Verdeckung Die pathologische Verdeckung ist eine abnorme auditive Ermüdung, d. h., unter Geräuschbelastung verschlechtert sich die Hörschwelle des Betroffenen. Laute Schallerscheinungen werden als sehr leise empfunden oder verschwinden ganz. Der Betroffene hat erhebliche Schwierigkeiten, sprachlichen Nutzschall vom Störlärm bzw. Nebengeräuschen zu erkennen. Damit ist das Verstehen von Sprache weitgehend beeinträchtigt.
c) Kombinierte Schallleitungs-SchallempfindungsschwerhörigkeitWenn neben einer Schallleitungsstörung noch eine Funktionsstörung des Innenohres besteht, spricht man von kombinierter Schwerhörigkeit oder kombinierter Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit oder kombinierter Mittelohr- und Innenohrschwerhörigkeit. Die drei Bezeichnungen werden in der Fachliteratur parallel verwandt. Bei dieser Form der Schwerhörigkeit weist das Audiogramm (Abb. 17) sowohl einen herabgesetzten Verlauf der Knochenleitungskurve als auch der Luftleitungskurve aus, zwischen beiden liegt jedoch eine Differenz. Der Hörverlust für die Luftleitung ist immer größer als der für die Knochenleitung. Die Schallempfindungsschwerhörigkeit dominiert jedoch und bestimmt das Wahrnehmungsgeschehen.
d) GehörlosigkeitGehörlosigkeit ist eigentlich keine gesonderte Hörstörung, sondern beruht auf einem hochgradigen Schallempfindungsschaden. Anders ausgedrückt: Die sensorische oder neurale Schwerhörigkeit bedeuten im Extremfall eine praktische Taubheit oder Gehörlosigkeit (Abb. 18). Eine absolute Taubheit, bei der keinerlei Hörreste mehr vorhanden sind, ist sehr selten und tritt eigentlich nur dann auf, wenn der Hörnerv oder das primäre Hörzentrum zerstört sind. Ungefähr 98 % der Menschen, die als „gehörlos“ bezeichnet werden, verfügen über Hörreste (Pöhle 1994, 12). Diese Hörreste sind jedoch so gering, dass Lautsprache auf natürlichem (imitativem) Wege nicht oder bei Verwendung von digitalen Hörgeräten nur unter bestimmten Bedingungen, d. h. durch spezifische Förderung und Erziehung, erlernt werden kann. Die heute möglich gewordenen frühzeitigen und bilateralen Cochlea Implantat-Versorgungen eröffnen inzwischen vielen dieser Kinder – bei entsprechender hörgeschädigtenpädagogischer Begleitung – einen über das Hören vollzogenen Spracherwerb (Kap. 7 und 11). Lange Zeit galt als Gehörlosigkeit, wenn der Hörverlust im Hauptsprachbereich (liegt zwischen 500 und 4.000 Hz) größer als 90 dB war. Durch die Entwicklung der modernen Hörgerätetechnik und durch die Effektivität auditiv-verbaler Frühförderung ist diese Definition aus pädagogischer Sicht nicht mehr haltbar (Diller 1991; Pöhle 1994).
Abb. 17: Hörverlustaudiogramm einer kombinierten Schwerhörigkeit beidseits
Abb. 18: Beispiel für ein Hörverlustaudiogramm bei Gehörlosigkeit beidseits
Ausmaß des Hörverlustes Neben der Art des Hörschadens wird das Ausmaß des Hörverlustes (gemessen in Dezibel [dB] als Maß der für die Tonwahrnehmung oder das Sprachverstehen notwendigen relativen Lautstärkeerhöhung) ermittelt. Bestimmt wird die Hörschwelle mit einem Audiometer, mit Hilfe dessen ein Audiogramm grafisch erstellt wird (Kap. 5). Die Hörschwelle kennzeichnet den Schalldruck der Töne, der gerade so groß ist, dass eine Hörempfindung ausgelöst wird. Bei Menschen, die gut hörend sind, liegt sie bei ungefähr 0 dB, als definierter durchschnittlicher Mittelwert von jungen Erwachsenen, die in ihrem Leben keine außergewöhnlichen Ohrenerkrankungen hatten und keinem besonderen Lärm ausgesetzt waren. Bei einem Hörverlust zwischen 20 – 40 dB spricht man von leichter, zwischen 40 – 60 dB von mittlerer und zwischen 60 – 90 dB von einer extremen oder hochgradigen Schwerhörigkeit. Als Resthörigkeit (Gehörlosigkeit und Taubheit) bezeichnet man Hörschäden, bei denen der Hörverlust im Hauptsprachbereich über 90 dB liegt (Tab. 3). Ermittelt wird der Hörverlust (auch: Schweregrad einer Hörschädigung), indem man vom besseren Ohr das arithmetische Mittel des Hörverlustes bei 500, 1.000, 2.000 und 4.000 Hz (= Hauptsprachbereich) errechnet.
Tab. 3: Grade/Ausmaß eines Hörverlustes
| Luftleitungsschwelle im Hauptsprachbereich (500 bis 4.000 Hz) | Bezeichnung des Ausmaßes |
| 0 dB | normalhörend |
| 20 – 40 dB | leichtgradig |
| 40 – 60 dB | mittelgradig |
| 60 – 90 dB | hochgradig |
| über 90 dB | an Taubheit grenzend/gehörlos |
Dringend anzumerken ist, dass die Einteilung nach dem Ausmaß des Hörverlustes nur von begrenztem Wert ist, da die individuellen Auswirkungen und Folgeerscheinungen auch bei etwa gleichem Hörverlust und gleicher Art des Hörschadens sehr unterschiedlich sein können. Daher sollten nach der Diagnose nicht voreilig Prognosen über mögliche Entwicklungsverläufe betroffener Kinder gegeben werden.
Zum Vergleich sollen einige Lautstärken für bestimmte Schallereignisse angegeben werden. Tab. 4 gibt dem Leser eine ungefähre Vorstellung von dem Ausmaß eines Hörverlustes.
Tab. 4: Beispiele für dB-Lautstärke (s. auch Lindner 1992, 40; Plath 1992, 68)
| Dezibel | entspricht |
| 0 dB | Hörschwelle normalhörender Personen |
| 30 dB | Rauschen von Bäumen |
| 40 dB | gedämpfte Unterhaltung |
| 60 dB | Staubsauger, Rundfunkmusik |
| 80 dB | starker Straßenlärm |
| 100 dB | sehr laute Autohupe |
| 120 dB | Flugzeugmotoren in 3 m Abstand |
| 130 dB | schmerzender Lärm |
e) AVWS Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) liegen vor, wenn bei normalem peripheren Gehör (normale Hörschwelle im Tonaudiogramm) zentrale Prozesse des Hörens gestört sind. Das bedeutet, dass bei den betroffenen Personen trotz einer normalen Hörschwelle höhere Funktionen des Hörens, wie beispielsweise Sprachverstehen in Ruhe und in Störlärm, oder die Schalllokalisation gestört sind.
Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen fallen meist erst im Schulalter auf. Die Häufigkeit wird auf 2 bis 3 % geschätzt, wobei Jungen doppelt so häufig wie Mädchen betroffen sind.
Die Ursachen für AVWS sind noch weitgehend ungeklärt. Genannt werden genetische Ursachen, eine verzögerte Hörbahnreifung (durch zeitlich zurückliegende Schallleitungsschwerhörigkeiten im Säuglings- und Kleinkindalter), umgebungsbedingte Faktoren, schulische Einflüsse und solche der Raumakustik sowie akustische Reizüberflutungen (Böhme 2006; Lindauer 2009; Nickisch 2010).
3.3 Ursachen
Nach Biesalski und Collo (1991) sind bei etwa 40 % der Kinder keine sichere Ursache ihrer Hörschädigung festzustellen, d. h., die Hörschädigung ist unbekannter Ätiologie. Matulat (2018) führt etwa ein Drittel auf Komplikationen während der Geburt oder Infektionen in der Schwangerschaft zurück.
Die Ursachen können nach verschiedenen Gesichtspunkten eingeteilt werden, siehe z. B. Abb. 19.
Eine andere Möglichkeit der Einteilung wäre die nach dem Ort der Störung:
Äußerer Gehörgang
■ Aplasie (Organanlage [hier: Gehör] vorhanden, aber Entwicklung ausgeblieben)
■ Gehörgangsatresie (angeborener Verschluss des Gehörgangs)
■ Anotie (fehlende Ohrmuschel)
■ Mikrotie (Kleinheit der Ohrmuschel)
■ Cerumen obturans (Ohrenschmalzpfropf)
Trommelfell
■ Fehlbildung
■ Retraktion (Zurück- oder Zusammenziehen des Trommelfells)
■ starke Vernarbung
■ sehr große Perforation (Durchbruch)
Paukenhöhle
■ Fehlbildung
■ Exsudat (entzündungsbedingter Austritt von Flüssigkeit und Zellen aus Blut- und Lymphgefäßen)
■ entzündliche Erkrankungen
■ Blutungen
Cochlea
■ Fehlbildungen
■ Entzündungen
■ biochemische Veränderungen, z. B. Vitamin-A-Mangel
■ intracochleäre Druckstörungen
Nucleus cochlearis (Nervenfortsätze)
■ Aplasie (s. o.)
■ toxische Degeneration
Zentrale Hörbahn und kortikale Hörregion
■ angeborene und erworbene Hörschäden
(in Anlehnung an Biesalski / Collo 1991, 124)
Abb. 19: Ursachen kindlicher Hörschädigungen (nach: Biesalski / Frank 1994, 68)
Seidler (1996) teilt in seiner Darstellung der Ursachen für therapieresistente Schwerhörigkeiten nach Ursachen für Schallleitungsschwerhörigkeit und Ursachen für sensorineurale Schwerhörigkeit ein. Seine Ausführungen könnte man wie in Abbildung 20 verdichten.
Abb. 20: Einteilung der Ursachen (nach Ausführungen von Seidler 1996)
Die häufigste Einteilung der Ursachen ist die nach dem Zeitpunkt des Eintretens der Hörschädigung, also ob die Hörschädigung pränatal, perinatal, postnatal oder im Erwachsenenalter eingetreten ist.
PränatalEine pränatale Hörschädigung ist entweder erblich bedingt oder sie ist durch Erkrankung der Mutter während der Schwangerschaft (z. B. Masern, Keuchhusten, Röteln) hervorgerufen worden. Aber auch Alkohol-, Nikotin- und Drogenmissbrauch, (missbräuchliche) Verwendung von Beruhigungsmitteln und Antibiotika sowie die Einnahme ototoxischer Medikamente können ebenso zu Hörschäden führen wie schwere Diabetes der Mutter oder schwere Blutungen während der Schwangerschaft.
Perinatal Perinatal umreißt den Zeitraum kurz vor, während oder nach der Entbindung. Kaschke (2012, 57) benennt dafür den Zeitraum 24. Schwangerschaftswoche bis zum 7. Lebenstag nach der Geburt. Eine perinatale Hörschädigung kann durch Frühgeburt oder Schädelverletzungen verursacht werden, ebenso durch Atemstillstand mit längeren Wiederbelebungsmaßnahmen, Sauerstoffmangel während der Geburt, Infektionen oder durch eine im Zusammenhang mit der Geburt auftretende Neugeborenengelbsucht hervorgerufen werden.
Postnatal Eine postnatale Hörschädigung tritt häufig infolge einer Infektionskrankheit ein. Als solche wären beispielhaft zu nennen: Hirn- und Hirnhautentzündung, Diphtherie, Mumps, Scharlach und Masern. Außerdem können postnatale Schädigungen durch Schädelverletzungen verursacht werden. Im Erwachsenenalter entstehen Hörschädigungen seltener durch Krankheiten, sondern eher durch Hörsturz (zumeist stressbedingt; Thurnher et al. [2011] verweisen auf 5 bis 20 von Hörsturz Betroffenen je 100.000 Menschen im Jahr), infolge des Alterns (als Altersschwerhörigkeit) oder als Folge andauernden starken Lärms (Lärmschwerhörigkeit). Eine Schwerhörigkeit kann progredient (fortschreitend) verlaufen, so dass eine vollständige Ertaubung eintreten kann.
Schorn (1998a, 95) verweist für kindliche Schwerhörigkeit auf Missbildungen des äußeren und des Mittelohres, die mit einer Schallleitungsschwerhörigkeit einhergehen. Beispiele hierfür wären Gehörgangsatresie, doppelter Gehörgang, Aplasie oder Dysplasie (Fehlbildung) des Trommelfells, Dysplasie der Paukenhöhle und Felsenbeindysplasie oder im Rahmen von Syndromen, z. B. Cockayne-Syndrom (Kombination von Zwergwuchs, Schwerhörigkeit und Retinitis pigmentosa), Down-Syndrom (Trisomie 21 – numerische Chromosomen-Aberation, intellektuelle Beeinträchtigungen, häufig mit Schallleitungsschwerhörigkeit verbunden), Goldenhar-Syndrom (Missbildungen im Gesicht, Augen- und Ohrmissbildung, Gehörgangsatresie).
Kindliche Innenohrschwerhörigkeit teilt sie in kongenitale (angeborene) und erworbene Schwerhörigkeiten ein.
Kongenitale Schwerhörigkeiten
■ Kongenitale nicht progrediente monosymptomatische Schwerhörigkeiten
■ Kongenitale progrediente monosymptomatische Schwerhörigkeiten
■ Kongenitale polysymptomatische Schwerhörigkeiten (Syndrome)
– Schwerhörigkeit mit Missbildung am äußeren Ohr
– Schwerhörigkeit mit Augenerkrankungen
– Schwerhörigkeit mit Nierenerkrankungen
– Schwerhörigkeit mit Schilddrüsenerkrankungen
– Schwerhörigkeit mit Hauterkrankungen
– Schwerhörigkeit mit Skeletterkrankungen
– Schwerhörigkeit mit Mukopolysaccharidosen (Stoffwechselanomalien)
– Schwerhörigkeit mit chromosomalen Anomalien
Erworbene Schwerhörigkeiten
■ Intrauterin erworbene Schwerhörigkeiten
■ Perinatal erworbene Schwerhörigkeiten
■ Postnatal erworbene Schwerhörigkeiten
(Beispiele dafür Tab. 6)
Tabelle 5 stellt von der Vielzahl mit Schwerhörigkeit einhergehender Syndrome (im Gesamtschrifttum werden mehr als 350 beschrieben) sieben kurz vor, wobei das letzte streng genommen kein Syndrom, sondern eine Assoziation ist. Die ersten fünf wurden ausgewählt, da diese nach Biesalski/ Collo (1991, 125) am bekanntesten sind und daher wohl am häufigsten auftreten. Somit werden diese dem Hörgeschädigtenpädagogen am ehesten begegnen. Die Trisomie 21 wird aufgeführt, da es im Deutschen Zentralregister für kindliche Hörstörungen (DZH) von allen dort erfassten Syndromen mit Abstand am häufigsten vorkommt (gefolgt vom Waardenburg-, Goldenhar-, Franceschetti- und Usher-Syndrom) (Spormann-Lagodzinski 2003). Bei Trisomie steht die geistige Behinderung im Vordergrund, so dass Hörschäden leicht übersehen werden können.
Tab. 5: Darstellung ausgewählter Syndrome
| Bezeichnung | benannt nach | Audiologische Symptomatik | Erscheinungsbild (typische Symptome, Besonderheiten) |
| Waardenburg- SyndromInzidenz: 1:4.500 | Petrus Johannes Waardenburg, 1886 – 1979, holländischer Ophthalmologe und Genetiker | kongenitale Schwerhörigkeit beidseits, unterschiedlich ausgeprägt, meist mittelgradige Schwerhörigkeit | einhergehend mit Hauterkrankung, Fehlbildungssyndrom infolge genabhängiger früh-embryonaler Entwicklungsstörungen (Erbleiden), fakultative Pigmentstörungen von Iris, Haut und Haaren; weiße, große Stirnlocke; charakteristische Gesichtsveränderungen: innerer Augenwinkel lateral verlagert; flacher, breiter Nasenrücken; zusammenwachsende Augenbraue |
| Franceschetti- Syndrom (Synonym: Treacher- Collins- Syndrom)Inzidenz: 1:50.000 | Adolf Franceschetti, 1896 –1968, Ophthalmologe, Zürich und Genf (E. Treacher Collins, 1862 – 1932,Chirurg, London) | ein- oder beidseitige hochgradige Mittelohrschwerhörigkeit, einseitige, selten beidseitige Innenohrschwerhörigkeit unterschiedlichen Ausmaßes möglich | einhergehend mit Skeletterkrankung, Fehlbildungssyndrom mit charakteristischem Gesicht (vererbt), Mikrotie und Gehörgangsatresie; laterales Lidkolobom (Spalt des Lids); antimongoloide Lidspaltenstellung, Vogelgesicht, hypoplastisches Jochbein, Makrostomie (Fehlbildung mit seitlicher Erweiterung der Mundspalte), Zahnstellungsanomalien; starke Ausprägungsschwankungen |
| Pendred- SyndromInzidenz: ca. 7,5: 100.000 | Vaughan Pendred, 1869 –1946, britischer Arzt | kongenitale hochgradige Schwerhörigkeit beidseits, Progredienz bis zur Gehörlosigkeit | einhergehend mit Schilddrüsenerkrankung, erblich bedingt, angeborene oder im Kindesalter manifest werdende Innenohrschwerhörigkeit (manchmal schubweise), Struma („Kropf“)- Beginn frühkindlich; Jodfehlverwertung |
| Usher- SyndromInzidenz: 3 – 4,5: 100.000 | Charles Howard Usher,1865 – 1942, Ophthalmologe | angeborene oder frühmanifeste Innenohrschwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit | einhergehend mit Augenerkrankung, vererbtes Krankheitsbild mit charakteristischer Kombination von (meist) Gehörlosigkeit und Retinitispigmentosa (vom Rand der Netzhaut zum Zentrum langsam fortschreitend kommt es zur Einlagerung von Pigmentkörperchen und damit zur Lichtundurchlässigkeit), beginnend mit Nachtblindheit, später Gesichtsfeldeinschränkung beidseits bis Erblindung (ca. ab 40. Lebensjahr); dem Pädagogen können betroffene Schüler durch Orientierungsschwierigkeiten bei Dämmerlicht und Dunkelheit oder „Tolpatschigkeit“ (z. B. Stolpern über Gegenstände, da Gesichtsfeld eingeschränkt) auffallen |
| Alport- SyndromInzidenz: 1:5.000 – 10.000 | Arthur Cecil Alport, 1880 –1959, Arzt, Südafrika | progrediente bilaterale Schwerhörigkeit, Ertaubung möglich | einhergehend mit Nierenerkrankung, vererbtes Krankheitsbild mit charakteristischer Kombination von Nierenleiden und Schwerhörigkeit, Augenanomalien möglich (häufig Grauer Star), Veränderung im Hören (und beim Sehen) Ende des ersten Lebensjahrzehnts |
| Trisomie 21 (auch: Down-Syndrom) | Trisomie (dreifaches) Chromosom 21, bzw. John Langdon Haydon Down, 1826 – 1896, Arzt, London | gehäuft Schallleitungsschwerhörigkeit aber auch Schallempfindungsoder kombinierte Schwerhörigkeit | geistige Behinderung, rundlicher Minderwuchs, schräge Augenstellung, breite Nasenwurzel, gehäuft Herzfehler (50 %), 60 – 70 % haben Hörschädigung |
| CHARGE-Assoziation (auch - Syndrom)Inzidenz: 0,1 – 0,2: 10.000 | Anfangsbuchstaben der englischen Wörter C – Coloboma (Kolobom des Auges), H – Heart Anomaly (Herzfehler), A – Choanal Atresie (Choanal-atresie), R – Retardation (vermindertes Längenwachstum und Entwicklungsverzö gerung), G – Genital Anomalis (Anomalie der Geschlechtsorgane), E – Ear Anomalies (Fehlbildungen des Ohres) | Schallleitungs- oder Schallempfindungsoder kombinierte Schwerhörigkeit von unterschiedlichem Ausmaß | einhergehend mit verlangsamter Gesamtentwicklung der Kinder liegen eine Hör-Seh-Schädigung plus weitere Symptome (z. B. Gesichtslähmung, Fehlen des Geschmacks, Probleme beim Schlucken, verstärkte Infektanfälligkeit u. a. m.) neben den Merkmalen, die die Namensgebung schufen, vor |
Die CHARGE-Assoziation soll vorgestellt werden, weil sie in den letzten Jahren für die Hör-(und Seh-)geschädigtenpädagogen an Bedeutung gewonnen hat.
Weiterführende Informationen zu den in Tab. 5 genannten und zu zahlreichen anderen Symptomen sind zu finden bei Gross (1981): Differentialdiagnose der Syndrome mit Schwerhörigkeit und Retinopathia. – Kessler (1989): Fehlbildungen in der Otolaryngologie. – Leiber (1996): Die klinischen Syndrome. – Bunck (1998): Das Usher-Syndrom – Diagnostik, pädagogische Einflußnahme und Maßnahmen bei Betroffenen. – Lehnhardt (1998a): Hereditäre Hörstörungen und Syndrome. – Naumann / Scherer (1998): Differentialdiagnose in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. – Zorowka (2008): Pädaudiologie.
Tab. 6 enthält eine Übersicht mit möglichen Ursachen für Hörschäden (z. T. wurden sie im Kapitel bereits erwähnt). Die vorgenommene Reihenfolge innerhalb der Spalten ist subjektiv, d. h., sie entspricht weder der Häufigkeit des Vorkommens noch anderen Ordnungskriterien. Es erfolgt hier nur eine Aufzählung. Zur Begriffsklärung sollte bei Bedarf im Glossar nachgelesen werden.
Tab. 6: Zusammenstellung möglicher Ursachen für Hörschäden
| Pränatale Ursachen | Perinatale Ursachen | Postnatale Ursachen |
| erblich bedingte Hörschäden, zahlreiche Syndrome, siehe z. B. Tab. 4; Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft an – Röteln – Masern – Keuchhusten – Toxoplasmose – konnatale Lues – Zytomegalie – schwere Diabetes – toxische Schäden (Drogen-, Alkohol- und Nikotinmissbrauch, Antibiotika) – ototoxisch wirkende Medika-mente – craniofaciale Anomalien (auch Kiefer- Gaumen-Spalten) – endokrinologische Störungen – ionisierende Strahlen | Geburtsgewicht unter 1500 g, Frühgeburt, Hypoxie, Neugeborenenasphyxie, Schädelverletzungen, Sepsis und / oder Meningitis, Neugeborenengelbsucht, Blutgruppenunverträglichkeit, Infektionen | Meningitis, Encephalitis, Otitis, Zoster oticus, Dystrophie, Mumps, Masern (selten), Scharlach (selten), Diphtherie, bakterielle tympanogene Labyrinthitis, Lyme-Borreliose, Toxoplasmose, Lues, HIV-Infektion, Knall- und Explosionstrauma, Hörsturz, Morbus Menière, Presbyakusis, Schädel-Hirn-Trauma, Aminoglykosidbehandlung |
Tab. 7: Ursachen für Schallleitungs-/Schallempfindungsschwerhörigkeiten (nach Nagel/Gürkov 2009, 8)
| Schallleitungsschwerhörigkeit | Schallempfindungsschwerhörigkeit | |
| angeboren | Fehlbildungen der Ohranlage und der Gehörknöchelchen | – Vererbung– intrauterine Rötelinfektion |
| erworben | – äußeres Ohr: Cerumen, Otitis externa– Mittelohr: Paukenerguss, Trommelfelldefekte, Cholesteatom, Otosklerose | – perinatal: Hypoxie, Ikterus– Trauma: Lärm, Kopfverletzung, postoperativ |
| – Entzündung: chronische Otitis, Cholesteatom, Otosklerose, Meningitis, Masern, Mumps, Lues– Alter: Presbyakusis– Medikamente: Antibiotika, Zytostatika etc.– neoplastisch: Akustikusneurinom– andere: Morbus Menière |
Abschließend sei noch die Einteilung von Nagel / Gürkov (2009) erwähnt. Sie benennen Ursachen für die Schallleitungsschwerhörigkeit und die Schallempfindungsschwerhörigkeit und differenzieren zwischen angeborenen und erworbenen Schwerhörigkeiten. Zugleich verweisen sie darauf, dass bei einer sensorineuralen Schwerhörigkeit (Schallempfindungsschwerhörigkeit) oftmals keine spezifischen Ursachen angegeben werden können.
Zur Ergänzung siehe Friedrich / Bigenzahn / Zorowka (2008): Phoniatrie und Pädaudiologie, 350 – 360. – Kompis (2016): Audiologie, 71f. – Probst / Grevers / Iro (2008): Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 181 – 185. – Thurnher et al. (2011): HNO-Heilkunde, 120.
3.4 Häufigkeit
Die Aussagen über die Verbreitung von Hörschäden sind sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Literatur sehr unterschiedlich. Ebenso ergibt die ältere und jüngere Fachliteratur des In- und Auslandes in den angeführten Zahlenwerten ein sehr uneinheitliches Bild. Die Gründe dafür sind in tatsächlichen regionalen und epochalen Unterschieden, in Unzulänglichkeiten in den Erfassungsmethoden, in Abgrenzungs- und Klassifikationsproblemen bis hin zu unterschiedlichen Auffassungen, ob behebbare Schallleitungsschwerhörigkeiten und einseitige Hörschädigungen mit zu erfassen sind oder nicht, zu sehen. Ein weiterer Grund für statistische Differenzen sind tatsächlich vorhandene Abweichungen und Veränderungen. So ändern sich der Stand der medizinischen Erkenntnis und Versorgung, die gesundheitspolitische Aufklärung und die sozio-ökonomischen Verhältnisse.
Weltweit beträgt die Häufigkeit von persistierenden Hörschädigungen bei Kindern zwischen 90 und 1.300 pro 100.000 (vgl. Finckh-Krämer et al. nach Streppel et al. 2006). Die Häufigkeit kindlicher Hörschädigungen mit einem Hörverlust von mindestens 35 dB auf dem besseren Ohr liegt weltweit zwischen 100 und 600 pro 100.000 (Gross et al. 2000). In Ländern der Dritten Welt scheint die Prävalenz aufgrund häufigerer entzündlicher Innenohrschädigung, ototoxischer Einflüsse und Epidemien (z. B. Meningitis) höher zu sein. Aber auch innerhalb der EU werden Unterschiede gefunden.
Epidemiologie und DemographieKrüger verweist in diesem Zusammenhang (1991, 27) auf eine – wenn auch schon ältere – Vergleichsstudie in neun westeuropäischen EU-Staaten (veröffentlicht 1979, demzufolge sind von Deutschland nur die alten Bundesländer erfasst), auf eine durchschnittliche Rate von 0,09 % signifikanter Hörschädigungen im Kindesalter. In der Studie war versucht worden, alle damals Achtjährigen (Geburtsjahrgang 1969) mit einem Hörverlust von über 50 dB auf dem besseren Ohr zu erfassen. Die offensichtlichen Schwierigkeiten einer Erfassung zeigten sich darin, dass trotz vergleichbarer sozialpädiatrischer und sozialpolitischer Gegebenheiten man in Belgien auf 0,07 % und in Dänemark auf 0,15 % Hörschädigungen in diesem Alter kam, was in diesem Ausmaß wohl kaum tatsächlichen Unterschieden entsprach. Heute geht man in den westlichen Industrieländern von einer Häufigkeit von ca. 100 bis 300 Fälle permanenter kindlicher Hörschäden bei 100.000 Neugeborenen aus (Spormann-Lagodzinski et al. 2002). Thurnher et al. (2011, 120) geben für Österreich ein gehörloses Kind auf 1.000 Neugeborene an. Generell scheinen die Angaben zur Häufigkeit von Hörschädigungen in den entwickelten Ländern auch in der Gegenwart noch immer sehr stark zu variieren. Matulat (2018) begründet das mit echten Unterschieden zwischen den Untersuchungsgruppen (Regionen, Ländern) und der Frage, was als Hörschädigung definiert wird.
Trotz der genannten Schwierigkeiten soll auf verschiedene Angaben verwiesen werden, um einerseits einen generellen Überblick über die Situation zu vermitteln und andererseits auf die bereits in vorangegangenen Kapiteln erwähnte Heterogenität der Gruppe der Menschen mit Hörschädigung zu verweisen.
Statistik: DeutschlandUm einen ersten Überblick zu schaffen, wie viele Menschen mit Hörschädigung es in Deutschland gibt, soll die Statistik „Sozialleistungen Schwerbehinderte Menschen“, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, herangezogen werden. Das Statistische Bundesamt erhebt seit 1979 alle zwei Jahre eine Bundesstatistik über die Menschen mit Behinderung. Die nachfolgenden Daten sind der Ausgabe von 2017 entnommen. Die dort aufgeführte Tabelle „Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2015 nach Art der schwersten Behinderung und Altersgruppen, 1.2.1 Insgesamt“ ist in Tabelle 8 wiedergegeben. Zum Vergleich werden die Daten von 2007 aufgeführt.
Die Gesamtanzahl wird noch untergliedert in einzelne Altersgruppen: unter 4 Jahren, von 4 bis 6 Jahren, von 6 bis 15 Jahren, von 15 bis unter 18 Jahren, von 18 bis 25 Jahren und von da in Zehnjahresschritten bis „75 Jahre und mehr“. Sie geben Auskunft darüber, wie viele Personen sich von der Gesamtanzahl in der jeweiligen Altersgruppe befinden. Beispielhaft werden vier Altersgruppen vorgestellt (Tab. 9). Während die Zahlenangaben in den ausgewählten Altersgruppen im Vergleich zu den Vorjahren variieren, zeigt sich ein durchgängig deutlicher Anstieg bei allen drei ausgewählten Arten der schwersten Behinderung (Spalte 2) in der Altersgruppe „75 Jahre und mehr“. Die Angaben spiegeln damit demographische Veränderungen in unserer Gesellschaft wider, auf die es zu reagieren gilt.
Tab. 8: Anzahl der Hörgeschädigten insgesamt (Statistisches Bundesamt 2007 und 2017)
| Lfd. Nr. | Art der schwersten Behinderung | insgesamt 2007 | insgesamt 2017 |
| … | |||
| … | |||
| 26 | Taubheit (allein) | 25.436 | 28.449 |
| 27 | Taubheit kombiniert mit Störungen der Sprachentwicklung und entsprechenden Störungen der geistigen Entwicklung | 21.761 | 21.587 |
| 28 | Schwerhörigkeit, auch kombiniert mit Gleichgewichtsstörungen | 213.298 | 253.528 |
| … | |||
| … |
Tab. 9: Anzahl der Hörgeschädigten in ausgewählten Altersgruppen (Statistisches Bundesamt 2017)
| Lfd. Nr. | Art der schwersten Behinderung | davon im Alter von … | |||
| unter 4 | 6 – 15 | 35 – 45 | 75 u. mehr | ||
| … | |||||
| … | |||||
| 26 | Taubheit | 259 | 1.092 | 2.944 | 6.454 |
| 27 | Taubheit kombiniert mit Störungen der Sprachentwicklung und entsprechenden Störungen der geistigen Entwicklung | 306 | 1.460 | 2.902 | 2.549 |
| 28 | Schwerhörigkeit, auch kombiniert mit Gleichgewichtsstörungen | 300 | 2.001 | 7.371 | 99.479 |
| … | |||||
| … |
Hörschädigungen gehören – bezogen auf die Gesamtbevölkerung – zu den verbreitetsten körperlich-funktionellen Beeinträchtigungen. Lärmbedingte Erkrankungen stehen – bei vermutetem weiteren raschen Ansteigen – schon seit langem an der Spitze aller Berufskrankheiten (Neubert 1970 in Richtberg 1980, 5). Nach Lüdtke (1989, 42) nimmt die Lärmschwerhörigkeit (nach den Hautkrankheiten) die zweite Stelle bei den Berufskrankheiten ein.
Mit einem insgesamten Anwachsen der Zahl der Menschen mit Hörschädigung ist in Zukunft weiter zu rechnen, u. a. aufgrund allgemein zunehmender Lärmbelästigung (z. B. im Straßenverkehr, im Beruf) oder auch aufgrund veränderten Freizeitverhaltens (stundenlanges übermäßig lautes Hören mit Kopfhörern oder häufiger Besuch von dröhnenden Diskotheken oder beispielsweise Pop- und Metal-Konzerte).
Statistik: USAKrüger (1991, 26) verweist auf verschiedene Studien in den USA und kommt zu folgender Aussage:
„Regelmäßige Erhebungen in den USA erbringen gegenwärtig Prozentsätze von 7 – 8 % an Personen mit Hörproblemen (‘some difficulty hearing, including tinnitus’) und dies mit zunehmender Tendenz und Hochrechnungen auf 12 % im Jahre 2050. Etwa die Hälfte davon, d. h. 3,5 %, ist von einem bilateralen signifikanten Hörverlust betroffen. Als ,deaf’ (gehörlos und hochgradig schwerhörig, so daß sprachliche Kommunikation allein über das Gehör nicht möglich ist) werden rund 2 Millionen (knapp 1 %) eingestuft, davon 1/5 (400.000) mit einer Ertaubung vor dem 20. Lebensjahr (prevocational) und 1/10 (200.000) vor dem 3. Lebensjahr (prelingual).“
Der gleiche Autor verweist auf 60.000 Gehörlose (1991, 26) in der Bundesrepublik Deutschland, während Wisotzki 80.000 Gehörlose angibt (1998, 36), wobei aus beiden Angaben nicht hervorgeht, ob sich die Zahlen auf die alten Bundesländer oder die gesamte BRD beziehen. Arnold und Ganzer (2011) geben für die BRD (darin sind folglich alle Bundesländer erfasst) die Zahl mit ca. 20.000 Gehörlosen an.
Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) sprach 2009 (DSB 2009) und 2017 (DSB 2017) von je 14 Millionen Menschen mit Hörschädigungen in Deutschland, wovon rund 2,5 Millionen Hörgeräteträger seien (DSB 2009).
Statistik: AltersverteilungAbbildung 21 gibt einen Überblick über die Altersverteilung. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass von allen nennenswert Hörgeschädigten etwa die Hälfte im Erwerbsalter (20 bis 60 Jahre) steht. Im Alter über 60 Jahre sind fast ebenso viele (45 %) betroffen und nur ein geringer Teil, nämlich 1/25 oder 4 %, sind im Kindes- und Jugendalter.
Abb. 21: Altersverteilung der Hörgeschädigten (aus: Krüger 1991, 26)
Abb. 22: Übersicht über die Lebensalter, in denen die Gehörlosigkeit eintritt (bzw. festgestellt wird) (aus: Heese 1961, 14)
Heese (1961, 13f) verwies darauf, dass die Lebensalter, in denen Gehörlosigkeit oder Ertaubung am häufigsten eintritt, im frühen Kindes- und im höheren Alter liegen. Von ihm stammt Abbildung 22, die ein sprunghaftes Anwachsen von Hörschäden jenseits des 50. Lebensjahres zeigt. Ähnliche Aussagen trifft Heese auch in späteren Publikationen. So verweist er auf „im Erwachsenenalter mehr als 0,05 % Gehörloser der Jahrgänge mit stark zunehmend höherem Prozent-Anteil nach dem fünften Lebensjahrzehnt“ (Heese 1995, 87).
Für den Altersabschnitt 0 – 5 Jahre (Abb. 22) sei darauf verwiesen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Abbildung (1961) die Früherkennung von Hörschäden nicht mit heutigen Maßstäben gemessen werden kann.
Auf Basis der Statistik der Schwerbehinderten aus dem Jahr 2001 erstellten Streppel et al. (2006) Abbildung 23. Erfasst wurden hier Personen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 %. Aus der Abbildung werden – wie schon bei Heese 1961 – ein deutliches Ansteigen ab etwa dem fünften Lebensjahrzehnt und eine höhere Betroffenheit von Männern deutlich.
Statistik: Beginn des 20. Jahr hunderts Aus historischer Sicht sei noch auf Statistiken Anfang des 20. Jahrhunderts verwiesen:
■ Nach der Volkszählung des Deutschen Reiches 1900 machten die „Taubstummen“ einen Anteil von 0,86 % aus; es gab also 8,6 Taubstumme auf 10.000 Einwohner. Für das Jahr 1925 wird ein Anteil von 0,69 %, also 6,9 Taubstumme auf 10.000 Einwohner, angegeben (Schumann 1929, 13). Heese (1961, 12) gibt unter Verweis auf die gleiche Volkszählung für das Jahr 1925 0,73 % an (unter Bezug auf: Statistik d. Dtsch. Reiches. Bd. 419 [Die Gebrechlichen im Dtsch. Reich n. d. Zählung v. 1925/26] Berlin [Statist. Reichsamt 1932, 408]).
■ Bereits Schumann (1929, 13) verwies auf erhebliche Abweichungen in den Durchschnittszahlen unterschiedlicher Länder. Beispielhaft sei auf folgende Angaben verwiesen:
– Niederlande (1869): 3,35 Taubstumme auf 10.000 Einwohner
– Luxemburg (1922): 5,98 Taubstumme auf 10.000 Einwohner
– Schweiz (1870): 24,50 Taubstumme auf 10.000 Einwohner
– USA (1890/1910): 6,5/4,48 Taubstumme auf 10.000 Einwohner.
Abb. 23: Schwerbehinderte mit Taubheit bzw. Schwerhörigkeit als schwerster Behinderung pro 100.000 der Bevölkerung 2001 (Streppel et al. 2006, 8)
Aus allen Statistiken wurde deutlich, dass Hörschädigungen keine seltenen Ausnahmeerscheinungen sind, schon rein quantitativ verdienen sie größere Beachtung.
Bei den Angaben des Statistischen Bundesamtes (Tab. 8 und 9) ist zu beachten, dass hier nur Menschen mit Hörschädigung erfasst sind, die nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannt sind. Demzufolge ist von einer weit größeren Anzahl Betroffener auszugehen.
Statistik: Kinder und JugendlicheWie bereits ausgeführt, enthält die Gesamtgruppe der Menschen mit Hörschädigung nur einen vergleichsweise geringen Teil im Kindes- und Jugendalter. Die grundsätzliche Problematik der sehr unterschiedlichen Zahlenangaben verschiedener Statistiken bleibt auch hier bestehen.
Eysholdt (2015) betont, dass es in Deutschland keine genauen Studien über die Prävalenz kindlicher Schwerhörigkeit (es werden hier offensichtlich alle kindlichen Hörschädigungen, also auch die Gehörlosigkeit, gemeint) gibt, abgesehen von epidemiologisch angreifbaren Untersuchungen von Patienten-Interessenverbänden. Schätzungen über die Anzahl von Kindern mit Hörschädigung in sonderpädagogischen Einrichtungen belaufen sich auf etwa 80.000 Kinder, über deren Hörverlust und Altersverteilung wenig bekannt ist.
Nach einer Analyse aktueller angloamerikanischer Studien beziffert Eysholdt (2015) die Inzidenz angeborener Hörschädigung mit 1:10.000. Hinzu kommen erworbene Formen kindlicher Hörschädigungen, die Hirnreifung und Spracherwerb stören (können). Das Risiko für kindliche Hörschäden von 50 dB Hörverlust (und darüber hinaus) kann pauschal mit 1:1.000 angesetzt werden. Gross et al. (1999) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Häufigkeit kindlicher Hörstörungen zwischen 0,9 und 13 %. Um die Datenlage zu verbessern, begann man mit dem Aufbau eines „Deutschen Zentralregisters für kindliche Hörstörungen (DZH)“. Das Zentralregister entstand 1994 als ein drittmittelfinanziertes Projekt und hat 1996 damit begonnen, Kinder mit persistierenden (bleibenden) Hörschäden flächendeckend in der Bundesrepublik zu erfassen. Es befindet sich an der Klinik für Audiologie und Phoniatrie am Universitätsklinikum Benjamin Franklin (Berlin) und hat sich zur Aufgabe gestellt, mit Hilfe eines Patientenregisters eine möglichst realistische Darstellung der epidemiologischen, sozialdemographischen und medizinischen Situation von Kindern mit Hörschädigung zu geben. Nach 20 Jahren waren 14.239 Kinder und (mittlerweile) Erwachsene erfasst. Für die Geburtsjahrgänge 1985 – 1989 (Kohorte I, n=922) betrug das durchschnittliche Alter bei Diagnosestellung 6,2 ± 4,4 Jahre, für die Geburtsjahrgänge 2010 – 2014 (Kohorte II, n=1.123) 1,3 ± 1,3 Jahre und für die Geburtsjahrgänge 2015 – 2017 (Kohorte III, n=230) 0,4 ± 0,3 Jahre (Kugelstadt et al. 2017). Diese Entwicklung betraf am deutlichsten geringgradige Hörschäden, also jene mit weniger als 40 dB Hörverlust. Das Alter bei Diagnosestellung und die Zeit bis zur therapeutischen Versorgung konnten also deutlich reduziert werden.
Probst (2008b, 181) nennt für Hörschäden von relevantem Ausmaß eine Häufigkeit von ca. 1 von 1.000 Neugeborenen bei der Geburt. In den folgenden Lebensjahren steigt die Zahl der Kinder mit bleibenden Hörschäden um 50 – 90 %. Im Schulalter sind dann etwa zwei von 1.000 Kindern betroffen. Nicht eingerechnet sind hier vorübergehende Hörstörungen, die im Kleinkind- und Vorschulalter (insbesondere durch Mittelohrentzündungen) gehäuft vorkommen. Eysholdt (2015, 435) verweist aus medizinischer Sicht darauf, dass eine „Schwerhörigkeit im Kindes- und Jugendalter als relativ häufige Erkrankung angesehen werden“ muss.
Die Tabellen 10 – 12 stellen – trotz der gegenwärtig noch immer bestehenden Schwierigkeiten – den Versuch dar, dem Leser ein ungefähres Bild über die Häufigkeit des Vorkommens von Hörschäden im Kindes- und Jugendalter zu vermitteln. Ein völliger Verzicht auf derartige Zahlenangaben wird nicht möglich sein, da sie z. B. als Grundlage für sozialpädiatrische, schulpolitische oder organisatorische Maßnahmen genutzt werden müssen.
Tab. 10: Angaben zum Anteil hörgeschädigter Kinder und Jugendlicher in der BRD
| Literatur | betrachtete Population | Anteil der betrachteten Population | Bezugspopulation |
| Krüger (1982, 38) | kindliche Hörstörungen | 3 – 5 % | alle altersgleichen Kinder und Jugendlichen |
| Krüger (1991, 27) | mittel- bis hochgradig schwerhörige und gehörlose Kinder | 0,1 – 0,5 % | alle Gleichaltrigen |
Tab. 11: Angaben zum Anteil gehörloser Kinder und Jugendlicher (geordnet nach dem Erscheinungsjahr der zitierten Literatur; Anmerkung: Die Publikation von Bach 1995 [inzwischen in 15. Auflage], aus der Heese zitiert wurde, scheint seit Jahren nicht neu bearbeitet worden zu sein)
| Literatur | betrachtete Population | Anteil der betrachteten Population | Bezugspopulation |
| Sander (1973, 60) | gehörlose Schüler der Klasse 1 – 10 | 0,05 % | altersgleiche Schul-pflichtige |
| Pöhle (1990, 42) | gehörlose Kinder | 0,044 % | Gesamtheit der Schulpflichtigen |
| Krüger (1991, 27) | gehörlose Schüler | 0,04 % | alle Gleichaltrigen |
| Pöhle (1994, 23) | Gehörlose | 0,04 – 0,05 % | Geburtsjahrgang |
| Biesalski (1994, 53) | hochgradig hörgeschädigte Kinder, die Sprache spontan nicht erlernen können | 0,03 – 0,04 % | Kinder von 1 bis 12 Jahren |
| Heese (1995, 87) | gehörlose Kinder und Jugendliche | 0,05 % | Schulpflichtalter |
| Wisotzki (1998, 36) | gehörlose Kinder und Jugendliche | 0,04 % | schulpflichtige Bevölkerung |
Tab. 12: Angaben zum Anteil schwerhöriger Kinder und Jugendlicher (geordnet nach dem Erscheinungsjahr der zitierten Literatur; Anmerkung: Die Publikation von Bach 1995 [inzwischen in 15. Auflage], aus der Jussen zitiert wurde, scheint seit Jahren nicht neu bearbeitet worden zu sein)
| Literatur | betrachtete Population | Anteil der betrachteten Population | Bezugspopulation |
| Sander (1973, 66) | sonderschulbedürftige Schwerhörige der Klassen 1 – 10 | 0,25 – 0,30 % | altersgleiche Schulpflichtige |
| Jussen (1974, 211) | sonderschulbedürftige Schwerhörige im Grundschulalter | 0,25 % | altersgleiche Schulpflichtige |
| Pöhle (1990, 43) | schwerhörige und im Sprachbesitz ertaubte Kinder, die die Schwerhörigenschule besuchen | 0,11 % | Gesamtheit der Schulpflichtigen |
| Jussen (1995, 115f) | schwerhörige Kinder und Jugendliche | 4 – 6 % | alle Kinder und Jugendliche |
| sonderschulbedürftige schwerhörige Kinder und Jugendliche | 0,25 % | schwerhörige Kinder im schulpflichtigen Alter | |
| Biesalski (1994, 53) | mittelgradig schwerhörige Kinder | 0,5 – 1 % | Kinder von 1 – 12 Jahren |
| leichtgradig schwerhörige Kinder (zumeist schallleitungsbedingte Hörstörungen) | 3 – 4 % | Kinder von 1 – 12 Jahren |
Die Tabellen können ein ungefähres Bild der Anzahl der Kinder mit Hörschädigung vermitteln. Im Schuljahr 2015/16 besuchten ca. 45 % aller sich im Schulalter befindlichen Kinder und Jugendlichen mit Hörschädigung die allgemeine Schule (nach KMK 2016a, b) – für die die sonderpädagogische Begleitung sichergestellt werden muss. Nicht erfasst werden von genannten Statistiken all jene Kinder, die zwar hörgeschädigt sind, aber ohne sonderpädagogische Begleitung – zum Teil sogar unerkannt – allgemeine Einrichtungen besuchen. So verweist Claußen (1995, 19) auf eine erhebliche Dunkelziffer von Kindern, die nicht als schwerhörig bekannt werden.
Rechnet man den Personenkreis mit einseitigen und geringen beidseitigen Hörschäden hinzu und beachtet man, dass zum Vorkommen zentraler Hörstörungen kaum Zahlen vorliegen, muss die insgesamte Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigung tatsächlich als relativ hoch angesehen werden.
Statistik: Förderschulbesuch Abschließend sollen noch einige Informationen über den Anteil der eine Förderschule (früher Sonderschulen) bzw. ein Förderzentrum besuchenden gehörlosen und schwerhörigen Schüler (bezogen auf die Gesamtzahl der Schüler an Förderschulen im Pflichtschulalter) gegeben werden (Tab. 13). Nachdem der Anteil der Schüler an Förderschulen (insgesamt) bis 1975 stark angestiegen war, hat er sich seither kaum verändert; er liegt bei knapp über 4 % (Cortina et al. 2003, 766f). Seit dem Schuljahr 1999/2000 wird auch die Zahl der Schüler mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen erfasst. Sie schwankt je nach Förderschwerpunkt und Bundesland erheblich. Danach liegt die Quote aller Schüler, die entweder an Förderzentren oder an allgemeinen Schulen sonderpädagogische Förderung erhalten, bei über 5 Prozent (Cortina et al. 2003, 768). Zu entnehmen ist der Tabelle auch, dass der Anteil der Schüler mit Hörschädigung (neben den Schülern mit Sehschädigung) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler, die eine Förderschule besuchen, vergleichsweise gering ist. (Etwa die Hälfte der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind solche mit Förderbedarf Lernen. Sie besuchen Klassen bzw. Förderschulen für Lernbehinderte.)
Tab. 13: Schüler an Sonderschulen in Prozent aller Schüler im Alter der Vollzeitschulpflicht (Klassenstufen 1 – 10) in den Jahren 1975 – 2003 (Anmerkung: bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1995 Deutschland) (KMK 2005 a und frühere Jahre in Cortina et al. 2008, 522)
| Schulbesuchsquoten nach Förderschwerpunkten 1975 bis 20031 | |||||||
| Förderschwerpunkte | Schulbesuchsquoten2 | ||||||
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |
| Lernen | 3,21 | 2,89 | 2,53 | 2,13 | 2,42 | 2,53 | 2,58 |
| Sonstige | 0,93 | 1,30 | 1,66 | 1,90 | 1,86 | 2,07 | 1,90 |
| Sehen | |||||||
| Blinde | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Sehbehinderung | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ||||
| Hören | |||||||
| Gehörlose | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Schwerhörige | 0,08 | 0,09 | 0,08 | ||||
| Sprache | 0,10 | 0,17 | 0,28 | 0,36 | 0,34 | 0,38 | 0,40 |
| Körperliche und motorische Entwicklung | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
| Geistige Entwicklung | 0,40 | 0,55 | 0,64 | 0,59 | 0,62 | 0,71 | 0,79 |
| Emotionale und soziale Entwicklung | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,34 |
| Kranke | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,09a | 0,10 | 0,17 |
| Förderschwerpunkt übergreifend bzw. ohne Zuordnung | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,11 | |
| Zusammen | 4,14 | 4,19 | 4,20 | 4,03 | 4,28 | 4,60 | 4,84 |
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1995 Deutschland
2 Schüler an Förderschulen in Prozent aller Schüler im Alter der Vollzeitschulpflicht (Klassenstufen 1 bis 10)
a Ohne Sachsen
Interessant scheinen noch einige ergänzende Informationen, auf die in verschiedener Literatur verwiesen wird. Sie sollen mit angeführt werden, da sie die bereits getroffenen Aussagen ergänzen und differenzieren. Nachfolgende Ausführungen basieren vorzugsweise auf Krüger (1991), der sich wiederum auf verschiedene weitere Literatur stützt.
GeschlechterverteilungBei den Menschen mit Hörschädigung überwiegt das männliche gegenüber dem weiblichen Geschlecht etwa im Verhältnis 5:4 (neben Krüger auch Wisotzki 1998, 36). Wisotzki begründet das damit, dass Jungen insgesamt häufiger von den genannten Ursachen für Hörschädigungen (Kap. 3.3) betroffen werden als Mädchen.
Nach Krüger tritt der Unterschied verstärkt bei der schwerhörigen Schülerschaft auf; bei Gehörlosen ist dieser Überschuss männlicherseits recht gering.
Beide Aussagen finden sich in den Datensätzen des Deutschen Zentralregisters für kindliche Hörstörungen (DZH) bestätigt. Deren statistische Auswertung lässt erkennen, dass der prozentuale Anteil der Jungen höher ist als der von Mädchen: Von den gemeldeten Kindern und Jugendlichen mit beidseitiger Hörstörung sind 54,5 % männlich. Bei der Aufschlüsselung nach Geschlecht und Grad der Hörschädigung ist der Jungenüberhang bei leichten und mittleren Hörstörungen etwas deutlicher (Spormann- Lagodzinski et al. 2003).
Widersprüchliche Aussagen gibt es zur Geschlechterverteilung bei Personen mit Altersschwerhörigkeit: Krüger (1991, 28) spricht mit Bezug auf das o. g. Verhältnis von 5:4 von einer gewissen Umkehrung dieses Verhältnisses bei der Altersgruppe über 65 Jahren. Tesch-Römer/ Wahl (1996, 7) verweisen in ihrer Publikation auf die Framingham-Studie, die Personen mit Hörschädigung über 60 Jahre erfasste. Von den betroffenen Personen waren 32,5 % Männer und 26,7 % Frauen, so dass Männer eine höhere Prävalenzrate zeigen.
Pearson et al. (1995 nach Spormann-Lagodzinski et al. 2003) stellen fest, dass bei Männern der altersbedingte Hörverlust früher einsetzt und schneller fortschreitet als bei Frauen. Diese Aussage gilt auch dann noch, wenn Personen mit möglicher Lärmschwerhörigkeit ausgeschlossen werden.
Schumann (1929, 14) verweist mit Blick auf die Volkszählung von 1900 auf „54,1 % männliche Taubstumme bei sonstigem, nicht unbeträchtlichem Überwiegen des weiblichen Geschlechts“. Des Weiteren sind bei ihm folgende Zahlenverhältnisse zu finden:
1906 in Bayern 52,6 % männlich, 47,4 % weiblich
1910 in den USA 54 % männlich, 46 % weiblich
SchichtzugehörigkeitWie auch bei anderen Gruppen von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf lässt sich bei der Gruppe der gehörlosen, insbesondere aber bei den schwerhörigen Schülern in der Bundesrepublik Deutschland eine deutliche Überrepräsentation der niedrigen Sozialschichten der Elternhäuser feststellen (Krüger 1991, 28). Wisotzki (1998, 37) spricht davon, dass bei der Gruppe der Gehörlosen die untere soziale Schicht leicht überrepräsentiert ist.
Mit Bezug auf amerikanische Studien verweisen Streppel et al. (2006, 10) darauf, dass auch das soziale Umfeld während der frühkindlichen Entwicklung die Häufigkeit einer Hörschädigung beeinflusst. In sozial schwachen Gebieten wurden die höchsten Inzidenzen gefunden.
FamiliensituationIn Bezug auf die Familiensituation Gehörloser kann auf drei Prozentwerte verwiesen werden:
■ 90 % kommen aus Familien, in denen keine weiteren Familienmitglieder hörgeschädigt sind.
■ 90 % heiraten einen Partner mit Hörschädigung (Krüger 1991, 29) bzw. einen gehörlosen Partner (Wisotzki 1998, 37).
■ 90 % aller Kinder aus Ehen, in denen beide Partner gehörlos sind, sind hörend.
Einer Erhebung von Große (2003) zufolge benutzen von den Familien, in denen beide Eltern oder ein Elternteil gehörlos ist, 2,3 % die Deutsche Gebärdensprache als primäres Kommunikationsmittel.
3.5 Übungsaufgaben zu Kapitel 3
Aufgabe 9In welche drei Abschnitte wird das Ohr grob unterteilt?
Aufgabe 10Wie erfolgt die Schallaufnahme und -weiterleitung im Ohr?
Aufgabe 11Was versteht man unter „Physiologie des Hörens“?
Aufgabe 12Warum sind frühe Hörerfahrungen für die Ausreifung des auditorischen Cortex wichtig?
Aufgabe 13Welche Arten der Hörschädigung sind zu unterscheiden?
Aufgabe 14Für welche der Arten von Hörschädigung besteht vorrangig sonderpädagogischer Förderbedarf?
Aufgabe 15Wie stellt sich eine
a) Schallleitungsschwerhörigkeit
b) Schallempfindungsschwerhörigkeit
c) kombinierte Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit im Audiogramm dar?
Aufgabe 16Wie wurde die Hörschwelle bei (normal-)hörenden Menschen festgelegt?
Aufgabe 17Wie kann man das Ausmaß des Hörverlustes einteilen?
Aufgabe 18Nennen Sie Ursachen von Hörschäden!
Aufgabe 19Was lässt sich über die Verbreitung von Hörschäden (Häufigkeit) aussagen?