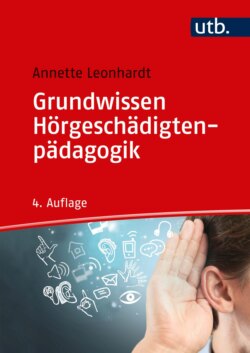Читать книгу Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik - Annette Leonhardt - Страница 9
Оглавление1 Wer ist hörgeschädigt?
Hören ist eine Fähigkeit, deren Bedeutung der Mensch mit einem voll funktionsfähigen Gehör fast immer unterschätzt. Spontan macht sich kaum jemand Gedanken darüber, in welchem Maß die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beeinträchtigt wird, wenn das Hören ausfällt oder nur eingeschränkt möglich ist. Je länger man jedoch über eingeschränktes oder ausgefallenes Hören nachdenkt, umso mehr wird die Tragweite bewusst: Der zwischenmenschliche Kontakt erlebt erhebliche Beeinträchtigungen; die Kommunikation mit anderen Menschen kann nicht ungehindert ablaufen.
Für den Normalhörenden ist es in der Regel etwas Selbstverständliches, dass er die Sprache anderer Menschen hören und verstehen kann, dass er sein eigenes Sprechen und Singen zu hören und zu kontrollieren vermag und dass es ihm zu jeder Zeit möglich ist, eine Vielzahl von Klängen und Geräuschen (z. B. Tierlaute, Naturerscheinungen, Warnsignale, Maschinenlärm) wahrzunehmen. Den Wert des Hörens für die Entwicklung eines Menschen erkennt man eigentlich erst dann, wenn die Funktionstüchtigkeit des Hörorgans herabgesetzt oder wenn es gänzlich funktionsuntüchtig ist.
Einige Fallbeschreibungen sollen erste Informationen bieten und mögliche Auswirkungen illustrieren. Lassen wir – um eine konkrete Anschauung der Situation zu vermitteln – fünf sehr unterschiedliche Beispiele wirken:
Fallbeschreibung 1: Johannes L., 4;6 Jahre, hochgradig schwerhörig beiderseits
Johannes kam als erstes Kind nach komplikationsloser Schwangerschaft auf die Welt. Er entwickelte sich zunächst außerordentlich gut. Er war gleichaltrigen Kindern in vielen Entwicklungsschritten überlegen, so konnte J. mit 6 Monaten krabbeln und mit 9 Monaten frei laufen. Er war aufgeweckt und freundlich.
Mit ca. 9 Monaten begann er zu lallen und babbelte Silben wie „dadada“. Mit 1;6 Jahren sprach er einige (wenige) Wörter, z. B. Auto, hei (heiß), gah (Kran) oder dada (Papa). Sein Wortschatz vergrößerte sich jedoch nicht. So konnte J. mit knapp 2 Jahren noch immer keine weiteren Wörter sprechen. Da J. sich aber in allen anderen Bereichen gut weiterentwickelte, waren die Eltern zunächst nicht beunruhigt und dachten, wie auch Verwandte und Freunde der Familie, dass er zum Sprechenlernen etwas länger brauche.
Da J. aber auch nicht auf das Zurufen seines Namens reagierte, wurden die Eltern zunehmend verunsichert, und es kam ihnen der Gedanke, dass er vielleicht nicht gut hören könne. Sie stellten J. daraufhin dem Kinderarzt vor, der ihnen zunächst riet, noch ein Vierteljahr abzuwarten und, falls J. dann noch nicht spricht, einen Hörtest machen zu lassen.
Da J. nach diesen 3 Monaten immer noch nicht mehr sprach, überwies der Kinderarzt die Eltern an die für den Wohnort zuständige Universitätsklinik, um dort einen Hörtest und eine BERA (Hirnstammaudiometrie) durchführen zu lassen.
Der Verdacht der Schwerhörigkeit bestätigte sich: J. war beidseitig hochgradig schwerhörig.
J. bekam mit 2;6 Jahren die ersten Hörgeräte. Zeitgleich setzte die Früherziehung mit einer Stunde pro Woche ein. Die Hörgeräte wurden von J. von Anfang an gut akzeptiert; es zeigte sich sehr bald, dass er mit ihnen etwas wahrnehmen kann. Er reagierte auf Zurufe und sprach nach zwei Monaten Wörter nach. Sein Wortschatz begann rasch anzuwachsen.
Im folgenden halben Jahr wurden noch andere Hörgeräte ausprobiert. Die Hörgeräte, die er heute trägt (mit 4;7 Jahren), besitzt er seit dem 3. Lebensjahr.
Mit 3;6 Jahren kam J. in einen Waldorfkindergarten. Seit dieser Zeit wuchs sein Wortschatz rasch an. Er kommt im Kindergarten gut zurecht, kann sich mit den anderen Kindern verständigen und wird von ihnen akzeptiert. Für sein Alter hat er einen vergleichsweise umfänglichen Wortschatz und spricht vollständige Sätze. Seine Aussprache ist oft noch verwaschen, sein Sprachverständnis ist gut.
Die Entwicklungsperspektiven sind gegenwärtig noch offen. Die Eltern hoffen auf einen Besuch der allgemeinen Schule (nach: HörEltern 1998, 7 – 9).
Fallbeschreibung 2: Kristina Sch., hochgradig schwerhörig, an Taubheit grenzend, Studentin des Lehramts an Sonderschulen mit der vertieft studierten Fachrichtung Gehörlosenpädagogik
Sie beschreibt ihr Leben so: „Der Hörverlust ist auf der rechten Seite etwa 95 dB und auf der linken Seite 110 dB. Ich habe nur sehr geringe Hörreste, die ich aber mit meinen HdO-Geräten beiderseits sehr gut verwerten kann.
Als ich ungefähr 9 Monate alt war, bekamen meine Eltern langsam den Verdacht, dass ich nicht hören könne. Sie bemerkten, dass ich immer weniger und monotoner lallte, anstatt in die 2. Lallperiode zu gelangen. Außerdem habe ich immer seelenruhig weitergeschlafen, obwohl in der Nachbarschaft die Kinder sehr laut waren. Daraufhin experimentierten meine Eltern selbst mit mir, ob ich auf Geräusche reagieren würde. Das war sehr schwierig, da ich relativ schnell mit den Augen bin. Da sich ihr Verdacht bestätigte, wurden sie vom Kinderarzt zu einem HNO-Arzt vermittelt. Nach dessen Diagnose, dass ich ,stocktaub’ sei, wurde ich in die Universitätskliniken in Würzburg überwiesen. Dort wurde dann die Diagnose ,hochgradige, an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit’ gestellt. Für meine Eltern war es natürlich ein großer Schock. Dennoch fassten meine Eltern den Entschluss, dass sie mich nicht als Behinderte behandeln wollten, sondern wie ein normales hörendes Kind. So war für sie der wichtigste Grundsatz: ,Wir werden unser Kind so behandeln, als ob es nicht behindert wäre.’ Damit ist gemeint, dass sie mich nicht übermäßig behüten wollten oder mir etwas erlaubten, was sie mir normalerweise nicht erlaubt hätten, und dies nur taten, weil sie Mitleid mit mir hatten, so nach dem Motto: ,Ach, lass das Kind, es kann ja nicht hören.’
Ich war in meinen ersten Lebensjahren ein recht ,wildes’ Kind: Ich rannte oft durch den Garten oder spielte mit meinem Vater. Ich hatte auch viele hörende Spielkameraden. Mein Vater hat mich oft durch die Luft geworfen, auf dem Spielplatz habe ich wie jedes andere Kind herumgetobt. Mir kam damals nie ins Bewusstsein, dass ich nicht normal höre wie die anderen Kinder.
Mit etwa 11 Monaten habe ich mein erstes Hörgerät bekommen: ein Taschengerät. Ich habe es sehr oft getragen. Es ist so zum festen Bestandteil meines Lebens geworden, dass ich mich heute sehr unwohl und hilflos fühle, wenn ich nichts höre.
Zu diesem Zeitpunkt kam ich zur Frühförderung an die Frühförderstelle in Würzburg. So mussten wir regelmäßig nach Würzburg fahren, da wir damals noch in Hofheim in den Haßbergen wohnten.
Wenn ich (etwa mit 2 Jahren) etwas wollte, beispielsweise Limo, dann habe ich es mit einer Geste und einem Gesichtsausdruck ausgedrückt. Meine Mutter hat mir daraufhin Limo gegeben und dabei ,Limo’ gesagt und dabei meine Aufmerksamkeit auf ihren Mund gezogen. Immer wieder hat sie mir die Namen von den verschiedenen Dingen genannt. Immer, wenn ich zu ihr geschaut habe, hat sie mit mir gesprochen, auch wenn ich ,nichts’ hörte. Wenn ich nicht geschaut habe, hat sie nichts gesagt. So lernte ich allmählich das Absehen und mein Restgehör zu verwerten.
Auch hat meine Mutter mich auf diverse Geräusche aufmerksam gemacht, zum Beispiel auf Hammerschläge, wenn mein Opa etwas zusammengebaut hat. Oder auf den Krach der Bohrmaschine, wenn mein Vater ein Loch in die Wand gebohrt hat. Kurze Zeit später nahm ich den Bohrlärm sehr deutlich wahr.
Mit der Zeit habe ich versucht, das, was meine Mutter mir sagte, nachzuahmen. Ein Beispiel: Wir gingen oft spazieren. Immer, wenn meine Mutter uns fertig angezogen hatte, sagte sie: ,Ab die Post’, und wir gingen los. Etwa mit 2 Jahren sagte ich dann etwas, das wie ,abberpod’ klang. Dazu kam, dass ich mit 2 Jahren eine kleine Schwester bekam, die, wie sich später herausstellte, auch eine hochgradige, an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit hat. So bekam ich mit, dass meine Mutter sie genauso behandelte wie mich.
Ich möchte hier betonen, dass ich nichts anderes kannte als das, was mir meine Mutter beibrachte. Es fiel mir nicht auf, dass ich anders sprach als die anderen Kinder oder dass ich das Sprechen anders lernte als andere Kinder. Für mich war dies der ganz normale Alltag.
Zum Sprechenüben benutzten wir auch zu Hause einen Phonator. Einmal haben meine Schwester und ich mit unseren Puppen Sprechunterricht gespielt. Da war ich etwa 4 Jahre alt. Daran erkennt man ganz deutlich, wie sehr diese Geräte und das Sprechenlernen in unser Leben integriert waren, dass wir es als etwas ganz Normales angesehen haben.
Zum Beispiel dachte ich immer, dass Kinder nicht telefonieren können, nur die Erwachsenen, da ich ja keine Kinder telefonieren gesehen habe. Als ich dann ein Kinderlexikon zu meinem 8. Geburtstag bekam, sah ich unter dem Wort ,Telefon’ ein Bild, wie ein Junge mit seinem Vater telefonierte. Da wurde mir klar, dass andere Kinder telefonieren können bzw. später können werden. Ich habe dann meine Mutter gefragt und sie hat es bestätigt. Da war ich schon etwas traurig, und mir wurde meine Hörbehinderung richtig bewusst, vielleicht zum ersten Mal.
Der tägliche Umgang mit der Sprache hat mir sehr viel gebracht, da ich es nicht als ,Du musst’, sondern als etwas Alltägliches empfunden habe. Beim Essen zum Beispiel haben wir oft miteinander gesprochen. Dies war und ist immer noch für meine Eltern und mich das Wichtigste. Meine Mutter kannte mein Wortschatzniveau gut, und so verwendete sie Wörter, die ich kannte, und fügte so nach und nach neue Wörter hinzu. Dabei bewegte sie sich an der obersten Grenze meines Wortschatzes.
Was auch ganz wichtig war, ist, dass wir oft Bilderbücher angesehen haben. Meine Mutter hat mir oft vorgelesen, so sah ich, dass die Geschichten aus den Büchern kamen. Oft waren wir in der Stadtbücherei, um Bilderbücher anzusehen. Hinzu kommt, dass meine Eltern beide sehr gern lesen und so zu Vorbildern für mich wurden. Zuerst waren da die reinen Bilderbücher, dann die Bilderbücher mit Text, dann verschwanden die Bilder allmählich, dann hatte ich Bücher, die noch einige Bilder beinhalteten, zum Beispiel Enid-Blyton-Bücher, schließlich las ich dann auch bilderlose Bücher.
Als ich in die Dr.-Karl-Kroiß-Schule Würzburg kam, besaß ich bereits einen sehr großen Wortschatz, ich konnte auch sprechen, aber sehr verwaschen. Das richtige Artikulieren habe ich dann in der Schule gelernt. Dort wurde lautsprachlich unterrichtet, aber für mich war das nichts Neues und somit auch nicht so anstrengend und mühevoll wie für andere gehörlose Kinder.
Als ich in der Schule lesen lernte, konnte ich meinen riesigen Wortschatz noch besser verwenden. Und ich las gern! Dies hat höchstwahrscheinlich zu einem relativ guten Grammatikverständnis und einer weiteren Verbreiterung meines passiven Wortschatzes beigetragen. Lesen tue ich immer noch sehr gerne. Und ich finde, es hat mir sehr viel gebracht.
Nach der Schule war immer ,Erzählstunde’ beim Mittagessen. So erfuhr meine Mutter auch, wie weit ich in der Schule gekommen bin und hat an dem neu Gelernten angeknüpft, um das Gelernte zu vertiefen.
Wichtig war: Ich wurde ganz normal behandelt und erzogen, als ob ich keine Hörbehinderung hätte, und nebenbei wurde mir im normalen Alltag die Sprache beigebracht, ich kannte also nichts anderes. Ich empfand das Sprechenlernen nicht als ,Du musst’, sondern als etwas ganz Normales, Spielerisches. Die Bücher waren mir bei der Erlernung und Vertiefung der deutschen Sprache und Grammatik eine sehr große Hilfe“ (aus: Schunk 1998, 198ff).
Mit dem Aufkommen des Neugeborenenhörscreenings kommt es zu Veränderungen:
Fallbeschreibung 3: Die Mutter von Matthias, 16 Jahre, im Säuglings-/Kleinkindalter beidseitig mit Cochlea Implantaten versorgt, berichtet:
Matthias erkrankte an seinem ersten Lebenstag an einer Neugeboreneninfektion, die durch eine Therapie mit Antibiotika behandelt wurde. Wahrscheinlich ist durch diese antibiotische Behandlung das Innenohr beidseits geschädigt worden. In der Universitätsklinik W., in der Matthias auf die Welt kam, wurde damals bei allen Neugeborenen bereits eine BERA durchgeführt, obwohl das Neugeborenenhörscreening zu dieser Zeit noch nicht verpflichtend war. Er war in der Untersuchung auffällig, die Verdachtsdiagnose einer hochgradigen Schwerhörigkeit wurde gestellt.
Im Alter von gut vier Monaten fand eine Untersuchung in Narkose statt und die Verdachtsdiagnose bestätigte sich. Matthias war hochgradig schwerhörig, an Taubheit grenzend.
An diesem Tag ging für meinen Mann erst einmal die Welt unter. „Wie wird das mit der Schule, der Ausbildung, dem Studium, der Arbeit, dem Leben für ihn?” Er dachte in ganz anderen Dimensionen als ich. Aber wir hatten viel Glück im ‚Unglück’. Wir waren in der HNO-Universitätsklinik W. sehr gut aufgehoben. Die Vernetzung zur Frühförderstelle für Hörgeschädigte war ausgezeichnet und wir bekamen dort zeitnah einen Termin. Matthias erhielt seine ersten Hörgeräte. Unsere ‚Frühförderin’ war wieder ein Glückstreffer! Sie hat uns vor allem in den ersten Monaten in unserem normalen Umgang mit Matthias bestärkt und Hilfestellungen gegeben. Er hat sich trotz der Hörschädigung zu einem äußerst fröhlichen und aufgeweckten (im wahrsten Sinne des Wortes) Säugling entwickelt. Im Alltag, der Frühförderung und den Hörtests in der Pädaudiologie hat sich dann schon relativ schnell gezeigt, dass er nicht ausreichend von den Hörgeräten profitieren konnte. Wir wurden über die verschiedenen Möglichkeiten, u. a. eine Versorgung mit Cochlea Implantaten (CI) informiert. Für diese Möglichkeit haben wir uns dann relativ schnell entschieden. Im Alter von gut acht Monaten erhielt Matthias sein erstes CI, was damals noch eher ungewöhnlich war. Die nächsten sechs Wochen waren geprägt von erwartungsvoller Unruhe, dann war der große Tag der Erstanpassung des Sprachprozessors gekommen: der ‚Anschluss an die akustische Umwelt‘. Das war für uns ein unvergesslicher Moment! Das CI wurde eingeschaltet, Matthias hob den Kopf und schaute erstaunt. Er hat das CI von da an am Kopf belassen, war aufmerksam bei den Anpassungen und begeistert von seinem ‚geräuschvollen‘ Alltag, vor allem aber von der Frühförderung. Die Sprachentwicklung verlief rasant. Nach ein paar Wochen das erste bzw. die ersten Wörter: ‚Dreht sich‘. Dann kam eigentlich fast täglich ein neues Wort, schnell kleine Sätze, zum Teil schneller als bei gleichaltrigen Normalhörenden. Etwa zeitgleich begann die Rehabilitationsmaßnahme im CIC in W. Anfangs war er in einer Gruppe mit lauter Kindergarten- und Schulkindern. Kleinkinder mit CIs gab es damals noch kaum.
Ein halbes Jahr nach der ersten CI-Operation sollte die OP auf der anderen Seite folgen. Intraoperativ stellte sich jedoch heraus, dass Matthias eine versteckte Mastoiditis (Entzündung des Warzenfortsatzes) hatte und die Implantation zunächst nicht erfolgen konnte. Knapp ein Jahr nach seinem ersten CI erhielt er dann sein zweites. Unsere Rehagruppe verjüngte sich, es waren endlich mehr Gleichaltrige wie Matthias mit CIs versorgt.
Aus beruflichen Gründen mussten wir zu Beginn der Kindergartenzeit unsere gewohnte Umgebung und unser gutes Netzwerk hinsichtlich der Versorgung von Matthias verlassen. Der Kindergarten in unserem neuen Wohnort war bereit, ihn als ‚Integrationskind‘ aufzunehmen und es hat wunderbar geklappt. Die Frühförderung lief in größeren Abständen weiter, ebenso die Reha in W. Die regelmäßigen Treffen mit ‚Gleichgesinnten‘ und Betroffenen war und ist für ihn genauso wie für mich sehr wichtig. Freundschaften sind entstanden.
Wermutstropfen waren eine notwendige Revisionsoperation und häufige Ausfälle des Sprachprozessors bzw. der externen Technik. Nach dem Kindergarten wurde er in die allgemeine Grundschule bei uns im Wohnort eingeschult.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes konstatiert die Mutter: Durch die frühe CI-Versorgung ist ihm (und uns) mittlerweile ein weitgehend ‚normales‘ Leben ermöglicht worden. Matthias geht offensiv und selbstbewusst mit seiner Hörschädigung um.
Fallbeschreibungen über Erwachsene mit Hörschädigung:
Fallbeschreibung 4: Frau X, Mitglied eines Schwerhörigenkreises, schwerhörig
Sie berichtet: „Wie es mir als Schwerhöriger in einem Wartezimmer erging. Heftige Schmerzen im Kopf zwangen mich, den Arzt aufzusuchen. Das linke Ohr war durch eine Erkältung fast taub, am rechten trage ich eine Hörhilfe. Da ich mich auf diese nicht völlig verlassen kann …, schrieb ich alle Beschwerden auf einen Zettel, den ich bei der Anmeldung abgab. Dem Schalter gegenüber nahm ich Platz. Wenn dem Aufruf niemand folgte, fragte ich den Patienten neben mir, ob mein Name gefallen sei. Ich sei noch nicht dran, wurde mir entgegnet. Nach fast drei Stunden vergeblichen Wartens ging ich gleich den anderen für eine knappe Stunde nach Hause, um das Mittagessen anzusetzen; 15 Patienten waren noch vor mir. Als ich zurückkam, waren es noch fünf. Diese wurden nacheinander aufgerufen, zwei nach mir Angemeldete folgten, worauf ich im Sprechzimmer fragte, ob meine Karte verlegt sei. Fünfmal sei ich aufgerufen worden, aber niemals gekommen, sagte der Doktor vorwurfsvoll. Ich entschuldigte mich, dass ich den Aufrufen nicht gefolgt sei, und wies auf meine schriftliche Mitteilung hin.
Einer Sehschwachen gegenüber wären die Patienten wohl hilfsbereiter gewesen als mir, der Schwerhörigen. Ähnliches geschieht täglich und stellt unser Vertrauen zu gesunden Menschen auf eine harte Probe“ (aus: Fink 1989, 13f).
Fallbeschreibung 5: Martina J., CI (Cochlea-Implantat)-Trägerin, promoviert, tätig in einem großen pharmazeutischen Unternehmen
Frau J. war von Geburt an schwerhörig. Die Ursachen dafür sind unbekannt. Mit 7 Jahren erhielt sie ihr erstes Hörgerät, was aus heutiger Sicht als sehr spät einzuschätzen ist. Mit Hilfe ihrer Mutter, die sich sehr um ihr Kind bemühte, lernte sie gut und verständlich sprechen und wurde trotz ihrer Schwerhörigkeit altersgemäß in eine allgemeine Schule am Wohnort eingeschult.
Es stellte sich bald heraus, dass die Schwerhörigkeit progredient verlief. Dies konnte zunächst durch neue, leistungsstärkere Hörgeräte, die ca. alle 4 – 5 Jahre angepasst wurden, ausgeglichen werden. Im Schulalter nahm Frau J. die fortschreitende Schwerhörigkeit noch nicht bewusst wahr oder – so beschreibt sie es aus heutiger Sicht – sie wurde von ihr ignoriert, da sie so sein wollte, wie die anderen Kinder ihrer Klasse auch.
Trotz ihrer erheblichen Hörprobleme konnte Frau J. erfolgreich das Abitur ablegen, studieren und promovieren. Ab ihrem 30. Lebensjahr bekam Frau J. regelmäßig alle 2 – 3 Jahre Hörstürze, bei denen sich jedesmal ihr Gehör gravierend verschlechterte. Diese ca. 10 – 12 Jahre andauernde Phase endete mit einem weiteren Hörsturz, in dessen Folge sie auditiv kaum noch etwas wahrnehmen konnte. Ihr selber war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass sie „taub“ geworden war. Mit Hilfe ihrer sehr leistungsfähigen Hörgeräte konnte sie noch immer einige tiefe Töne und Signale erfassen, was sie damals als „hören“ interpretierte und aus heutiger Sicht als ein „Kitzeln am Trommelfell“ beschreibt.
Bereits vor ihrer endgültigen Ertaubung hatte Frau J. vom „Cochlea Implantat“ gehört. Sie glaubte jedoch, dass man absolut taub sein müsse, ehe eine Implantation in Frage kommt. Nach näheren Erkundungen stellte sich heraus, dass bei Frau J. eine Implantation sinnvoll zu sein schien, und so ließ sie sich, etwa 13 / 4 Jahre nach der Ertaubung, implantieren. Als Gründe für ihre Entscheidung gibt sie an: „Ich wollte die Isolation, in die ich durch meine Ertaubung geraten war, nicht bedingungslos ertragen und war bereit, einen Versuch und auch ein Risiko einzugehen, um meine Lage zu ändern. Ich spürte als Ertaubte nicht nur meine eigenen Probleme, sondern auch die Probleme, die die Normalhörenden in meiner Umgebung (Familie / Freunde und Kollegen) mit mir hatten.
Ich konnte schon immer relativ gut absehen – das erforderte jedoch nach meiner Ertaubung ständige höchste Aufmerksamkeit, da die Kommunikation fast ausschließlich über ,Sehen’ erfolgte. Klar, dass bei dieser Anspannung und Dauer-Konzentration die Achtsamkeit mal nachließ. Entsprechend mühsam wurde infolgedessen dann die Kommunikation mit mir, wenn ich müde wurde. Absehen allein funktioniert auch nur gut im Zweiergespräch. Wenn mehrere Personen an der Unterhaltung teilnehmen, ist der Faden schnell verloren und die Unterhaltung fand dann meist – trotz aller Proteste – über meinen Kopf hinweg statt.“
Die Operation verlief komplikationslos und dauerte ca. 1 1 / 2 Stunden. Bereits am nächsten Tag konnte Frau J. ohne größere Schwierigkeiten aufstehen.
Schon eine Woche nach der Operation wurde der Sprachprozessor das erste Mal kurz ausprobiert, um zu wissen, ob das Implantat funktioniert. Frau J. beschreibt ihren ersten Höreindruck so: „Es war für mich ein unglaubliches (beeindruckendes) Erlebnis, ganz alltägliche Geräusche zu erkennen und zuordnen zu können. Z. B. das Klingeln eines Telefons oder das Plätschern von fließendem Wasser aus dem Wasserhahn. Ich war überwältigt – das hatte ich nicht erwartet. Nach einer halben Stunde musste ich das Gerät dann leider wieder abgeben, da der Heilungsprozess vor Dauereinsatz des CIs weiter fortgeschritten sein sollte.“
Die eigentliche Anpassung des Sprachprozessors erfolgte ca. vier Wochen nach der Operation.
Ein halbes Jahr nach der Implantation und der Sprachprozessoranpassung beschrieb Frau J. ihr Hören so: „Ich habe die letzten fünf Jahre vor der Operation weniger gehört als jetzt, Vogelgezwitscher, Signaltöne meines Autos, wenn der Sicherheitsgurt nicht geschlossen ist – das alles hörte ich schon lange nicht mehr. Aber jetzt.
Ich konnte mich noch gut erinnern, wie die Geräusche klangen, das kam mir bei der Gewöhnung an das CI zugute.
Als ich das CI neu bekam, klang eine menschliche Stimme etwa so wie eine Computer-Stimme. Ein bisschen künstlich, höher im Ton – aber doch verständlich. Vereinfacht wurde mir das Verstehen durch das Absehen. Je länger ich das CI trage, um so natürlicher erscheinen mir die Geräusche und die Sprache.
Zu Beginn schienen mir die Geräusche bei viel höheren Frequenzen aufzutreten, als ich in Erinnerung hatte, z. B. im Straßenverkehr. Er schien eher zu pfeifen, zu quietschen und zu kreischen als zu brummen. Auch ein Lastwagen dröhnte nicht, sondern kreischte / zwitscherte wie eine streitende riesige Vogelschar. Inzwischen klingt dies aber alles so, wie ich es von früher her kenne.
Musik klingt dagegen immer noch sehr konfus. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es länger dauert, bis ich damit zurecht komme. Musikstücke mit nur einem Instrument sind einfacher zu erkennen als ein von einem Orchester gespieltes Stück. Es ist mir jedoch schon gelungen, am Rhythmus und anhand einiger Töne ,The Yellow Submarine’ von den Beatles aus dem Radio zu identifizieren. Nachdem ich früher Klavierunterricht hatte, probierte ich natürlich auch aus, wie Klaviertöne mit dem CI klingen. Zunächst glaubte ich, dass mein Klavier verstimmt sei. Der einzelne Ton klingt auch nicht ganz rein. Ich bin jedoch optimistisch, dass es nach einiger Gewöhnungszeit immer besser klappen wird.
Telefonieren kann ich heute schon. Dass ich dazu in der Lage bin, gibt mir sehr viel Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, Gelassenheit, die ich jahrelang vermisste.“
Wie hat sich das Leben für Frau J. – fünf Jahre nach der Implantation – verändert? Sie beschreibt es folgendermaßen:
„Vieles ist leichter geworden. Ich fühle mich gelassener, habe mehr Lebensmut, bin zuversichtlicher, fröhlicher und belastbarer als vorher. Es ist für mich ungeheuer befreiend, dass ich nun nicht mehr soviel um Hilfe bitten muss, sondern selber anderen auch helfen kann. Mein neues Selbstbewusstsein bereitete bisher niemandem Probleme. Beispielsweise kann ich telefonieren, um Termine mit dem Friseur, dem Arzt oder mit Freunden zu vereinbaren. Eigentlich Selbstverständlichkeiten für Normalhörende, aber ein Problem für stark Schwerhörige und Ertaubte.“
Frau J. ist in einem pharmazeutischen Unternehmen in der Entwicklung von Diagnostischen Einsatzstoffen tätig. Hier arbeitete sie auch schon vor ihrer Implantation. Diese Arbeitsstelle erfordert viel mündliche Kommunikation, z. B. um Arbeitsvorgänge zu besprechen oder Ideen in Diskussionen mit Kollegen und Mitarbeitern entwickeln zu können. Sie sieht ihre Situation heute so:
„Mit dem Implant kann ich einfach aktiver und spontaner reagieren und auch aktiver an Diskussionen / Gesprächen teilnehmen. Besonders erleichternd ist, dass ich nun vieles telefonisch regeln kann, was früher nur umständlich über Umwege (Auftragstelefonat, Fax, Brief) möglich war.
Die Kommunikation ist für alle leichter geworden, deshalb ist das CI nicht nur für mich, sondern für alle Menschen in meiner Umgebung ein Gewinn“ (nach einem gemeinsamen Gespräch der Autorin mit der CI-Trägerin).
Aus den fünf sehr unterschiedlichen Beschreibungen wird ersichtlich, dass die Auswirkungen und das individuelle Erleben, „hörgeschädigt zu sein“, sehr verschieden sein kann. Sie machen zugleich deutlich, dass die Bezeichnung „hörgeschädigt“ begrifflich unterschiedliche Störungen des Hörorgans zusammenfasst. Darüber hinaus weist praktisch jeder Hörgeschädigte hinsichtlich seines Hörschadens und seiner kommunikativen Situation individuelle Unterschiede und Auffälligkeiten auf.
Reflektiert man einmal darüber, wie oft uns Menschen mit einer Hörschädigung begegnen, müssen wir alsbald zu dem Schluss kommen, dass es weit häufiger geschieht, als es auf den ersten Blick scheint: Im täglichen Leben begegnen uns immer wieder Menschen, die Schwierigkeiten haben, Lautsprache zu verstehen. Manche von ihnen fallen durch unangemessen lautes, andere durch schlecht verständliches oder unverständliches Sprechen oder auch gehäuftes Nachfragen auf. Einige von ihnen tragen Hörgeräte, die durch die Weiterentwicklungen der letzten Jahre inzwischen so klein sind, dass sie für andere kaum noch sichtbar sind. Schließlich begegnen wir auch Menschen, die sich nicht lautsprachlich, sondern durch Gebärdensprache verständigen.
Darüber jedoch, was eingeschränktes Hören oder „Nicht-hören-Können“ für die Betroffenen tatsächlich bedeutet und wie es ihr Leben beeinflusst, sagen die äußerlich auffälligen Merkmale kaum etwas aus. Was dem Hörenden und nicht Sachkundigen auffällt, sind lediglich Symptome. Die eigentliche „Behinderung“ liegt in den inneren psychischen Bedingungen. Sie ergibt sich aus den erheblich veränderten, beeinträchtigten und den teilweise gestörten zwischenmenschlichen Kontakten und Beziehungen. Sehr bekannt ist das Zitat von Immanuel Kant (1724 – 1804):
„Nicht sehen trennt von den Dingen, nicht hören trennt von den Menschen“ (Zitate von Immanuel Kant, o. J.).
Vielleicht kann dieses Zitat die erheblichen Auswirkungen eines eingeschränkten oder ausgefallenen Gehörs verdeutlichen. Insbesondere unterliegt der zwischenmenschliche Kontakt wesentlichen Veränderungen und auch Einschränkungen. Pöhle schätzt die Situation Hörgeschädigter folgendermaßen ein:
„Taubheit bzw. hochgradige Schwerhörigkeit und das Unvermögen, sich laut-(Anm. d. Verf.) sprachlich ungehindert äußern zu können, sind für Nichtbehinderte praktisch nicht vorstellbar; deshalb wird auch kaum eine Behinderung hinsichtlich ihrer psychischen Belastung so sehr unterschätzt wie eine Hörbehinderung; und es gibt wohl keine Gruppe behinderter Menschen, die in so krasser Weise Fehlbeurteilungen unterliegt wie Hörbehinderte“ (1994, 1).
Zusammenfassung
Die Fallbeschreibungen vermitteln Informationen über Personen mit sehr unterschiedlichen Hörschädigungen. Sie machen deutlich, dass die Bezeichnung „hörgeschädigt“ sehr verschiedene Störungen des Hörorgans zusammenfasst. Darüber hinaus weist praktisch jeder Hörgeschädigte hinsichtlich seines Hörschadens und den daraus resultierenden Auswirkungen individuelle Unterschiede und Auffälligkeiten auf.
Frage zum Einstieg:
Reflektieren Sie die fünf Fallbeschreibungen. Welches Fazit können Sie in Bezug auf Hörschäden daraus ableiten?