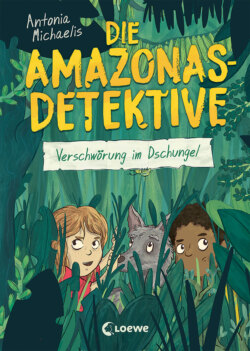Читать книгу Die Amazonas-Detektive - Verschwörung im Dschungel - Antonia Michaelis - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| ERSTES KAPITEL, | |
| in dem Pablo eine Botschaft erhält und der Fluss noch schläft |
Die Villa war marode. Sagten die Leute.
Das bedeutete: Kaputt. Hinüber. Einsturzgefährdet.
Sie stand zwischen anderen weniger kaputten und bunt angestrichenen Häusern – hellblau, gelb, lila, aber die Villa selbst hatte keine Farbe. Und aus den Ritzen wuchsen Bäume, kleine und große: auf dem Dach, den Balkons, aus den Fenstern. Schlingpflanzen umrankten die alten Mauern, Gras bedeckte die Eingangsstufen, kleine lila Blüten regneten durch die Fenster.
Pedro liebte die Villa.
Sie war sein Zuhause.
Bei gutem Wetter schlief er oben auf dem Dach, auf einem kleinen Türmchen. Bei Regen kletterte er durch ein Loch in den Raum darunter. Von dort aus sah man die ganze Stadt, die bunte, laute, chaotische Stadt – und dahinter den Urwald, in der Ferne, grün, unendlich.
Es war der Urwald, der die Villa zurückerobert hatte. Es geschah überall dort, wo etwas von den Menschen verlassen wurde: Die Pflanzen, die vor Jahrtausenden hier gestanden hatten, kamen einfach zurück. Das gefiel Pablo.
Die Villa war wie ein Stück von dem Grün da draußen, ein Stück Wildheit.
Pablo war noch nie dort gewesen.
Im wahren Urwald.
»Eines Tages«, sagte er zu sich selbst, »eines Tages lerne ich ihn kennen. Irgendwo da draußen wartet das Abenteuer.«
Es war ein Dienstag, an dem er das sagte, und er saß auf dem Turm und ließ die Beine baumeln.
Dann nahm er die Spiegelscherbe in die Hand, die neben ihm lag, und wischte sie an seinem schmutzigen T-Shirt ab. Ein Junge von etwa zehn Jahren blickte ihn an, mit wachen dunklen Augen und zimtfarbener Haut, auf der Nase eine lange Schramme, das Gesicht im Allgemeinen nicht unbedingt sauber. Auf dem drahtigen schwarzen Haar saß schräg eine alte schwarze Schiebermütze und unten sah man gerade noch den ausgefransten Ausschnitt des gelbgrünen Fußball-T-Shirts, das bessere Tage gesehen hatte.
Alles in allem, fand Pablo, sah er aus wie ein echter Abenteurer.
»Blöd«, sagte er zu seinem Spiegelbild, »dass ich nie ein Abenteuer erlebe. Ich meine, so abenteuerlich ist es nicht, auf der Straße Leute anzubetteln oder ihnen für Geld Einkäufe nach Hause zu tragen. Es wäre besser, ein reicher Adeliger zu sein. Auf einem Pferd mit Silbersporen. Oder auf einem Dreimaster, an dessen Reling man stolz stehen und fremden Ländern entgegensehen kann. Oder mit dem Degen in der Hand die Schlangen im Urwald zu bekämpfen. Oder …«
Er hielt inne und beugte sich weiter vor.
Da war etwas gewesen, eine Bewegung unten zwischen den Büschen vor der Villa. Ein Schatten …
»Miguel?«, rief Pablo leise. Denn es war Miguel, auf den er da oben auf seinem Turm wartete.
Miguel kam jeden Freitag vorbei, setzte sich zu ihm auf die Stufen vor der Villa und unterhielt sich mit ihm. Meistens brachte er Pablo ein Sandwich oder einen gegrillten Maiskolben mit. Aber am letzten Freitag war er nicht gekommen, was Pablo gewundert hatte.
Miguel war Student.
Er trug eine Brille mit kleinen runden Gläsern und lustigem rotem Rahmen und er hatte so große Träume wie Pablo. Oft saßen sie freitags zusammen auf den Stufen der Villa und träumten: von Abenteuern, von den Meeren und den Sternen und dem grünen Geheimnis des Waldes rund um Manaus, ihre Stadt.
An diesem Tag ahnte Pablo noch nicht, wie bald er den Wald besser kennenlernen würde. Wie bald er in ein Abenteuer hineinrutschen würde. Allerdings ohne Degen und Silbersporen.
»Miguel, bist du das?«, rief Pablo. Niemand antwortete.
Unten in der Villa klirrte etwas. Glas. Eine Scheibe.
Das war seltsam. Pablo begann, außen am Turm an einer Kletterpflanze herunterzuklettern, denn die Treppe unten war seit Langem nicht mehr begehbar.
Unten sprang er ins Gras und zog sein altes Taschenmesser heraus und so schlich er vorwärts, dorthin, woher das Klirren gekommen war.
Denn leider besaß er keinen Degen.
Er besaß eine bunte gewebte Umhängetasche, drei Unterhosen mit Löchern, das Messer, eine durchgelegene Matratze und eine kleine Bibel, die ihm ein netter Priester einmal geschenkt hatte und die er verwendete, um Kerzen darauf festzukleben.
Es klirrte wieder unten in der Villa. Pablo mochte die unteren Räume nicht so sehr, sie waren zu dunkel und zu groß und die Leute warfen Müll hinein, den er lieber den Ratten und Katzen überließ.
»Miguel, bist du das? Spielst du Verstecken mit mir? Komm raus da«, sagte Pablo. »Wir können uns auf die Stufen setzen wie immer. Hast du was zu essen dabei? Wie … wie waren die letzten Prüfungen …?«
Noch ein Rascheln in der Villa. Und dann ein seltsames Geräusch, kläglich, leise – ein Weinen.
Die Tür hinter den Stufen war mit Holzbrettern zugenagelt. Pablo holte tief Luft und kletterte durch das nächste Fenster. Drinnen landete er zwischen Plastiktüten, alten Blättern und Saftkartons und auf einmal war alles dunkel. Die bunt angemalte, laute, verrückte Stadt blieb hinter ihm zurück. Hier war alles gedämpft und schattig.
Pablo rückte seine Kappe zurecht.
»Wer immer du bist, ich komme jetzt«, sagte er, ein leichtes Zittern in der Stimme. »Hab keine Angst.«
Pablo schlich Schritt für Schritt voran, stieg über Pappkartons und leere Flaschen und dann sah er die zusammengekauerte Gestalt auf dem Fußboden. Es war kein Mensch.
Es war ein Tier. Ein großes und struppiges, mageres Tier. Ein Jaguar, dachte Miguel. Ein verletzter Jaguar.
»Der Urwald ist zu mir gekommen«, wisperte er. »Er hat einen Botschafter geschickt …«
Da hob der Jaguar den langen, schmalen Kopf und sah ihn an. Es war kein Jaguar. Es war ein Hund. Kurzfellig, grau, zerzaust, dreckig … riesig.
»O Dios«, sagte Miguel. »Was ist denn mit dir passiert?«
Er trat ganz vorsichtig näher und dann sah er, dass der Hund die linke Vorderpfote seltsam hielt. Seine Läufe waren lang und schmal, elegant fast, aber etwas mit der Pfote stimmte nicht.
»Bist du angefahren worden?«, flüsterte Pablo. »Oder hat jemand … etwas nach dir geworfen? Einen Stein?« Er kniete sich neben den Hund und der Hund sah ihn an und hechelte. Er schien Pablo zu vertrauen.
»Miguel wird wissen, was wir mit dir machen«, sagte Pablo. »Er studiert an der Universität, um Arzt zu werden. Er mag Hunde. Er mag alle Tiere. Obwohl er Menschenarzt werden will. Er mag eben alle, so ist Miguel. Er ist mein Freund.« Der Hund stellte jedes Mal beim Namen »Miguel« die kurzen, dreieckigen Ohren auf.
»Sag nicht, du kennst Miguel!«, sagte Pablo. »Nein. Du kennst jemanden, der auch Miguel heißt, richtig? Ich habe ihn länger nicht gesehen …«
Um den Hals trug der Hund statt eines Halsbandes einen Strick und unter dem Strick … »Verflixt, da klemmt ja ein Stück Papier«, flüsterte Pablo, auf einmal aufgeregt. »Was … was ist das?«
Der Hund ließ zu, dass er das Papier herauszog, und als er es auffaltete, fand er darauf seinen Namen und erschrak.
PABLO.
Miguel hatte ihm vor einem Jahr Lesen und Schreiben beigebracht und eigentlich hatte Pablo es immer irgendwie überflüssig gefunden, aber jetzt war er froh, dass er es konnte. Die Schrift auf dem Zettel sah ein bisschen krakelig aus. Fast, als hätte ein Kind die Worte geschrieben.
»Pablo, wenn du das hier liest«, entzifferte er mühsam Wort für Wort, »… dann hat der Hund dich gefunden. Was ein kleines Wunder ist. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich verschwunden bin. Glaub mir, ich bin nicht freiwillig verschwunden. Keiner von uns ist das. Du musst uns helfen. Wir sitzen hier fest. Der Hund gehört einem Freund. Ich weiß nicht, was sie mit uns vorhaben und …«
Das letzte Wort war halb verrutscht und mehr stand da nicht. »Und … was?«, flüsterte Pablo und sah dem Hund in die dunklen Augen. Aber der Hund hatte keine Antworten. Er leckte vorsichtig seine verletzte Pfote. »Miguel hat das geschrieben«, wisperte Pablo. »Aber warum ist es so krakelig? Und … er ist beim Schreiben gestört worden, er musste plötzlich aufhören … Warum? Wer sind sie?«
Er knüllte den Zettel in seiner Hand zu einem kleinen Ball. Dann erschrak er, entknüllte ihn wieder und strich ihn auf seinem Knie glatt. »Der Zettel ist ja alles, was wir haben«, flüsterte er. »Als Anhaltspunkt. Miguel ist etwas passiert, richtig? Wir müssen ihm helfen.«
Er nahm den Kopf des Hundes zwischen seine Hände. »Ich wollte ein Abenteuer«, wisperte er. »Aber ehrlich gesagt … hätte ich jetzt doch lieber ein Sandwich. Hund? Ich habe ein bisschen Angst.«
Als der Nachmittag sich neigte, saß Pablo an der Mauer beim Fluss und sah zu, wie die großen Amazonasdampfer ausgeladen wurden.
Eine Menge Leute saßen mit ihm da, die Mauer war bunt vor lauter Menschen – Menschen, die Dinge verkauften oder bettelten oder sich unterhielten und den Nachmittag genossen, Liebespaare, alte Leute, Kinder. Unten an der Anlegestelle wuselten noch mehr Menschen herum, Menschen, die Kisten und Taschen und Tüten trugen.
»Manchmal kommen um diese Zeit Touristen an«, sagte er zu dem Hund neben sich. »Ich führe sie herum, weißt du. Erzähle ihnen was über die Geschichte der Stadt. Darüber, wie die Spanier die Stadt gebaut haben und reich geworden sind mit dem Kautschuk von den Gummibäumen. Über die Indios, die auf ihren Farmen gearbeitet haben und alle gestorben sind wie die Fliegen. Das weiß ich von Miguel.« Er streichelte den Hund, der ihn ernst betrachtete. »Du solltest meine Geschichten hören! In dieser Villa, meine Damen und Herren, lebte ein versklavtes Indiomädchen, das mit dem reichen Sohn eines Kautschukbarons durchgebrannt ist. Sie sind nachts auf einem kleinen Kanu geflohen und beinahe ertrunken, als es umkippte, aber dann haben die rosa Flussdelfine sie gerettet … Ich bin gut im Geschichtenerfinden. Touristen mögen so was.« Er seufzte. »Aber heute … Ich glaube, heute führe ich niemanden. Ich muss nachdenken.«
Er sah dem Fluss nach, der das Wasser gemächlich durch sein breites Bett schob, an den Hafenanlagen vorbei, an den Fabriken, die weiter hinten ihre giftigen Dämpfe in den Himmel spien wie riesige Drachen, an den letzten Hütten der Slums vorüber und in den Urwald. Der Fluss kam aus dem Urwald und floss in den Urwald, der Fluss war Teil des Urwaldes, war sein Herz.
Rio Negro. Schwarzer Strom.
Allwissende Mutter des Lebens.
»Du weißt, wo er ist, nicht wahr?«, flüsterte Pablo dem Fluss zu. »Miguel. Fließt du an dem Ort vorbei, an dem er festsitzt? Hast du ihn gesehen? Geht es ihm gut?« Er beugte sich vor und starrte den glänzenden Strom an, als könnte er ihn zu einer Antwort zwingen. »Wer hat Miguel eingesperrt?«, fragte er eindringlich. »Er hat sich mit jemandem angelegt, mit dem er sich besser nicht angelegt hätte, richtig? Es gibt eine Menge Leute, mit denen man sich besser nicht anlegt. Große Leute. Mächtige Leute. Leute, denen alles gehört. Aber was soll ich … ich allein gegen sie tun? Ich muss etwas tun. Miguel wartet auf mich. Aber die Stadt ist so groß! Wie soll ich da jemanden finden?«
»Hör mal, redest du immer mit dem Fluss?«, fragte eine hohe, klare Stimme hinter ihm und er fuhr herum. Vor ihm stand ein Mädchen mit feinem braunem Haar, das zu einem langen Zopf geflochten war, hellblauen Augen und kleinen Sommersprossen auf der blassen Nase. Sie platzierte sorgfältig zwei glänzende Münzen in Pablos Mütze, die neben ihm auf der Mauer lag. Dann strich sie ihr blaues Sommerkleid glatt und legte den Kopf schief, um ihn zu mustern. »Er antwortet nämlich nur nachts«, sagte sie.
»Ach was«, sagte Pablo. »Hallo, Ximena.«
»Wirklich«, meinte sie. »Tagsüber schläft er. Guck es dir an, das träge Wasser. Das sieht man doch.«
Sie sah sich um und Pablo folgte ihrem Blick. Eine sehr ordentlich gekleidete junge Dame war ein paar Meter weiter dabei, mit einem schmutzigen kleinen Jungen zu feilschen, der Topfschrubber verkaufte. »Die ist für den Moment abgelenkt«, sagte Ximena und grinste. »Sag mal, was ist das für ein Hund?«
Pablo seufzte schon wieder. »Er ist verletzt. Seine Pfote. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Er gehört dem Freund eines Freundes und der Freund hat ihn mir geschickt.«
»Eine Menge Freunde«, sagte Ximena, kniete sich hin und nahm vorsichtig die Pfote des Hundes in ihre Hand. »Das ist ein Schnitt. Er hat sich an etwas Scharfem verletzt, einem Draht oder so etwas. Die Wunde muss desinfiziert und verbunden werden.« Sie sah zu Pablo auf. »Komm nachher vorbei, wenn es dunkel ist, und pfeif unter dem Badezimmerfenster. Ich versuche rauszukommen.«
Ximena wohnte in derselben Straße, in der Pablos marode Villa stand. Sie wohnte in einer richtigen Villa, einer mit Blumentöpfen vor dem Eingang und einem Zaun und einer blank polierten Messingklingel. Die Villa gehörte Ximenas Großvater, einem griesgrämigen alten Herrn, den man nur selten auf der Straße sah. Ximena wohnte bei ihm, da ihre Eltern nicht mehr lebten.
Wenn sie bei Pablo vorbeikam, schenkte sie ihm jedes Mal ein paar Münzen.
»Also. Warum hat dir der Freund des Freundes einen Hund geschickt?«, fragte Ximena.
Aber jetzt kam die ordentlich gekleidete junge Dame auf sie zu.
Pablo konnte nur noch »Später!« flüstern, ehe sie Ximena missbilligend ansah und mit sich wegzog.
Die ordentliche Dame war die Haushälterin von Ximenas Großvater und ohne sie durfte Ximena nicht auf die Straße.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht mit diesem Jungen reden sollst«, hörte Pablo sie rufen und dann lotste sie Ximena über die Straße zur alten Markthalle hinüber. Ximena drehte sich einmal um und winkte, ehe sie im Gewühl der bunten Menschen verschwanden.