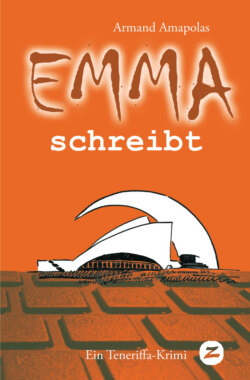Читать книгу Emma schreibt - Armand Amapolas - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеDie Nachricht kam von Paul Bärkamp. Ihrem früheren Lokalchef, bei der Halterner Post. Ihrem journalistischem Vorbild und Förderer. Nicht zuletzt: ihrem väterlichen Freund, der sie, zum ersten Mal überhaupt, aber ohne jedes Zögern, in den Arm genommen und fest gedrückt hatte, nach ihrer Rückkehr aus Teneriffa und nachdem sie ihm – nur ihm – erzählt hatte, minutiös erzählt hatte, wie sie sich gefühlt hatte auf dem Opferstein an der ominösen Geisterquelle. Bei Paul Bärkamp hatte sie sich ausgeheult, nicht bei ihren Eltern oder einer »besten Freundin«. Bei Paul, der wusste, wann es darauf ankam, nichts zu sagen. Der heilsam zu schweigen wusste. Der sie nur in den Arm nahm, minutenlang, und wiegte wie ein kleines Kind. Wie gut ihr das getan hatte!
Paul Bärkamp betrieb, seit dem Aus der Halterner Post – er war die Halterner Post gewesen, jedenfalls in den Augen seiner Leser und auch der nicht-lesenden Halterner – einen lokalen Nachrichten-Blog: halternswelt.de. Er hatte Emma, natürlich, gefragt, ob sie nicht auch mitmachen wollte. Nur leider könne er keine Honorare zahlen, oder jedenfalls nur winzig kleine. Emma war trotzdem dankbar für das Angebot, auch wenn sie es ablehnen musste. Sie war, anders als der Frührentner Paul, darauf angewiesen, mit dem Schreiben Geld zu verdienen. Paul Bärkamp wusste das natürlich. Aber er hatte ihr das Gefühl gegeben, nicht nur als Mensch, sondern auch als Journalistin geschätzt zu werden. Von einem, auf dessen Urteil und Menschenkenntnis Verlass war. Das war ihr sehr viel wert gewesen.
»Melde dich mal! Ich hätte vielleicht einen Auftrag für dich. Einen lohnenden. Herzlich, Paul.«
Paul Bärkamp. Wieder einmal. Hatte er einen fünften – oder sechsten? – Sinn? Wusste er, dass Emma jetzt, gerade jetzt, in diesem höchst konkreten Moment, nichts so sehr brauchte wie Ablenkung, Trost und eine Perspektive? Natürlich konnte er das nicht wissen. Er wusste nichts, aber auch rein gar nichts von ihrem »Abenteuer« im Reifenhaus Schulte-Bückendorf. Er hatte Emmas Arbeiten für die Revue nie kommentiert, obwohl er sie natürlich las – gelesen hatte –, da war sich Emma sicher. Paul Bärkamp und Tanja von Dückers waren einander in respektvoll-höflicher Abneigung verbunden. Emma hatte Paul nie Champagner schlürfen sehen. Bier trank er schon, lieber noch trockenen Weißwein, vorzugsweise Soave, aber nie auf irgendwelchen Empfängen – Paul Bärkamp hasste Smalltalk – und ganz sicher nie auf Kosten von Menschen, die von der Redaktion der Halterner Post etwas wollen könnten. Paul Bärkamp und Tanja von Dückers standen für zwei grundverschiedene Varianten des Journalismus – die gestrige und wahre, in Emma Sicht, und die von Internet und social media korrumpierte.
Emma tippte seine Nummer an. Paul Bärkamp reagierte sofort.
»Hallo Emma. Schön, dass du dich gleich meldest. Wo steckst du? Hast du wieder Schampus mit der Fürstin?« Paul Bärkamp liebte es, Tanja von Dückers »die Fürstin« zu rufen – und die wiederum liebte es, so zu tun, als ob ihr das unrecht wäre.
»Hab ich tatsächlich gerade. Ein letztes Glas im Stehen. Nein: im Sitzen. Und ich hab es nur halb ausgetrunken. Dann bin ich gegangen. Aber das erzähle ich dir lieber nicht am Telefon.«
»Dann komm doch vorbei! Du wirst doch den Trampelpfad zu unserer unscheinbaren Redaktionshöhle noch finden – auch wenn du jetzt mehr auf Alleen und in Palästen unterwegs bist?«
Emma war nicht danach, auf Pauls Flachsereien einzugehen. »Ich komme«, sagte sie nur. »Jetzt gleich?«
»Gerne auch gestern. Du bist hier immer willkommen. Das weißt du.«
Keine halbe Stunde später saß Emma Paul in der ehemaligen Bankfiliale gegenüber, die nun als halternswelt.de firmierte. »Schwerter zu Pflugscharen, auf unsere Art«, hatte Paul den Einzug kommentiert. Der Hauseigentümer war ein alter Freund – und treuer Leser der Halterner Post. Er hatte Paul Bärkamp und den paar Kollegen, die nicht aufhören wollten, in der Kleinstadt zwischen Ruhrgebiet und Münsterland Öffentlichkeit herzustellen, die Räume samt ausrangiertem Bankmobiliar kostenlos überlassen – »bis ihr Geld verdient; dann ändern wir den Vertrag«. Ein Mann mit Geduld.
»Du meine Güte, wie siehst du aus? Hast du etwa geheult? Und hast du nichts zu tun? Liegt kein Firmenjubi…« Paul verstummte. Er sah Emma an, dass ihr jetzt nicht an Gefrotzel lag. »Komm, erzähl! Was ist passiert?«
Und Emma erzählte. Alles. Von ihrem Auftrag. Davon, wie ungern sie solche Geschichten schrieb. Von ihrer Begegnung mit LSB. Wie sie es nicht lassen konnte, ihm auf den Zahn zu fühlen. Wie das einfach so über sie gekommen war. Von ihrer Flucht aus dem Reifenhaus. Von ihrem Gespräch mit Tanja und Hauke von Dückers. Von den Fotos, die sie nicht mehr besaß.
»Das ist, auch wenn das jetzt hart klingt, wahrscheinlich gut so. Diese Geschichte hättest du nicht durchziehen sollen, selbst wenn du sie, glaube ich, überlebt hättest. Beruflich, meine ich.« Paul Bärkamp hatte still zugehört, Emmas Redefluss durch keine Frage unterbrochen, sie nur besorgt und ernst angesehen, ein paar Sekunden nachgedacht. Und ein mentales Häkchen drangehängt.
»Du willst meinen Rat? Du bekommst ihn. Du solltest das Kapitel schließen. Das ganze Kapitel Lippe Revue. Das war ohnehin nicht deine Welt. Und von der Fürstin kannst du im Ernst nicht erwarten, dass sie auf ihre alten Tage die Alice Schwarzer gibt – die übrigens ja längst auch nicht mehr sie selbst ist. Dass unsere Fürstin ihren geliebten Hauke in die Bredouille bringt: unvorstellbar. Aber wenn du einverstanden bist, kann es vielleicht nicht schaden, LSB und das Fürstenpaar glauben zu lassen, die Fotos existierten doch noch. Ich könnte ja bei Gelegenheit mal eine Bemerkung fallen lassen, nur so, ganz nebenbei. Was ich da gesehen hätte. Was hältst du davon? Nicht um irgendwas draus zu machen, journalistisch meine ich, sondern nur als Rückversicherung. Das kann nicht schaden, finde ich.«
Emma nickte. Und staunte. Sie konnte eben immer noch etwas lernen von Paul Bärkamp, dem ausrangierten Journalisten. ›A Hund is er scho‹, sagen sie, glaubte Emma gelesen zu haben, in Bayern über einen wie ihn. »Und jetzt zum Geschäft, Frau Schneider! Können Sie sich als Ghostwriterin vorstellen? Und bist du nicht auch eigentlich schon wieder reif für die Insel?«
Und jetzt saß sie hier, in werweißwievieltausend Fuß Höhe, nur fünf Tage später, im Anflug auf Teneriffa. Hinter dem kleinen, leider etwas zerkratzten Fenster lugte ihr die Spitze des Teide aus einer fluffigen Wolkendecke entgegen. Déjà-vu.
Was empfand sie? Jedenfalls keine Angst. Das war schon mal gut. Vielleicht Wut. Einen Rest von Wut, über ihre eigene Hilflosigkeit damals. Aber auch Freude. Zu ihrer Irritation. Eine diffuse, ihr nicht ganz begreifbare Vorfreude. Auch Wiedersehensfreude. Sie winkte der Teide-Spitze zu wie einer alten Bekannten.
Vorfreude auf was? Noch wusste sie wenig über ihren möglichen Auftrag. Dafür eine ganze Menge über ihren potentiellen Auftraggeber. Das, was Paul ihr erzählt hatte. Und das, was sie dank ihrer Zeit als Lokalredakteurin in Haltern am See ohnehin wusste über Horst Hanisch. Über »Hotte« Hanisch. ›Uns Hotte‹, wie ihn viele im Kreis Recklinghausen genannt hatten, damals, als Hanisch noch einflussreich und scheinbar unaufhaltsam auf dem Weg nach oben war. Google lieferte eine schier unendliche Fülle von Artikeln, Fotos und Einträgen über Horst Hanisch: als frecher Jugendfunktionär seiner Partei, als ideenreiches, junges Kreistagsmitglied, als Parteisekretär, als Landtagsabgeordneter, dann Bundestagsabgeordneter. Vielen, jedenfalls in Herten und Umgebung, galt Horst Hanisch als ministrabel.
Dann war der Absturz gekommen. Bei der Nominierung für eine erneute Bundestagskandidatur trat wie aus dem Nichts eine junge Frau gegen den Platzhirsch an – und gewann. Horst Hanisch war abgestürzt. Knall auf Fall. Sein Amt als Parteisekretär hatte er schon nach der ersten Wahl aufgegeben. Sein Nachfolger, das vermutete Emma – und Paul schien es zu wissen – hatte keinen geringen Anteil an Hotte Hanischs Demontage. Hanisch galt jetzt als entrückt. Als jemand, der sich zu wenig zuhause sehen ließ. Zu sehr in Berlin engagiert. Viele sagten auch: zu arrogant. »Der grüßt mich nicht mehr, wenn wir uns mal auf der Straße begegnen«, hatte sich eine alte Schul- und Parteifreundin in der Hertener Zeitung zitieren lassen. Manuela May, nicht mal halb so alt wie Hanisch, galt hingegen als »eine von uns« und ließ sich im Jahr vor ihrer Nominierung und der anschließenden Wahl in jeder Vereinsversammlung sehen. Sie klopfte an nahezu jede Hertener Tür, während Hanisch in Berlin »gebunden« war. Die Bundestagswahl war für Manuela May dann reine Formsache. In der einstigen Bergbaustadt hatten andere als SPD-Kandidaten keine Chance, immer noch nicht. Obwohl Zweidrittelmehrheiten, wie sie noch Hanischs schier ewig dienender Vorgänger eingefahren hatte, auch hier schon lange Geschichte waren. Manuela May erzielte sogar das schlechteste Ergebnis der SPD im Hertener Wahlkreis seit Gründung der Bundesrepublik. Aber es war immer noch eines der besten ihrer Partei, republikweit gesehen. Bei allerdings stark gesunkener Wahlbeteiligung.
Das alles hatte Horst Hanisch nur noch aus der Ferne verfolgt. Seit seiner Nichtnominierung zum Bundestagskandidaten ließ er sich in Herten praktisch überhaupt nicht mehr blicken. Es fragte aber auch keiner mehr nach ihm. Er war verschwunden. Es hieß, er lebe jetzt ganz in Berlin.
Das stimmte nicht, wie Emma von Paul erfahren hatte. Hotte Hanisch lebte auf Teneriffa. Und er wollte seine Erinnerungen aufschreiben. Eine Autobiographie verfassen. Vermutlich: abrechnen. Mit seiner Partei, mit seinem Nachfolger als Parteisekretär, mit Manu May, mit wem auch immer, von dem er sich verraten fühlte. Das jedenfalls vermutete Paul Bärkamp. Ach was: er wusste es, nach einigen langen Telefonaten mit Hanisch. Die beiden kannten sich, naturgemäß, seit Jahrzehnten. »Sie haben wenigstens nie etwas Erfundenes über mich geschrieben«, hatte Hanisch zu Bärkamp gesagt, bei ihrem ersten Telefonat. Er wollte Bärkamp dafür gewinnen, ihm beim Sortieren und Aufschreiben seiner Erinnerungen zu helfen. »Ich brauche einen Ghostwriter. Das Schreiben war noch nie so mein Ding. Aber das wissen Sie ja.«
»Ich habe wirklich ernsthaft über Hanischs Angebot nachgedacht. Bis ich das Gerücht hörte, du hättest dich an LSB herangemacht.«
»Das hast du gehört? Wann?«
»Kurz bevor ich dir die Whatsapp-SMS geschickt habe. Ein alter Bekannter von der Recklinghäuser Zeitung rief mich an und wollte wissen, ob ich auch schon gehört hätte… Und ich würde dich doch kennen, als dein früherer Chef. Und ob ich mir so etwas vorstellen könnte.«
»So etwas?«
»Na ja. Der Kollege klopfte wohl auf den Busch. Wie man das eben so macht, wenn man nichts Genaues nicht weiß, aber ein Raunen gehört hat. Er hatte nichts Festes, kein Zitat, keine Quelle. Da hat er es, vermutlich unter anderem, eben bei mir versucht. Hätte ich ihm irgendein Zitat gegeben, hätte er am selben Tag noch einen Artikel gepostet, da bin ich ziemlich sicher. Und wenn es darin geheißen hätte: ›Ehemaliger Vorgesetzter kann sich nicht vorstellen…‹ Damit wäre die Geschichte in der Welt gewesen. Nachfragen wären legitim gewesen. So veredelt man Gerüchte zu vermeintlichen Nachrichten. Auf dem Boulevard jedenfalls. Neu ist, dank dem Internet, dass sich auch ernsthafte Blätter an diesem Wettrennen um Sensationen beteiligen. Wer weiß, vielleicht wären wir bei der Halterner Post auch noch so tief gesunken, wenn unsere sogenannten Verleger uns nicht vorher den Hals umgedreht hätten. Ich sollte ihnen dankbar sein. Jetzt sind wir tot, aber stolz.«
»Aber dieser Anruf aus der Recklinghäuser bei dir, das war doch, wenn ich richtig rechne, kaum mehr als eine Stunde, nachdem ich das Reifenhaus Schulte-Bückendorf verlassen hatte und LSB seinen Hosenschlitz wieder zugezogen hat, vermutlich.«
»Er verliert eben keine Zeit, der junge Mann. Dumm ist der nicht. Ob er selbst auf die Idee gekommen ist, dich auszukontern, bevor du überhaupt irgendein Wort über die Sache geschrieben hast, oder ob er gleich einen Anwalt angerufen hat, der ihm zur Offensive geraten hat, wer weiß? Vielleicht hat er ja auch seinen guten Freund Hauke kontaktiert. Was ich sogar für das wahrscheinlichste halte. Hauke von Dückers ist ja, das vergisst man gern, auch Jurist, und tut immer nur so, als sei er mit keinerlei Wasser gewaschen. Er gibt gern die Dumpfbacke an der Seite seiner cleveren Gattin, aber in Wahrheit ist er ein talentierter Strippenzieher. Und viel schlauer, als er tut.«
»Was genau soll ich denn nun angestellt haben, in Lambert Schulte-Bückendorfs Büro?«
»Keine Ahnung. Das ist ja das Raffinierte. Je weniger man weiß, umso blühender arbeitet die Fantasie. Der Kollege wusste nur: du hattest einen Interviewtermin bei LSB. Du solltest ein Porträt von ihm schreiben und über seine Firma. Aber dabei hättest du… was auch immer. Wozu es offenbar nicht gekommen ist, weil LSB dich rausgeworfen hat. Fang besser gar nicht erst an, darüber nachzudenken. Freue dich, dass niemand die Sache aufgegriffen hat und du bald wieder unter der kanarischen Sonne sitzen wirst! Aus den Augen, aus dem Sinn: das hat auch was Gutes.«
So hatte Paul Bärkamp gesprochen. Wie ein weiser Indianerhäuptling. Und nun würde Emma, in einigen Stunden schon, Horst Hanisch gegenübersitzen. Am Südflughafen werde ein Fahrer auf sie warten, mit einem Pappschild, auf dem »Schneider« stehen würde. Alles Weitere werde er regeln. Hanisch hatte auch den Flug für Emma gebucht. Er wolle sie kennenlernen. Zunächst ganz unverbindlich. Bärkamp habe sie zwar über den grünen Klee gelobt. Und er selber sei auch von Emma, der Redakteurin, nie »reingelegt« worden – »soviel ich weiß, aber mehr weiß ich über Sie auch nicht. Wissen Sie was: Kommen Sie einfach her! Machen Sie sich, falls wir uns darauf verständigen, uns nicht zu verständigen, ein paar schöne Tage auf der Insel, auf meine Kosten, und das ist es dann gewesen. Kennen Sie Teneriffa?« Emma hatte bestätigt, Teneriffa zu kennen. »Dann wissen Sie: vom Südflughafen nach Santa Cruz fährt das Taxi eine halbe Stunde. Sie werden am Spätnachmittag hier sein. Wir nehmen einen kleinen Imbiss in netter Umgebung und beschnuppern einander. Und dann schaumermal, was daraus werden kann. Wie der Kaiser sagen würde.«
Kannte sie Teneriffa? Jedenfalls entschieden besser als vor einem halben Jahr. Aber das Gebäude, vor dem der Taxifahrer anhielt, hatte sie bisher nicht wahrgenommen. Es wäre ihr aufgefallen. War das überhaupt ein Gebäude? Das Taxi stoppte zwischen einer mehrspurigen, aber nicht sehr dicht befahrenen, von Palmenreihen und breiten Fußwegen gesäumten Straße und dem glattblauen Meer, vor einem gewaltigen, in der Sonne glitzernden weißen Gebilde, das Emma an eine riesige Narrenkappe denken ließ, so eine, wie sie Karnevalsfunktionäre und Politiker in sogenannten Prunksitzungen tragen. Nur nicht bunt. Und das Glöckchen fehlte, am Zipfel des abenteuerlich Richtung Land gebogenen Was-auch-immers. Ein Dach? Eines, das spitz zuläuft und das über dem offenbar eigentlichen Gebäude schwebt? Emma konnte sich nicht erinnern, ein auch nur annähernd ähnliches Bauwerk jemals gesehen zu haben. »El Auditorio«, stellte der Fahrer Emma das Gebäude vor. Vom »Auditorio« hatte sie schon gehört. Das Konzerthaus, das war es also. Das Werk eines offenbar berühmten spanischen Architekten. Es war bei seiner Einweihung vor ein paar Jahren sogar deutschen Zeitungsfeuilletons rühmende Artikel wert gewesen. Wo Teneriffa sonst allenfalls in Reiseteilen auftauchte. Und auf Postkarten und Plakaten hatte Emma das weiße Ding natürlich auch schon gesehen, nebenbei, aus dem Augenwinkel, wie man so sagt. Aber dass es so groß, so gewaltig, so überwältigend ist, das hatte sie nicht geahnt. Es schien einer komplett anderen Welt entsprungen als das La Palma und ihr, also Oma Ilses, Apartment dort im spießigkleinbürgerlichen Puerto de la Cruz.
»Gehen Sie um das Auditorio herum«, hatte Hanisch sie instruiert, »oder hindurch, wie Sie mögen. Auf der anderen Seite gibt es ein Bistro. Da werden Sie mich finden.«
Jetzt war sie hier. Emma entschied sich fürs Drumherum-gehen, auf der Atlantikseite. In Herten hatte es aus nassgrauem Himmel genieselt, als sie aufgebrochen war. Hier kam sie gar nicht erst in Versuchung, den leichten Anorak anzuziehen, den sie mitgenommen hatte. »Ihr Gepäck bringt der Taxifahrer gleich ins Hotel.« Hanisch schien ein guter Organisator zu sein. Er hatte auch das Hotel für sie gebucht. Emma hatte glatt vergessen zu fragen, welches Hotel. Schon schön, so umsorgt zu werden! Ein völlig neues Gefühl. Sie konnte jetzt ahnen, wie es Ministern oder Managern erging, die immer nur ein- und aussteigen und ein- oder auschecken mussten – den Rest erledigte ihr Büro für sie. Daran konnte man sich gewöhnen. Emma begriff, warum es vielen einst Bedeutenden so schwer fiel, von Dienstwagen und Sekretärin und dem ganzen Drumherum Abschied zu nehmen. Sie mussten ja zwischenzeitlich verlernt haben, wie man Fahrkarten löst oder Milch einkauft.
Links von ihr ragten pittoresk angerostete Bohrtürme in den makellos blauen Himmel, vor der Skyline der Inselhauptstadt. Falls Skyline das richtige Wort war. Zwar fielen Emma ein paar größere Gebäude ins Auge, auch ein markanter Kirch- oder Rathausturm, aber alles Menschenwerk wurde überragt von einem wild gezackten Gebirgszug gleich hinter der Stadt. Die Bohrtürme schienen zu Bohrinseln zu gehören, die hier offenbar »geparkt« waren, vermutlich um repariert zu werden. Einen Anstrich konnten sie jedenfalls vertragen, so grünlich-rostbraun gescheckt sie waren, als wollten sie den Kontrast zwischen der Welt der Arbeit, ihrer Welt, und der Welt der Kultur, dem weißglitzernden Auditorio, betonen. Im Hafenbecken hinter den Türmen ruhte ein blauweiß bemaltes Kreuzfahrtschiff. Es kam Emma abstrus groß vor im Vergleich zu den sonstigen Bötchen und den Gebäuden der Stadt. Wie ein Bobbycar in einer Märklinwelt.
Eine breite Promenade führte um die glänzende Narrenkappe herum. Der Glanz, sah Emma jetzt, verdankte sich Reflexionen auf vermutlich Hunderttausenden oder gar Millionen von weißen Keramikfliesen. Daraus bestand die »Haut« des Gebäudes. Von hier aus gesehen erinnerte es Emma weniger an eine Narrenkappe als an eine brütende Glucke. Mit jedem weiteren Schritt veränderte sich die Perspektive, kamen Emma neue Assoziationen. Die spitze Zunge über dem Hauptbau: sollte sie womöglich eine Welle symbolisieren? Wobei nichts darauf hindeutete, jedenfalls in Emmas Augen, dass hier Musik gemacht wurde. Oder doch: einige der dicken Felsbrocken, deren Aufgabe es offenbar war, die Promenadenmauer vor der Brandung zu schützen, waren mit bunten Gesichtern bemalt, darunter standen Namen: Wolfgang Amadeus Mozart, John Lennon, Pablo Casals, Ennio Morricone…
Welche Brandung? Jetzt und hier gab sich der Atlantik brav. Er spielte blaugefärbter Ententeich. Aber Emma wusste: das konnte sich rasch ändern.
Auf der anderen Gebäudeseite fiel ihr jetzt eine Reihe von Tischen ins Auge. Dort saßen einige Menschen, offenbar essend und trinkend und entspannt, aber animiert miteinander plaudernd, wie auf einer Bühne, einige Stufen über der hier platzartigen Promenade, unter hochgeklappten Holztüren, im Maul des Gebäudes sozusagen; zwischen dessen steinernen und hölzernen Lippen.
Am hintersten Tisch, aus Emmas Perspektive, saß ein Mann ohne Begleitung, mit dem Rücken zum Mundwinkel des eigenartigen Gebäudes. Er schien Emma schon seit längerem zu beobachten und winkte ihr augenblicklich zu, als sie ihn wahrnahm und Blickkontakt herstellte.