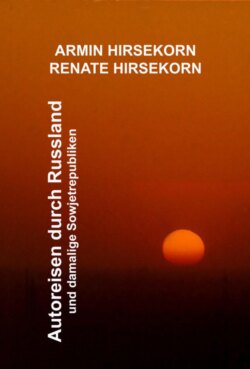Читать книгу Autoreisen durch Russland und damalige Sowjetrepubliken - Armin Hirsekorn - Страница 5
Anreise und Grenzübergänge
ОглавлениеEnde Juli 1978, bei unserer ersten Reise in den Kaukasus, starten wir um Mitternacht in Dresden und sind bereits um 1.40 Uhr am Grenzübergang in Görlitz. 50 km nach Wroclaw übermannt uns die Müdigkeit. Pausen sind unbedingt notwendig, das wissen wir von unserer Reise nach Bulgarien, als sich unsere Anspannung während der ersten Stunden in einem Unwetter freigesetzt hatte. Eine fünfwöchige Autofahrt mit einem Ehekrach zu beginnen, das konnte gefährlich werden.
Nach zwei Stunden Schlaf im Auto, am Wegesrand, setzen wir die Fahrt fort, und am frühen Morgen, als die Sonne über dem Horizont aufgestiegen ist, haben Renate und ich alle Gereiztheit überwunden. Wir erfreuen uns im Bewusstsein der vor uns liegenden wunderbaren Fahrt über die Höhen der Waldkarpaten, durch die unendlichen Steppengebiete der Ukraine, über die Weichsel, den Dnjepr, die Wolga, hin zum Kaukasus, nach Transkaukasien, zum Schwarzen Meer, zur Kaukasischen Riviera und auf die Krim.
Für die Anreise durch Polen, Tschechien und die Slowakei ist es gut, Freunde zu haben, bei denen man Station machen und übernachten kann. Dadurch ist es möglich, die Grenze bei Brest, Shaginia oder Ushgorod bereits in den frühen Morgenstunden zu passieren, und so erspart man sich eine Übernachtung in der Sowjetunion. Wir können uns Zeit lassen, uns auf die langen Fahrtstrecken in der Union vorbereiten und touristische Ziele besuchen, auf die wir uns in der Vorbereitung orientiert haben.
Abbildung 12: Die Tuchhallen am Krakauer Marktplatz.
Im Sommer 1977 hatten wir in den Masuren ein polnisches Ehepaar aus Katowice kennengelernt. Im Juli 1978, bei der ersten Anreise in die Sowjetunion, ist ihre Hochhauswohnung unser Ziel. Bereits gegen zehn Uhr sind wir dort, doch die Wohnungseigentümer treffen wir nicht an, sie befinden sich irgendwo im Urlaub. Eine Nachbarin überreicht uns die Schlüssel. Wir können uns eine Weile ausruhen und haben dann viel Zeit für den Besuch des weiträumigen Kulturparkes zwischen Katowice und Chorzów. Wir erkunden ihn, dahinschwebend in der Gondel einer Seilbahn, über gewaltige Dinosaurier aus Stahlbeton hinweg, mit dem Blick auf weite Blumenrabatten und einen ausgedehnten Gondelteich mit Wasserrutschbahn.
Bereits um neun Uhr am folgenden Tag erreichen wir Krakau. Auch hier haben wir genügend Zeit und Muße für einen ausgedehnten Spaziergang durch den Wawel, zu den Gebäuden der Universität, für den Besuch des Domes, der Palastkapelle und Königsgräber, der Marienkirche und des Glockenturmes.
Unangenehm ist, dass Renate und ich auf dem Platz vor den Tuchhallen alle paar Minuten, meist von jungen Männern, aber auch von jungen Frauen, angesprochen werden. Wir ignorieren die Versuche zum illegalen Geldtausch, weil uns die betrügerischen Manipulationen bekannt sind. Doch einem kleinen Burschen drücken wir einen Złoty für Taubenfutter in die Hand. Bevor wir unsere Fahrt am frühen Nachmittag in östliche Richtung fortsetzen, füttern wir noch fix die Krakauer Tauben auf dem Marktplatz, vor den Tuchhallen.
Abbildung 13: Kilometerlange Autoschlange am Grenzübergang Shaginia.
Unser nächstes Ziel ist Dukla, am Rande der Beskiden, 13 km entfernt vom Grenzübergang in die Slowakei. Am Rande der Straße dehnen sich kleine Felder, junge Mädchen hüten ihre Kühe, alte Omas versuchen als Tramper ein Fahrzeug anzuhalten, schwangere Frauen hocken an den Haustüren und neu erbaute Häuschen schmücken die Ortschaften.
Um 16.00 Uhr treffen wir in Dukla ein und finden auch gleich die uns von meinem Warschauer Freund Zbyschek angegebene Adresse. Ein polnisches Ehepaar, Zahnärzte, mit der Praxis im eigenen Haus, begrüßt uns in aller Herzlichkeit: „Die Freunde von Zbyschek sind auch unsere Freunde!“
Zbigniew hatte ich Mitte der 60er Jahre, während der Leipziger Messe, kennengelernt. Als Student der TU Dresden besserte ich in den Semesterferien bei Messetourist Leipzig mein Stipendium auf. Als ich meine Reisegruppe aus Polen am Bahnhof in Empfang nehmen wollte, kam mir ein junger Mann entgegen, etwa dreißig Jahre alt: „Guten Tag! Ich bin ihr polnischer Reiseleiter. In welcher Sprache wollen wir miteinander reden: Deutsch, Polnisch, Englisch oder Französisch?“
„Wenn wir mit Polnisch und Englisch nicht weiterkommen, dann bitte in Deutsch. Ich könnte von Ihnen lernen. Doch wie kommt es, dass Sie so viele Sprachen beherrschen?“ wollte ich wissen.
„Während der Besetzung durch die Deutschen war uns Polen der Schulbesuch versagt. Meine Eltern schickten mich zu einem illegalen Gymnasiallehrer. Er beherrschte mehrere Sprachen und brachte sie mir bei. Nachdem der Krieg beendet war, zog ich daraus den Vorteil und wurde Reiseleiter!“
Zbyschek war intelligent, vielseitig interessiert und talentiert, von etwas eigenwilligem Charakter und nach eigener Aussage ein: „Snob“. Wir wurden Freunde, ich besuchte ihn in Warschau, er uns in Dresden, und er war es, der uns die Übernachtung bei seinen Freunden in Dukla vermittelte.
Für deutsche Autotouristen gab es drei Grenzübergänge zur damalige Sowjetunion: Brest und Shaginia, wenn man sich durch Polen näherte und Ushgorod, als Übergang von der damaligen Tschechoslowakei. Abhängig war das davon, für welche Route man sich entschieden hatte und für welche Strecke der Reiseleistungsvertrag durch das Reisebüro der DDR bestätigt worden war.
Am 1. August 1978 fahren wir gegen 7.00 Uhr mit unserem Lada 2101 in Dukla los. Es ist ein wunderbarer Tag, schon in aller Frühe ist die Sonne über dem Karpatenvorland aufgestiegen. Ihr Licht verwandelt den Belag der Landstraße streckenweise in Silber und lässt die Einzelheiten in der uns umgebenden, kontrastreichen Landschaft deutlich hervortreten. Die Fahrt führt von Dukla aus, teilweise in Serpentinen, bis nach Przemyśl und von dort zur sowjetischen Grenzstation Shaginia.
Abbildung 15: Denkmal des Dichters Adam Mickiewicz in Lwow.
Als wir uns dem polnischen Grenzort Medyka nähern, gestatten uns die sanften Höhen des Karpatenvorlandes schon von weitem einen Blick auf das Ende einer unendlich langen Autoschlange, in die wir uns geschätzte fünf Kilometer vor dem Grenzübergang einzureihen haben.
„Das wird heute nichts mit der geplanten Ankunft gegen 16.00 Uhr in Lwow“, stellt Renate in aller Sachlichkeit fest.
„Ja, und auch nicht aus unserem geplanten Spaziergang durch Lemberg, in die armenische Kirche, die mittelalterliche Nikolaikirche, die Maria-Entschlafene–Kathedrale, das Dominikanerkloster und das Neue Rathaus!“
Und tatsächlich, neun Stunden Aufenthalt haben wir an der Grenze zur Ukraine. Im Minutentakt wird vorgerückt, man kann sich nicht einmal bis zu dem einhundert Meter entfernten Busch vom Fahrzeug entfernen - falls da überhaupt einer ist - sondern muss seine Kleinigkeit hinter der Autotür als einer „spanischen Wand“ erledigen.
„Ich lehne das ab“, meint Renate und begibt sich auf die Suche nach einem Örtchen. Irgendwo hat sie Erfolg und ist nach einer guten Viertelstunde wieder zurück. Inzwischen habe ich den LADA zweimal starten müssen und bin wenige Meter in der Schlange vorgerückt.
Nach einer Weile jedoch kann ich feststellen, dass sich auch hier eine gewisse Regel herausbildet: Kann ein führerloses Fahrzeug mal nicht vorrücken, und bildet sich eine größere Lücke, dann warten die folgenden Fahrer geduldig. Nicht ein einziges Mal setzt einer zum Überholvorgang an.
Der Tag wird für mich zur Qual. Renate hat noch keinen Führerschein, ich muss neun Stunden hintereinander ungezählte Mal den Motor starten und vorrücken. Ein Glück, dass wir uns mit genügend Trunkwasser und belegten Broten bevorratet haben. Den unbarmherzigen Sonnenstrahlen entziehen wir uns immer mal wieder, indem wir im Auto hocken bleiben und beide Seitentüren sperrangelweit öffnen.
Dann, am späten Nachmittag, nähert sich uns eine Frau aus einem der Fahrzeuge in der Schlage vor uns: „Kann ich Ihnen eine Schlagwurst und diesen Beutel Äpfel anbieten? Wir wussten nicht, dass es verboten ist, Lebensmittel über die Grenze mitzuführen!“
Je mehr wir uns dem Übergang nähern, desto mehr bemühen sich die Reisenden, ihren überflüssigen Proviant loszuwerden. Zentnerweise landen Lebensmittel im Abfall. Renate und ich waren auf diese Situation vorbereitet und hatten wohlweislich keine überflüssigen Vorräte mitgeführt.
Abbildung 16: Voucher der Reise über den Kaukasusring 1978.
Um 19.30 Moskauer Zeit erreichen wir endlich den Grenzübergang und werden von einem sowjetischen Grenzoffizier empfangen: „Sie sind wohl Panzerfahrer?“ brummt er mich in russischer Sprache an, als mein LADA, etwas ruckweise und nicht ganz flüssig, auf dem zugewiesenen seitlichen Parkplatz hält. Er verlangt unsere Ausweispapiere, die Unterlagen des Reisebüros und die sogenannte Zählkarte A. Wir hatten versäumt, sie auszufüllen und unser Reiseziel anzugeben.
„Zählkarte ausfüllen, Reiseziel angeben, sonst keine Passage in Sowjetunion!“ fordert uns der Grenzer auf. Das hat Renate schnell nachgeholt, dann müssen wir den Kofferraum öffnen und werden gefragt, ob wir Lebensmittel mitführen würden.
Renates Ordnung und Übersicht, die sie in den bisherigen Grenzüberfahrten eingeübt hat, zahlt sich aus. Nur wenige Handgriffe sind notwendig, und nicht ein einziges Gepäckstück müssen wir öffnen, dann kann der Kofferraum geschlossen werden. Auch die peinliche Ordnung im Wageninneren scheint den Mann zu überzeugen. Er überreicht uns die Routenpapiere und Benzintalons, so dass wir bereits nach einer Viertelstunde Kontrolle den LADA zur Weiterfahrt starten.
Es beginnt langsam zu dunkeln, als wir die Fahrt auf der breiten Asphaltstraße in Richtung Lwow aufnehmen. Schon unmittelbar nach dem Grenzübergang stehen alle paar hundert Meter Männer, jüngere, ältere, die uns winken anzuhalten. Nur einmal kommen wir der Aufforderung an einer etwas übersichtlichen Stelle nach: Ob wir Autoreifen verkaufen würden oder Benzintalons? Das geht so weiter, auch in den folgenden Ortschaften, bis in die Nähe der Stadt. Inzwischen ist es stockfinster geworden.
Endlich, um 23.00 Uhr Moskauer Zeit, erreichen wir Lwow. Der Weg führt uns ins Stadtinnere, zum Hotel. Er ist bestens ausgeschildert, so dass wir auch nicht ein einziges Mal in die Irre fahren.
An der Rezeption empfängt uns die nächste Überraschung: eine Invasion von polnischen Touristen, die versuchen, ein Zimmer für sich zu erobern. Vor mir Menschen, nicht etwa in einer Schlange anstehend, nein, wild durcheinander, eine Traube von etwa dreißig Personen.
Als ich den ersten Schreck überwunden habe, versuche ich der jungen Frau am Tresen über die Menschenmenge hinweg einige polnische Worte zuzurufen. Sie schaut nicht einmal auf. Ich wiederhole den Zuruf in Deutsch. Sie erschrickt und schaut mich an. Als ich meine Bitte in englischer Sprache wiederhole, unterbricht sie ihre Arbeit, winkt mich mit ihrer Rechten zu sich, und sofort öffnet sich vor mir eine Gasse in der Menschenmenge.
Abbildung 17: Rast und Badepause an der Straße nach Kiew, Ukraine.
Die Angestellte überprüft unsere Routenunterlagen, die Personalausweise und übergibt uns eine Schlüsselkarte. Kaum zehn Minuten vergehen, und ich habe unseren Zimmerschlüssel und den Schlüssel zu einem drei Meter hoch eingezäunten Parkplatz in Empfang genommen.
Ob wir noch etwas zu essen bekämen, ist meine Frage. „Ja“, lautet die Antwort in Englisch, in der 5. Etage gäbe es einen „Shop“ mit einer Деҗурня, einer Frau im Dienst.
Wir stellen den Lada auf den abgeschlossenen Parkplatz und begeben uns mit den wichtigsten Utensilien für die Übernachtung in unser Hotelzimmer, in eines der oberen Geschosse. Das Zimmer mit Bad ist einfach eingerichtet und sauber. Was uns auffällt: Das Radio hat einen Wackelkontakt, sonst haben wir nichts zu bemängeln.
Es ist schon spät, doch Renate ist nicht kleinzukriegen: „Ich habe Hunger, wollen wir noch in den Shop, zu einem Imbiss?“
Wir finden auch gleich den winzigen Raum mit den Lebensmittelregalen. Und tatsächlich, hinter der Theke steht eine „Frau im Dienst“. Renate schaut sich um, entdeckt Brot, Sahne, Käse, Soleier und Krebsfleisch in der Dose. Ihr Blick bleibt bei den Champagnerflaschen hängen: „Was meinst Du, ist es uns die erste Nacht in einem ukrainischen Hotel wert, ein Glas Krimsekt zu trinken?“
So endet dieser erste Abend in der Sowjetunion für uns Dresdner Autotouristen mit einem kleinen Fest, bei ukrainischem Weißbrot, russischer Sahne, Krebsfleisch und Krimsekt. Und schon am nächsten Morgen geht die Reise nach der vorgegebenen Route weiter. Unser nächstes Ziel ist Kiew.
Vor uns liegt eine Strecke von 550 Kilometern, es ist 7.00 Uhr, als wir unser Auto starten. Die Fahrt führt uns auf einer breiten Autostraße über Rowno und Schytomyr in die Hauptstadt der Ukraine. Wir durchqueren weite fruchtbare Landstriche, nur wenige Wälder, unendliche Ebenen. Es ist ein warmer, sonniger Tag, und wir lassen uns viel Zeit.
Abbildung 18: Sophienkathedrale in Kiew.
Irgendwo, unterwegs, als wir eine kleine Brücke überqueren, biegen wir rechts ab und finden an einem kleinen Flüsschen einen Platz für den LADA. Das Wasser ist kristallklar, und die Einzelheiten des Grundes sind bis in eine Tiefe von mehr als eineinhalb Metern deutlich zu erkennen. Winzige Fischchen lassen sich in der Uferzone ausmachen, Gründlinge vor einem Teppich von grünen Ranken der Wasserpest, die sich im Spiel der Wellen leicht bewegen. Das saftige Grün einer bunten Wiese erstreckt sich bis zum Ufer des Flusses, wo in größeren Abständen kleine Büsche und eine Trauerweide, deren Zweige den Wasserspiegel fast berühren, ihren Platz gefunden haben.
Renate ist begeistert von so viel landschaftlicher Schönheit. Sie steht schweigend am Ufer, mit Tränen in den Augen. Nachdem sie aus ihrer andächtigen Stimmung aufgewacht ist, wendet sie sich mir zu und meint: „Hier bleiben wir eine Weile. Ich will ins Wasser, um zu baden!“
Sie zieht sich ihren Badeanzug an und steigt in den Fluss. Das Wasser reicht ihr bis zum Po, sie kann nur plantschen, aber nicht schwimmen. Ich prüfe die Temperatur mit der rechten Hand, und das Gefühl der Kälte lässt mich erzittern. Doch Renate meint nur: „Herrlich, dieses Wasser, klar und kühl!“
Als meine Liebste ihr Bad beendet hat, empfange ich sie mit einer Tasse heißem Kaffee, den ich inzwischen auf dem Reisekocher zubereitet habe. Wir hocken im Grase, am Ufer des Flusses und nehmen dieses Erlebnis als einen wundervollen Vorboten für all das, was wir noch auf unserer Reise erleben sollen.
Gegen Mittag erreichen wir Korez, eine Kleinstadt in der Ukraine. Am Marktplatz treffen wir auf eine Gaststätte, sie macht einen einladenden, sauberen Eindruck. Beide sind wir recht hungrig aber auch neugierig auf den ersten Besuch in einem einfachen nationalen Restaurant des Landes. Etwas Sorge haben Renate und ich, ob wir das Auto unbeaufsichtigt verlassen können. Zu viel hatte man uns davon erzählt, dass die Scheibenwischer gern abmontiert und gestohlen würden. Doch wir entschließen uns, den LADA vor dem Restaurant zu parken und die Gaststätte zu betreten. Unsere Mittagsmahlzeit ist ein ukrainischer Borschtsch und je eine Scheibe Weißbrot. Zweimal schaue ich nach unserem LADA, doch niemand kümmert sich um ihn. Er steht unberührt da, wie wir ihn verlassen haben.
Gegen 17.30 Uhr erreichen wir das Motel „Prolisok“, es liegt am westlichen Stadtrand von Kiew. Die Anmeldung vollzieht sich reibungslos. Wir erhalten unser Zimmer, machen uns frisch und begeben uns in die Gaststätte des Motels zum Abendessen. Alle Tische sind eingedeckt, die Gäste lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Aus der Speisekarte, die uns der Kellner vorlegt, wählen wir Stör nach russischer Art: „Осетр русский стилъ!“ Und keinesfalls bedauern wir unsere Wahl. Es ist lecker, was uns der Kellner nach einer knappen halben Stunde serviert. Dazu trinken wir einen Schoppen Weißwein von der Krim.
Am nächsten Tag ist eine Stadtrundfahrt mit dem INTOURIST Reiseleiter im eigenen Fahrzeug gebucht. Meist haben wir das Glück, dass bei diesen Exkursionen der Reiseleiter im eigenen Auto, neben mir als Fahrer, seinen Platz einnimmt. Auch diesmal ist es so, doch hat er heute noch ein zweites Fahrzeug zu betreuen, das uns begleitet. Wir müssen also an den wichtigen Punkten der Stadt halten und in kleiner Gruppe seinen Erläuterungen lauschen. Die Gesamtstrecke, die wir bei unserer Stadtrundfahrt in Kiew bewältigen, sind 60 Kilometer, - teilweise bei einem chaotischen doch recht toleranten Stadtverkehr. Als störend empfinde ich die ständige Huperei der Fahrer auf den Straßen, schon beim geringsten Anlass.
Abbildung 19: Eingangstor zur Festung Brest-Litowsk.
Die Fahrt geht über die Magistrale, den „Krestschatik“, zum Höhlenkloster „Petscherska Lewra“ mit dem Besuch der Katakomben, zur alten Uspenski-Kathedrale, zur Sophienkathedrale mit ihrer wundervollen Wandmalerei, zum Goldenen Tor, zur Andreaskirche, zur Wladimir Kathedrale, zum Kunstmuseum, zum Dnjepr-Hügel, mit einem weiten Ausblick auf den gewaltigen Fluss, zur Roten Universität, den Denkmälern von Bogdan Chmelnezkyj und Taras Schevschenko sowie zum Heldenfriedhof. Hier erleben wir den Besuch eines Brautpaares mit seiner Hochzeitsgesellschaft, das seinen Blumenstrauß niederlegt. Alle paar Minuten wechseln sich die Paare ab, immer wieder steht eine neue Hochzeitsgesellschaft andächtig am Memorial.
Ende Juni 1979 starten Renate und ich zur Fahrt auf die Krim. Bei der Anreise bietet uns Zbyschek in seinem Warschauer Haus für eine Woche Unterkunft. Inzwischen ist er als Englischlehrer in der Erwachsenenbildung tätig. Einen besseren Stadtführer hätten wir nicht finden können. Mit ihm erkunden wir das Stadtzentrum, insbesondere den Warschauer Altmarkt, besuchen an einem sonnigen Sonntagvormittag ein unvergessliches Klavierkonzert im Łazenki-Park, fahren mit Zbyscheks winzigem Polski Fiat hinaus zum Palastmuseum Wilanów und in die Umgebung von Warschau.
Unsere eigentliche Reiseroute beginnt mit dem Grenzübergang Brest-Litowsk. Diesmal klappt alles schnell, reibungslos und ohne alle Probleme. Bereits früh um acht Uhr, nach zwei Stunden Fahrt, kommen wir am Übergang an und brauchen dem Grenzer nur die Papiere vorzuzeigen. Der schaut uns prüfend ins Gesicht und lässt uns weiterfahren. Wir verweilen noch einige Augenblicke bei den äußeren Festungsanlagen am Bug und befinden uns schon Minuten später auf der Weiterfahrt nach Minsk.
Für 1980 hatten wir schon im Vorjahr das Sonderprogramm für Mittelasien beantragt. Die Route mit dem Grenzübergang Shaginia war seit Monaten in unserer Hand, doch wenige Tage vor der Abreise erhielten wir vom Reisebüro der DDR eine Nachricht: Wir sollen durch die Tschechoslowakei und nicht durch Polen anreisen und uns am vorgesehenen Tag am Grenzübergang Ushgorod melden, dort würden wir die neue Route ausgehändigt bekommen. Der Grund für diese Umleitung war klar: In Polen war die freie Gewerkschaft Solidarność gegründet worden, die Danziger Werftarbeiter trugen Lech Wałęsa auf ihren Schultern. Es war der Aufstand ausgerufen worden und der Ausnahmezustand.
Abbildung 20: Blick auf ein Dorf in den Waldkarpaten.
Am 3. Oktober, früh um vier Uhr, fahren wir los und treffen gegen 17.00 Uhr in Frýdek-Místek, bei Renates Freunden Toni und Mascha, ein. Von hier aus geht es am folgenden Tag, um acht Uhr, weiter, durch eine wundervolle Landschaft: Rechts die Niedere Tatra, links der Autostraße, in der Ferne, die weißen Gipfel der Hohen Tatra. Noch nie hatten wir solch einen Anblick erleben können, mit aller Macht zieht es uns bei herrlichstem Sonnenschein in die Berge. Der Grenzübergang ist erst am nächsten Tag vorgesehen, also haben wir noch einige Stunden Zeit für Štrbské Pleso und eine kurze Wanderung in der Hohen Tatra.
Dann, während der Weiterfahrt, ändert sich das Wetter. Es ist bitter kalt und regnerisch, bald auch schon stockdunkel. Geplant haben wir, kurz vor der Grenze im Auto zu übernachten. Doch nun scheuen wir davor zurück, sicher würden wir eine ganz üble Nacht durchzustehen haben und völlig durchgefroren aufwachen oder gar nicht erst eingeschlafen. Also begeben wir uns auf die Suche nach einer Unterkunft, und wir finden das Hotel „Jalta“, an einem See in Michalovce, etwa 40 Kilometer entfernt vom Grenzübergang.
Als wir das Hotelrestaurant betreten wollen, verwehrt uns die Kellnerin den Eingang: „Rifles njet!“ Jeans, sagt sie, wären nicht erlaubt. Nur mit Mühe und Not können wir in der Lobby einen Kaffee trinken. Die laute Tanzmusik durch eine ungarische Gruppe stört unseren Schlaf kaum, doch zweimal werden wir durch das Klingeln des Telefons geweckt. Niemand meldet sich.
144 Kronen haben wir zu entrichten, als wir gegen sieben Uhr das Hotel verlassen und die Fahrt zum Grenzübergang Ushgorod aufnehmen. Die Kontrolle verläuft reibungslos, man erwartet uns, doch es gibt keine Unterlagen und Talons wie üblich, nur eine Routenanweisung für die offizielle Autotouristenstrecke über Lwow nach Tschernowzy. Wir würden alles Notwendige für die Weiterreise in Tschernowzy erhalten, teilt uns der Grenzoffizier mit: Unsere Route wäre geändert worden, wir müssten von Odessa nach Taschkent abfliegen und nicht von Kiew. Dann sind noch unsere Äpfel gegen ein Protokoll abzuliefern, und wir können den LADA starten.
Vor uns liegt eine wunderbare Fahrt durch die Waldkarpaten, doch mit einem vorgeschriebenen Umweg von etwa 80 Kilometer: nach Nordost bis Lemberg, dann südwärts über Ternopil nach Chernowitz, Moldawien. Bei Stryj, am Bug, von der Touristenstrecke nach Süden abzuweichen, quer durch die Waldkarpaten zu fahren und über Iwano-Frankiwsk das ukrainische Chernowitz zu erreichen, ist uns verwehrt, weil dieser Weg nicht zu den offiziellen Routen zählt.
Abbildung 21: Ziehbrunnen in Moldawien, der Storch als nationales Symbol der Fruchtbarkeit.
Was hat mich dazu verleitet, von der Hauptstrecke abzuweichen und durch die bewaldeten Hügel der Karpatenlandschaft zu fahren. Es war sicher der Gedanke an Christine, die mit ihrer gesamten Familie Anfang des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat vertrieben worden war. Als das Gebiet nach dem Wiener Kongress zum Österreichischen Kaiserreich gehörte, waren viele Deutsche dahin ausgewandert, unter ihnen auch die Vorfahren meiner Tante. Im Ersten Weltkrieg stark umkämpft, fiel das Gebiet an Polen und vor dem zweiten Weltkrieg durch die geheimen Stalin-Hitler-Vereinbarungen an Russland. Christines Familie wurde durch die Nazis in das damalige Wartheland, nach Łodz, umgesiedelt, wo ein Bruder meiner Mutter die junge Frau in den ersten Kriegsjahren heiratete.
Wie gefährlich die Abkürzung der Fahrt ist, wird uns erst viel später klar. Doch wir haben Glück und müssen nur einmal, in Iwano-Frankiwsk, mit einer halsbrecherischen Fahrt durch tiefen Schlamm, einem Fahrzeug der ukrainischen Verkehrspolizei in weitem Bogen ausweichen. Wir fahren durch eine einmalig schöne Landschaft und werden nie abgestoppt. Einmal wundert sich ein alter Bauer, der mit seinem Traktor auf dem Felde der Kolchose tätig ist, über den LADA und unser Autokennzeichen. Woher wir kämen, will er wissen, und in aller Freundlichkeit wünscht er uns eine gute Reise: „Хорошо ездить!“
Abbildung 22: Rast in einer Gaststätte in Moldawien.
Beide sind wir bester Laune, aber die uns umgebende Landschaft ist auch zu schön, obwohl der Himmel über den Waldkarpaten sich mit einer Wolkendecke bedeckt hat. Wir haben rundum einen klaren Blick auf die Höhen und Täler, oft auch auf die einsamen Dörfer Wolhyniens. Aus einem stammt die Familie meiner Tante. Renate ist von der Landschaft gefangen. Oft halten wir an, das eine Mal bei einer Bäuerin, die neben einer alten ausgedienten Badewanne voller Pilze hockt, Hallimasch, ein Pilz, den wir in der Dresdner Heide immer stehen ließen. Doch in der Slowakei, Polen und in der Ukraine wird junger Hallimasch in kleine Gläser gefüllt und eingesäuert. Schon einige Mal haben wir ihn als kleine Zuspeise zu einem Wodka - „Cто грамм“, hundert Gramm - serviert bekommen.
Wir bummeln in niedrigem Tempo durch die Gegend und wundern uns, warum es plötzlich so stockfinster ist. Wir haben den 05. Oktober, eingefangen von der Landschaft hatten wir die zwei Stunden Zeitunterschied völlig übersehen.
Unser Ziel ist ein mittelgroßes Hotel in Tschernowzy, ein anderes, als uns in Ushgorod angegeben worden war. Ein Wegweiser führt uns zum Intourist-Hotel „Bukowina“. Und tatsächlich, hier ist man auf unsere Ankunft vorbereitet. Die Ukrainerin an der Rezeption kennt unsere Namen, doch sie hat eine betrübliche Mitteilung: „Keine Marschroute! Weiterfahren bis Odessa, Hotel „Krasnaja“, dort neue Dokumente von INTOURIST!“
Renate macht ein etwas enttäuschtes Gesicht, solche Unsicherheiten und Fahrten ins Blaue sind ihr nicht eben angenehm, doch ich tröste sie damit, dass uns das sowjetische Reiseunternehmen bisher noch nie enttäuscht hat.
Beim Frühstück im Hotelrestaurant begegnen wir einem DDR-Bürger aus Berlin, Mitglied eines Vortrupps für den Bau der Erdöltrasse. Er wird auf uns aufmerksam, weil er plötzlich auf Landsleute stößt und sie an der Sprache erkennt. Mir fehlt beim Frühstück etwas Wechselgeld, sofort eilt er hinzu und reicht mir die fehlenden 20 Kopeken.
Erst relativ spät, gegen Mittag, starten wir zur Weiterfahrt von der Ukraine, über Moldawien nach Odessa. Innerlich fühlen sich Renate und ich aufgrund der Umstände immer noch etwas wie auf der Anreise in den eigentlichen Urlaub, so völlig ohne die offiziellen Reisedokumente und mit der Unsicherheit, ob wir von Odessa oder von Kiew den Flug nach Mittelasien starten werden. Doch das hindert uns nicht, uns an der Fahrt durch die Ukraine und Moldawien zu erfreuen. Wir freuen uns auf Odessa und sind guter Hoffnung, dass wir dort endlich unsere offizielle Reiseroute und die Voucher für Mittelasien erhalten werden.
Auf der breiten Überlandstraße, rechts und links begleitet von Weinbergen, nähern wir uns Kischinjow, der Hauptstadt von Moldawien. Immer wieder führt uns der Weg durch kleine Dörfer, vorbei an Bauernhütten und Ziehbrunnen, die mit Schnitzereien und farbigen Ornamenten geschmückt sind. Der Storch, ein Wahrzeichen des Landes, wiederholt sich als stilisiertes Symbol in allem Dekor. Der schlanke Hals der kolossalen Holzstatue eines Storches, mit Kopf und Schnabel, dient einem Ziehbrunnen als mehrere Meter langer Schwengel. Unten, an der Ziehkette, hängt der Schöpfeimer, ebenfalls hölzern.
Abbildung 23:Berühmte Treppe am Hafen in Odessa.
Noch bevor wir Kischinjow erreichen, treffen wir am Rande der Straße auf eine Gaststätte, erbaut im Stil eines kleinen moldawischen Schlösschens, aus rötlichem Backstein, mit Zinnen am Dach und schmiedeeisernem Gitterwerk vor den Fenstern. Wir parken den LADA und betreten die Gaststube. Renate und ich sind die einzigen Gäste und werden von einem dunkelhaarigen Kellner in moldawischer Volkstracht bedient. Nur wenige Speisen sind auf der Karte vermerkt, darunter ein halbes Hühnchen mit frischem Salat, weißem Brot und einer Schale saurer Pilze. Als Getränk bestellen wir je ein Glas Muskatwein aus der Region. Eine gefüllte Wasserflasche und zwei Gläser stellt uns der Kellner, ohne dass wir sie verlangt haben, auf den Tisch.
Wie im benachbarten Rumänien und auf der Krim hat der Weinbau in Moldawien eine lange Tradition. Es existieren günstige geologische und klimatische Bedingungen für den Anbau sowohl heimischer Rebsorten wie auch überregionaler, unter anderem Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot und Müller-Thurgau.
Am späten Nachmittag erreichen wir das Hotel „Krasnaja“ in Odessa, ein Bauwerk in der Mischung von Renaissance und Barock, erbaut 1898, - sehr kühl und vornehm das Ambiente. Der erste Anblick erinnert mich an die Weinfeste zaristischer Offiziere, wie sie in der russischen Literatur beschrieben und oft im Film dargestellt werden. Abwechselnd rot und weiß ist die äußere Fassade, verziert mit Bordüren und Ornamenten, mit winzigen Balkons und schmiedeeiserner Brüstung.
Das Gebäude steht in der Puschkin Straße, in unmittelbarer Nähe eines Hauses mit der Gedenktafel zu Ehren des großen russischen Dichters, der sich in den Jahren 1820 bis 1824 in verschiedenen Orten Südrusslands, unter anderem auch in Odessa, aufhielt. In seiner Erzählung „Eugen Onegin“ erwähnt Puschkin die Stadt und lobt sie für die dort herrschende Freizügigkeit und Offenheit.
Wir betreten die Lobby auf einem roten Teppich. Der Raum wird beherrscht von der Farbe Rot, am Treppenaufgang zum Obergeschoss prangt eine schwarzglänzende Frauenstatue: Jugendstil, wenn ich nicht irre. Die Stufen sind bis obenhin bedeckt mit einem dunkelroten, dicken Läufer.
Abbildung 24: Hotel "Krasnaja" in Odessa.
Man ist auch hier auf uns vorbereitet, und endlich erhalten wir alle unsere Unterlagen für die Weiterreise nach Mittelasien. Anders, als man uns in Ushgorod mitgeteilt hat, fliegen wir nun doch nicht von Odessa, sondern von Kiew nach Taschkent.
Ich bin froh und erleichtert, es gibt einen guten Grund, der mich nach Kiew zieht: Während wir uns in Mittelasien aufhalten, soll in der Werkstatt, unmittelbar am Motel „Prolisok“, der Auspuff unseres LADA erneuert werden. Ein Dresdner Freund, der seit einem Jahr auf einer Baustelle bei Moskau tätig ist, hat mir den Rat gegeben. In der DDR hätte ich mehrere Monate auf eine neue Auspuffanlage warten müssen.
Dazu kommt, dass Renate und ich auf unseren Fahrten durch die Sowjetunion die Strecke von Odessa nach Kiew, quer durch den Süden der Ukraine und die ukrainischen Steppengebiete, Siedlungsgebiete der russischen Kosaken, bisher noch nicht kennengelernt haben.
Selbständige Kosakenverbände waren es, die als Wehrbauern den Süden Russlands gegen die häufigen Überfälle der Krimtartaren schützten. Katharina II. von Russland wusste das zu schätzen. Nach und nach wurden die freien Kosakenverbände in die russische Armee integriert. Vor allem bei der Eroberung Sibiriens, Mitte des 16. Jahrhunderts, spielten die Kosaken unter ihrem Hetmann Jermak eine große Rolle.
Ursprünglich war das Gebiet um Odessa besiedelt durch verschiedene Steppenvölker, im frühen Mittelalter durch ostslawische Stämme, die von den Türken verdrängt wurden. Im russisch-türkischen Krieg von 1787 bis 1792 wurde das Gebiet durch die Russen unter dem Befehl des Generalmajors Joseph de Ribas eingenommen. Die russische Zarin Katharina II. erteilte im Jahre 1794 den Befehl zur Gründung der Stadt. In der Folgezeit und vor allem unter dem russischen Grafen Michail Woronzow, als Generalgouverneur von Neurussland und Bessarabien, nahm Odessa einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung.
Abbildung 25: Südukrainisches Dorf am Rande der Landstraße.
Odessa hat zur Zeit unseres Besuches knapp eine Million Einwohner, sie ist die wichtigste Hafenstadt des Landes am Schwarzen Meer. Auf die späte Gründung der Stadt ist der schachbrettartig geplante Verlauf ihrer Straßen zurückzuführen. Wir laufen durch die Stadt, auf geradlinigen Straßen zum Meeresbahnhof und zu der berühmten Freitreppe. Nie können wir uns verlaufen, alle Wege treffen im Zentrum von Odessa im rechten Winkel aufeinander.
Am helllichten Tag kehren wir ein, mitten in der Stadt, in ein Spezialgeschäft für Wein und Sekt. Die Wände, bis obenhin zur Decke verbaut mit Weinregalen, darin Flaschen über Flaschen: schwarzglänzende mit Etiketten, rötlich und grünschimmernd. Eine schmale Holztreppe führt hinunter, in eine etwas tiefer gelegene Räumlichkeit, fast schon Kellerraum. Auch hier überall Regale mit Flaschen und in unregelmäßigen Abständen verteilt, kleine, hochbeinige runde Tische, daran die Gäste, mit Weingläsern in den Händen. Renate und ich stellen uns an eine der Tafeln und trinken jeder ein Glas Massandra, Wein von der Krim.
An der berühmten Freitreppe angekommen, steigen wir die 192 Stufen hinunter und schauen zurück. Der Eindruck wäre gewaltig, auch ohne die optische Täuschung durch den Erbauer. Er hat die Perspektive bewusste verschärft: Oben hat die Treppe eine Breite von elf Metern, unten von einundzwanzig. Ich habe plötzlich die erschütternde Szene aus dem Stummfilm des Regisseurs Sergej Eisenstein über den Matrosenaufstand auf dem Panzerkreuzer Potemkin, aus dem Jahre 1905, vor Augen, als ein Kinderwagen mit dem darin liegenden Kind langsam die Stufen der riesenhaften Treppe hinabrollt.
Auch ein junges jüdisches Ehepaar, das wir in der Rezeption des Hotels kennengelernt haben, steht bei uns und ist beeindruckt. Die beiden Moskauer und ihr etwa vierjähriger Sohn waren gestern mit dem Flugzeug angekommen und haben sich für eine Woche im Hotel eingemietet. Auch sie besuchen zum ersten Mal die Hafenstadt am Schwarzen Meer.
Am Abend treffen wir die beiden wieder, als wir uns in das Restaurant des Hotels begeben, um etwas zu essen. Eine „Administratorin“, die uns am Eingang begrüßt, hilft uns bei der Platzsuche. Der große Raum ist voller Gäste, nur wenige Plätze sind frei. Auf einem Eckpodium spielt eine Tanzkapelle, es ist so laut, dass man sich kaum verständigen kann. Die Dame führt uns zu einem Seitentisch, an dem bereits drei Personen Platz genommen haben.
Wir begrüßen die drei, stellen uns als Dresdner vor und nehmen Platz. Der seriös gekleidete Mann im mittleren Alter ist Direktor eines Erdölunternehmens in Baku, die beiden Frauen sind seine Sekretärin und einer seiner Mitarbeiterinnen. Schon nach wenigen Minuten erscheint auch der Kellner, trotz der Fülle im Restaurant. Die Dame am Empfang hat ihn uns geschickt.
Abbildung 26: Ajaz, Direktor eines Erdölbetriebes in Baku, mit seinen beiden Mitarbeiterinnen, rechts Renate.
Während Renate und ich unser Abendessen einnehmen, kommen wir etwas umständlich ins Gespräch mit den Nachbarn. Man verständigt sich erneut in diesem Gemisch aus russischen und englischen Brocken. Der Tischnachbar lädt uns zu einer Flasche Wein ein, und wir kommen auf Dresden zu sprechen. Was für eine interessante Stadt, meint der Aserbaidschaner: der Zwinger, die Gemäldegalerie, die Schätze im Grünen Gewölbe. Der Mann ist gut informiert, ein Bergbauingenieur, der viel in der Welt umhergekommen ist. Er kennt auch die Bergakademie in Freiberg, Sachsen. Uns spricht er seine Bewunderung aus, ob unserer so weiten Autoreise und die Flüge in die mittelasiatischen Zentren.
Wir interessieren uns für Baku, für die Ölförderung im Kaspischen Meer, wo 1873 die erste Ölquelle angebohrt wurde. Die von den Gebrüdern Nobel gegründete Ölgesellschafft hatte sich in wenigen Jahren zum führenden Unternehmen in der Welt entwickelt. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lieferte es die Hälfte des weltweit benötigten Erdöls. Doch in den Folgejahren, nach der Erschließung weiterer Erdölfelder vor allem im mittleren Osten, verlor es zunehmend an Bedeutung.
Nach knapp zwei Stunden verabschieden wir uns von den Tischnachbarn. Unser freundschaftliches Gespräch endet mit einer Einladung: Renate und ich sind herzlich nach Baku eingeladen. Er wäre stolz, meint der Aserbaidschaner, uns die wunderschöne Stadt, seine Umgebung und das Erdölunternehmen, auf Pfählen, mitten im Kaspischen Meer, vorzeigen zu können.
Am nächsten Tag, es ist der 7. Oktober 1978, begrüßt uns eine Reiseleiterin an der Rezeption, des Hotels. Sie setzt sich neben mich in den LADA, und es beginnt die von uns gebuchte Stadtrundfahrt. Sie führt in den Keller einer Kelterei, zum Palast des ehemaligen Gouverneurs Woronzow, in den Hafen, zur Freitreppe und in die Umgebung der Stadt, zu einem Erholungspark und einem der vielen Badestrände an der Schwarzmeerküste.
Eine besondere Sehenswürdigkeit ist das im historistischen Stil erbaute Opernhaus, geplant durch ein Wiener Architekturbüro und eröffnet im Jahre 1887. Vorläufer war das im Jahre 1809 eröffnete erste Theater in Odessa, als Werk eines St. Petersburger Architekten, ein im klassizistischen Stil errichtetes Gebäude. Durch einen Brand im Januar 1873 wurde es vernichtet.
Früh um halb sieben Uhr, am folgenden Morgen, starten wir unseren LADA bei recht trübem Wetter zur Fahrt nach Kiew. Die breite Ausfallstraße ist bestens in Schuss, wir kommen zügig voran, fahren durch die fruchtbaren südlichen Regionen der Ukraine. 293 Kilometer liegen vor uns, vorbei an abgeernteten Getreide-, Sonnenblumen- und Maisfeldern von gewaltiger Ausdehnung. Die Fahrt führt uns fast unmerklich über viele Kilometer bergauf und bergab. Ist man auf einer Höhe, hat man einen weiten Überblick auf die Fahrbahn und die umliegende Landschaft. Es ist noch früh am Tage, und der Himmel ist über und über mit einer grauen Wolkenschicht überzogen.
Abbildung 27: Am südlichen Bug, Straße von Odessa nach Kiew.
In einer Niederung, zwischen langestreckten Höhenzügen, erreichen wir eine Brücke, daneben steht ein Holzschild mit dem Namen des Flusses: „Южныѝ Буг“, südlicher Buch. Im Nebel der Niederung sind die Häuser im nahen Dorf nur als dunkle Schatten auszumachen. Eine am Ufer des Gewässers angepflockte Ziege schaut unserem Treiben neugierig zu. Wir haben angehalten und parken das Auto in einer Ausbuchtung der Straße. Noch in Odessa hatten wir etwas Brot und Käse eingepackt, nun, am nördlichen Ufer des Flusses, machen wir eine kurze Fahrpause und frühstücken.
Als wir weiterfahren, treffen wir irgendwo, auf halbem Wege nach Kiew, auf einen einsamen Gasthof. Recht modern und gepflegt schaut er aus, sicher ist er erst vor wenigen Jahren erbaut worden. Wir sind die einzigen Gäste, halten uns jedoch nicht lange auf, sondern schauen uns nur mal kurz um und trinken ein Glas Mineralwasser.
Bereits um frühen Nachmittag, um 15.00 Uhr, erreichen wir das Motel „Prolisok“, am Rande von Kiew. Es bleibt mir nicht viel Zeit für die Anmeldung in der Unterkunft und die Unterbringung des LADA in der Werkstatt. Doch beides klappt fix und ohne Probleme: In der Rezeption wird uns der Flug nach Taschkent für morgen, 15.00 Uhr, angekündigt; man würde uns um 12.00 Uhr mit dem Wolga abholen. Und auch in der Werkstatt nimmt ein freundlicher Meister unser Fahrzeug zur Reparatur entgegen und meint, auch die Unterstellung für die folgenden drei Wochen sei gesichert.
Renate und ich sind glücklich, dass alles so gut und ohne unangenehme Überraschungen geklappt hat. Wir setzen uns in das Hotelrestaurant, bestellen uns ein Abendessen und trinken nach dieser langen und erlebnisreichen Anreise zum Flug nach Mittelasien eine Flasche Sekt.
Für den Sommer 1982 hatten wir uns auf eine Reise der Autotouristik über den Goldenen Ring um Moskau entschieden. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen, unser Reisegepäck lag gestapelt im Arbeitszimmer, und wir waren schon in bester Reisestimmung, als mir ein gewaltiges Unglück widerfuhr: Am frühen Morgen, bei der Fahrt zur Arbeit, hatte ich einen Autounfall. Unser Fahrzeug war im Motorbereich total verbeult, die Vorderachse verzogen. In der DDR musste man in solch einem Fall oft ein halbes Jahr auf einen Reparaturtermin in der Werkstatt warten.
Ein guter Freund, der sich für einige Jahre mit seiner Ehefrau in der Moskauer Umgebung zur Arbeit aufhielt, lieh uns seinen Moskvich. Doch das Auto war abgemeldet, ich hatte eben noch Zeit, es wieder anzumelden und den Versicherungsbetrag auf meinen Namen einzuzahlen. Das sollte sich später, am Grenzübergang Brest, als großer Glücksumstand erweisen.
Am 8. Juni reisen wir in Warschau zur Übernachtung bei unserem polnischen Freund Zbyschek an. Bei der Fahrt durch Polen begegnen uns nur insgesamt 37 Fahrzeuge. Wir treffen vor fast jeder Stadt auf Armeekontrollpunkte und fahren an vielen Investruinen vorbei. Benzin ist rationiert, tanken dürfen die polnischen Bürger nur nach Endziffer der Autokennzahl, so zum Beispiel am 9., 19., 29. des Monats jeweils zehn Liter, Kosten je Liter: 32 Zł. Auch Alkohol und Fleisch ist rationiert: zwei Liter Schnaps und zweieinhalb Kilo Fleisch pro Person und Monat. Wie unmittelbar nach dem Kriege blüht der Schwarzmarkt.
Was bisher bei unseren weiten Fahrten mit dem LADA nie notwendig war, nun aber mit dem geliehenen Moskvich: Ich muss mich zur Reparatur in eine Werkstatt bemühen, um Kolben, Bremskreis und Rückleuchte in Ordnung bringen zu lassen.
Abbildung 28: Links unser Moskvich, rechts ein russischer, mit Stalinbild an der Frontscheibe.
Am nächsten Morgen, es ist der 9. Juni, fahren wir weiter nach Brest und halten um 12.45 Uhr am Grenzübergang. Ein Grenzoffizier nimmt uns in Empfang: „Докуменуы пoжалуйста!“ Ich überreiche ihm unsere Ausweise und die Fahrtenpapiere. Er schaut sie sich an, blättert sie einzeln durch und stutzt, - schaut auf, wirft einen Blick auf das Fahrzeug, auf das Schild mit der Kennziffer und meint: „Прохода нет!“ – Kein Grenzübergang möglich!
Und der Grund? Auf den Fahrtpapieren ist der Lada mit seinem Kennzeichen angegeben, doch wir sind mit einem Moskvich unterwegs. Renate spricht etwas besser russisch als ich. Sie versucht dem Oberleutnant beizubringen, dass wir einen Unfall hatten und ein Freund uns sein Fahrzeug geliehen hat.
Ob das bei uns in der DDR möglich sei, ist die Frage des Grenzbeamten. Ja, ist meine Antwort und als Beweis zeige ich ihm die Fahrzeugpapiere. Doch auch das überzeugt den Mann nicht: Da sei doch der Name eines anderen Besitzers vermerkt. Er wird erst recht misstrauisch und schaut mich skeptisch an. Das geht so eine ganze Weile hin und her, zum Teil in gebrochenem Russisch, zum Teil mit einigen englischen Brocken. Alles ist jedoch erfolglos, der Mann lässt uns nicht passieren.
Dann endlich! Mir fällt ein, dass ich ein Papier mit meinem Namen und dem Kennzeichen des Moskvich im Besitz habe: die Versicherungspapiere. Als ich die dem Grenzer vorlege, kann ich ihn endlich überzeugen, und nach einem kurzen Telefonat mit irgendeinem Vorgesetzten lässt er uns passieren.
Eine Dreiviertelstunde hat die ganze Prozedur an der Grenze gedauert. Nun machen wir uns auf die Suche nach unserer Unterkunft im Hotel „Intourist“, einem Hochhaus im Zentrum von Brest-Litowsk. Schon eine halbe Stunde nach dem Grenzübergang betreten wir unser Zimmer in einem der oberen Stockwerke. Von dort fällt unser Blick auf eine von mehrstöckigen Häusern gesäumte breite Hauptstraße, die sich schnurgerade bis zum Horizont ausdehnt. Wir sind in den endlosen Weiten der Ukraine angekommen.
Es ist erst halb zwei, als wir den Moskvich erneut starten, um in eine Werkstatt zu fahren. Es ist eine Reparatur an der Kupplung notwendig. Ohne große Wartezeit wird der Schaden behoben, die Reparatur kostet uns 15 Rubel. Dann bleibt noch viel Zeit, um am Nachmittag das Gelände der 1836 bis 1842 erbauten und 1864 bis 1888 modernisierten Festung Brest, am Zusammenfluss der Flüsse Muchawez und Bug, zu besuchen.
Zu Beginn des 2. Weltkrieges, Ende Juni 1941, sollte die Festung durch deutsche Truppen unter dem Befehl von Generalmajors Fritz Schlieper im Handstreich genommen werden. Das wurde durch die sowjetische Besatzung verhindert. Seitdem gilt die Verteidigung der Festung Brest für Russland als die Heldentat schlechthin, und so errichtete man zu Sowjetzeiten einen viel besuchten Memorialkomplex auf dem Gelände der Festung.
Mit uns besuchen Schulklassen, Reisegruppen und eine große Zahl von einzelnen Besuchern die sogenannte Zitadelle, die aus rotem Backstein erbauten Kasernen, das gewaltige Denkmal zu Ehren der bei der Verteidigung der Festung gefallenen Sowjetsoldaten und die gigantische Festungsmauer.
Mit einem Spaziergang durch das Zentrum der Stadt beschließen wir unsere Gastrolle in Brest und begeben uns zurück in unser Hotel, zu einem Abendessen im Restaurant. Wir sind rechtschaffen müde, nehmen eine Dusche und begeben uns gegen acht Uhr zu Bett.