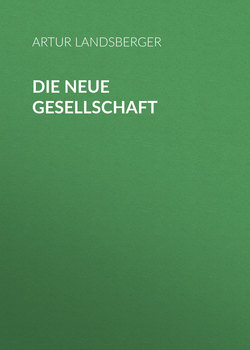Читать книгу Die neue Gesellschaft - Artur Landsberger - Страница 4
Drittes Kapitel
Mutter und Kind
ОглавлениеGünther entwickelte sich alle Tage mehr zu jener Gattung von Wunderkind, dem man in den Häusern der oberen Zehntausend auf Schritt und Tritt begegnet und dessen hervorragende Eigenschaften man mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmen kann.
Allein die Affenliebe von Eltern und Tanten verleiht die Gabe, in Häßlichkeit verborgene Schönheit, in Widerspenstigkeit den Ausdruck starken Willens und in unbekümmertem und ohne Rücksicht auf Zeit und Ort geübtem Nässen die Äußerung einer schönen Seele zu erblicken.
Der Gast hingegen, dem man dies Wunder vorsetzt, wendet sich mit Grausen – es sei denn, daß Rücksichten und gesellschaftlicher Takt ihn zwingen, zu loben und zu bleiben.
Cäcilie empfing jetzt viel Rekonvaleszensbesuche. Und Günther wurde bald jeden Nachmittag von halb fünf bis halb sieben zum Tee gereicht. Alle bestaunten ihn, und bei vielen hinterließ er einen schwer verwischbaren Eindruck.
Cäcilie fand, schon als er sechs Wochen alt war, daß er einem alten spanischen Granden aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, dessen Porträt in der Gemäldegalerie dem Ruhebett unmittelbar gegenüber hing, unverkennbar ähnlich sah.
Und als er nach weiteren vier Wochen das erste Mal unartikulierte Laute von sich gab, die anders klangen als das gewöhnliche Geplärre und einem abgerissenen Lallen glichen, rief Cäcilie begeistert:
»Hast du gehört, Leo, was er gesagt hat?«
Leo und Emma sahen sich erstaunt an.
Da lallte der spanische Grande von neuem.
»Hört ihrʼs nicht? Tarantella! ruft er ganz deutlich!« – Und sie fiel Leo um den Hals und rief:
»Ich bin ja so stolz! Es ist ein Wunderkind!«
Emma schüttelte den Kopf und dachte:
»Ist das eine verrückte Mutter!«
Cäcilie war wie ein Spürhund hinterher, daß Günther bei Emma stets einen Platz an der Sonne hatte. Oft zum Nachteil des andern Säuglings, dem Linkes den Namen Frida gaben. Aber Emma stellte, sobald Cäcilie draußen war, das Gleichgewicht wieder her und sorgte dafür, daß keins zu kurz kam.
Trotzdem blieb Günther stets um ein paar Kilo voraus. Und Franz dachte, so oft er vor Emma stand und seine Augen auf den beiden Kindern ruhten:
»Strammer ist ja der Junge. Aber das Mädel ist auch nicht übel.«
Aber er sprach es nicht aus, um Emma nicht zu kränken.
Für Cäcilie hingegen war Frida eine ständige Ursache des Stolzes und der Freude.
Kam Besuch, so versäumte sie nie, Günther gegen Frida auszuspielen.
»Soll man es für möglich halten,« fragte sie regelmäßig, »daß die beiden Kinder am selben Tage und zur gleichen Stunde geboren sind?«
Alle sagten, daß sie es nicht für möglich hielten, obgleich nicht jedem gleich der Gewichtsunterschied in die Augen fiel.
Und wenn sie dann aus der Kinderstube heraus waren und wieder im Salon saßen, dann sagte Cäcilie, falls es ihr nicht einer der Besucher vorweg nahm:
»Und da gibt es noch immer Leute, die für die allgemeine Gleichheit sind. Wo sich die Klassenunterschiede doch rein äußerlich so deutlich zeigen.« —
Einen Tanz gab es, als eines Morgens eine Probierdame von Gerson in Begleitung eines Laufjungen erschien, der auf seinem Rücken keuchend einen Berg von Kartons schleppte.
Emma wurde nach vorn gerufen. Die Kartons wurden geöffnet.
»Wat soll das?« fragte Emma drohend, stemmte die Fäuste in die Hüften und sah in die Kartons, die offen ringsum auf der Erde standen.
»Echte Spreewälder Kostüme!« sagte Cäcilie.
»Wollen die Jnädige aufʼn Maskenball jehn?«
»Aber nein. Emma, die sind für Sie!«
»Für mich? – Das wärʼ jelacht!«
»Das gehört sich so!« suchte Cäcilie sie zu belehren.
»Für wen?«
»Nu, überhaupt.«
»Für Sie! Das mag sein. Für mich nich! Warum haben Se sich da nich jleich so ʼne wendische Unschuld jenommen? Da hätten Sie das teure Kostüm gespart.«
»Aber Emma, bedenken Sie, Sie schonen Ihre Sachen!«
»Ausjeschlossen!« widersprach Emma. »Und denn überhaupt, im Tiergarten, mang die echten Spreewälderinnen! Ich werʼ mich blamieren! Fällt mir nich ein! Können Sie wendisch? Ich sagʼ Ihnen, das is, wie wenn Sie ʼn Frosch breitquetschen. Da verstehn Se kein Wort.«
»Das haben Sie ja nicht nötig.«
»Ich bittʼ Sie, man will doch auch mal ʼn Wort reden!«
»Schließlich, es lernt sich alles.«
»Ne, ne, da gibtʼs nichts! – Erzählen Sie das ʼmal meinem Mann, daß Se ʼne Spreewälder Amme aus mir machen wollen.«
»Das ist doch nur äußerlich.«
»Innerlich krempelt mich auch keiner um!« rief Emma.
Jetzt mischte sich auch die Probierdame in die Unterhaltung.
»Das Kostüm ist doch so kleidsam!« sagte sie. »Ich glaube, daß es Sie vorzüglich kleiden würde.«
»Sehn Se ʼmal an! Was Se nich sagen!« erwiderte Emma. – »Na, wie wärʼs denn, wenn Sie mal ʼn paar Monate darin rumliefen? – Wennʼs doch so kleidsam is! Der Jnädigen kommtʼs nich drauf an. Selbstredend troddele ich nebenher. Für alle Fälle! Und in Anspruch werden Se von dem Kind weiter nich jenommen.«
»Das ist eine Idee!« rief Cäcilie. – »Sie mit Ihrer Figur und dem Gesicht würden überall Aufsehen machen! Jeder würde fragen, wem der Junge gehört!«
»Jawoll!« bestätigte Emma. – »Das ist de beste Reklame für Sie und den Jungen – und für de Konserven.«
Cäcilie sah sie erstaunt an.
»Na ja!« fuhr Emma fort. »Wenn es denn heißt: Das is der Junge von der Konservenfabrik Berndt & Tie., was meinen Sie, wie soʼn lebendiges Plakat zieht!«
Cäcilien leuchtete das ein.
»Und was Sie da alles für Bekanntschaften machen!« reizte Emma die Probiermamsell.
Die protestierte und rief entsetzt:
»Gnädʼge Frau!«
»Sagen Se das nich!« widersprach Emma.
»Ich . . . bin . . »» rief die Probierdame atemlos.
»Ich weiß!« beruhigte sie Emma. »Sie sind! Aber das macht nichts. – Ich bin ja bei Ihnen. Und in soʼm Fall, wo Ihnen jemand zu nahe tritt, da nehmʼ ich ʼn mir schon beiseite und bringʼ ihm bei, daß Se man nur ʼne Atrappe sind.«
»Das ist ja toll!« rief die Probierdame.
»Jewiß!« sagte Emma. – »Aber das macht nichts. Wissen Se, ich habʼ so ʼne Ahnung. . . . Jlauben Sie übrigens an Ahnungen?«
»Ja!« sagte die Probierdame.
»Na sehʼn Se!« rief Emma. – »Denn müssen Seʼs einfach probieren. Ich sage Ihnen, das wird Ihr Glück!«
»Ja, wie kommen Sie denn darauf?« fragte die Probierdame interessiert.
»Pscht!« wehrte Emma geheimnisvoll ab. —
»Nicht reden! sonst wirdʼs nichts! Also, Fräulein, wollʼn Se?«
»Mein Gott, das ist doch unmöglich!«
»I Gott bewahre! Bei unserer Jnädigen is nichts unmöglich – von wo sind Sie?«
»Von Gerson.«
»Sehn Se ʼmal an! Na, mit dem Mann wird sich doch reden lassen. Oder glauben Se, der macht Bankrott, wenn Sie zwei Monate lang bei Berndts Amme spielen?«
»Ich werde das schon erledigen,« sagte Cäcilie, »schlimmsten Falls zahlt man drauf.«
»Da hören Seʼs, Fräulein! – Bei uns is es so fein, da wird immer draufjezahlt.«
»Und Ihre Ansprüche?« fragte Cäcilie.
»Gott, ich weiß ja gar nicht – ich war ja noch nie – was hätte man denn da zu tun?«
»Nichts!« erwiderte Emma.
»Ich weiß ja auch gar nicht mit so was Bescheid.«
»Sie haben nichts weiter zu tun, als hübsch auszusehen und alle Augen auf sich zu lenken.«
»Auf den Jungen!« rief Cäcilie.
»Vasteht sich! Das is natürlich der Zweck der Übung. Der Junge! – Na, und dann die Konserven!«
»Und Sie meinen wirklich, daß ich auf diese Weise . . .?«
»Pscht!« rief Emma und legte den Finger auf den Mund.
»Und wann wäre das?«
»Ich denke, daß es vorläufig genügt, wenn Sie meinen Sohn auf den Spaziergängen begleiten,« sagte Cäcilie. »Ob Sie nachher dann ganz zu uns kommen, nicht wahr, das müßte man dann erst sehen.«
»Jewiß!« stimmte Emma bei. »Das heißt, morgens von zehn bis zwölf und nachmittags von . . . ach so, zu den Tees, da müßte sich das Fräulein denn wohl auch schon bemühen. Sie macht doch ʼne janz andre Figur als ich.«
»Selbstredend!« erwiderte Cäcilie. »Was haben Sie in Ihrer jetzigen Stellung?«
»Neunzig Mark.«
»Schön. Ich will mit meinem Mann sprechen.
Ich denke. wir geben Ihnen das Doppelte.«
»Das heißt hundertfünfundzwanzig Mark,« sagte Emma
Die Probierdame machte ein verständnisloses Gesicht und Cäcilie bestätigte:
»So etwa!«
»Sehn Se!« rief Emma. »Ich kennʼ mich aus!«
»Sie heißen?« fragte Cäcilie.
»Fiffi Lehmann.«
»Wie reizend!« rief Cäcilie. »Fiffi! – Sie wohnen bei Ihren Eltern?«
»I Gott bewahre!« erwiderte Emma. – »Wie wird se denn, wenn se Fiffi heißt.«
»Bei Bekannten!« sagte Fräulein Lehmann.
»Bei Bekannten wohnt sichʼs ja auch ganz nett,« meinte Emma, nahm eins der Spreewälder Kostüme heraus und sagte: »Ja, Fräulein Fiffi, dann werdʼn Se wohl ʼmal in so ʼne Garnitur steigen müssen.« Fiffi zog Rock und Bluse aus, und Emma half ihr in eins der Kleider.
»Nu, was sagen Se?« fragte Emma.
»Prächtig! prächtig!« rief Cäcilie. – »So ʼne Amme soll uns noch ʼmal jemand nachmachen!«
Fiffi sah in den Spiegel und gefiel sich.
»Kann ich denn dazu die Lackschuhe und die seidenen Strümpfe tragen?«
»Erst recht! erst recht!« rief Emma. »Nu machen Se man gar keine Faxen weiter und kommen Se! Sehn Se bloß, wie die Sonne scheint! Jetzt fahrʼn wir jleich mit dem Jungen in de Siegesallee!«
»Und Gerson?« fragte Fiffi unschlüssig.
»Das erledigt die Jnädige – Also denn!« Sie nahm Fräulein Lehmann unter den Arm und ging mit ihr hinaus. – »Na, der Junge wird Augen machen!« sagte sie.
»Und Sie meinen wirklich . . .?«
»Pscht!« rief Emma und hielt ihr den Mund zu.
Eine Viertelstunde später fuhr Fiffi den jungen Günther durch die Siegesallee.
Emma ging triumphierend daneben.
Fiffi fiel jedem, der vorüber kam, auf. Die Leute blieben stehen und sahen ihr nach. Mehr als einmal hätte Emma nur ein paar Schritte zurückzubleiben brauchen – und Günther hätte seine erste Straßenbekanntschaft gemacht. —
Fiffi machte auch auf Leo einen ausgezeichneten Eindruck. Zwar schien ihm als Kaufmann Zweck und Notwendigkeit dieser Neuerwerbung nicht einwandsfrei erwiesen. Doch irgend etwas in ihm sträubte sich dagegen, diesen Zuwachs seines Hauspersonals zahlenmäßig zu werten.
Es war dasselbe Gefühl, das ihn bei der Lösung der Etikettenfrage leitete. Denn Fiffi ließ sich schwer in das Hauspersonal einreihen. Sie behauptete, höhere Töchterschulbildung zu besitzen und zur Erweiterung ihrer französischen Kenntnisse längere Zeit in Paris gewesen zu sein.
Beiden Berndts fehlte die Fähigkeit zur Nachprüfung. Französische Seifen und Parfüms und ein Dorinlappen, mit dem sie sich alle halbe Stunde leidenschaftlich die Nägel polierte, waren keine stichhaltigen Beweise. Und daß sie zu Cäcilie nie anders als Madame, statt danke merci und zu Günther, wenn sie gutgelaunt war, Cheri sagte – nun ja, allʼ das sprach für die Richtigkeit ihrer Angaben, schließlich aber waren das Dinge, die man sich auch ohne Spezialstudium in Paris aneignen konnte.
Jedenfalls: Dienstpersonal im üblichen Sinne war Fiffi nicht. Man konnte sie nicht an die Leutetafel setzen; und sie in ihrem Spreewälderkostüm mit dem Charakter einer Gouvernante oder Hausdame zu den herrschaftlichen Mahlzeiten heranzuziehen, war gleichfalls unmöglich.
Auch Franz, der sonst stets Rat wußte, fand keine andere Lösung als: selbständige Haushaltung. – Fiffi bekam im Seitenflügel der Villa ihre eigenen Räume, aß auf ihrem Zimmer, und ihre Lebensführung glich der eines kostbaren Vollbluts. Sie wurde von der Dienerschaft abgewartet und verwöhnt. Früh am Morgen wurde sie von der Zofe frisiert und machte Toilette. Dann wurde sie von Emma abgeholt, vor Günthers Wagen gespannt und zwei Stunden im Freien bewegt. Nachmittags, wenn Besuch kam, fanden Besichtigungen statt, die sie von Gerson her gewöhnt war. Und dann erschien bei gutem Wetter Emma noch einmal, um sie zu einem zweiten Spaziergang zu holen. Von sieben ab aber war sie sich selbst überlassen und war freie Herrin ihrer Zeit.
So vergingen Wochen und Monate, bis Emma eines Tages sagte: Bis hierher und nicht weiter.
Am selben Tage machte sich der junge Herr Berndt von Emma unabhängig.
Fiffi bedeutete für Emma eine Entlastung. Zwar die eigentlichen Leistungen ruhten nach wie vor auf Emmas Schultern. Aber gerade das, was Emma auf den Tod nicht leiden konnte, die Repräsentation, erledigte mit Würde und, wie es schien, mit Anstand Fiffi Lehmann. Die Beziehungen zwischen ihr und Emma waren mithin normale.
Auf die bei den Spazierfahrten immer wiederkehrende Frage, die man, mehr um mit Fiffi anzuknüpfen als aus Interesse für den Jungen, stellte:
»Wer ist denn dies reizende Kind?« antwortete Fiffi:
»Günther Berndt,« und Emma fügte regelmäßig hinzu:
»In Firma Berndt & Tie., Konserven en gros.«
Und es dauerte gar nicht lange, da war »das Konservenkind« das populärste aller Tiergartenkinder.
Cäcilie ging häufig in einem Abstand von dreißig Schritten hinter dem Wagen her und genoß den Triumph ihres Sohnes als eine Ehrung, mit der man zugleich die verantwortliche Stelle, die Mutter, traf. Und wenn es bisher nur der Reichtum gewesen war, im Gefühl dessen sie sich blähte, so kam nun der Stolz einer Mutter hinzu, deren Sohn sich auszeichnete vor allen anderen Söhnen. —
Günther selbst verhielt sich allen Liebesbezeugungen und Auszeichnungen gegenüber passiv. Er empfand es höchst störend, wenn Unbekannte sich zu ihm hinabbeugten, mit ihren Händen auf seiner Decke entlang fuhren, die Mäuler spitzten und ihm die dümmsten Koselaute ins Gesicht pruschten.
Er riß die blauen Augen weit auf und dachte:
»Seid ihr verrückt? oder was wollt ihr?«
Daß man ihm die kurze Zeit, die er wach lag, keine Ruhe gönnte, verdroß ihn, zumal er von dem dummen Zeug, das man ihm erzählte, kein Wort verstand. Nur, was das ewig wiederkehrende: »Na, so lachʼ doch mal!« zu bedeuten hatte, wußte er. Denn als zwei Tanten ihn eines Tages stundenlang mit diesem »na, so lachʼ doch mal« gepeinigt hatten, und er für diese Quälereien nur einen verächtlichen Blick übrig hatte, sah er plötzlich in einem Spiegel, wie Fiffi sich mit einem runden Gegenstand das Gesicht betupfte und ganz weiß auf den Backen wurde. Das fand er komisch und mußte lachen. Im selben Augenklick riefen die Tanten strahlend:
»Na also!«
Von da ab wußte er, was dies ewige »na, so lachʼ doch mal!« zu bedeuten hatte. Und Günthers erster Schritt, den er bewußt tat, war die Opposition. Denn von dieser Stunde ab waren alle Versuche, ihn auf diese Weise zum Lachen zu bringen, vergeblich. Außer Emma langweilten ihn alle. Kam sie aber in seine Nähe, so streckte er die kleinen Arme nach ihr aus und rief:
»A . . . a . . . a . . .!«
»Großer Gott!« rief Cäcilie entsetzt. »Der Junge wird doch nicht etwa stottern?«
»Was soll das heißen?« fragte Emma.
Und Cäcilie, die sich den Glauben nicht nehmen ließ, daß diese Rufe nichts anderes bedeuteten, als Amme, verfolgte ängstlich die Lautentwicklung ihres Sohnes.
Fiffi erkannte er am Geruch. Und wenn er dann mit dem Näschen instinktiv »seinen Hochzieher« machte, wie Emma sich ausdrückte, der sich so ähnlich, wie: »Hif – hif – hif,« anhörte, dann war es für Cäcilie ganz deutlich, daß er Fiffi rief.
Und, um dies Wunder zu zeigen, mußte sich Fiffi, so oft Besuch kam – an manchen Tagen mehr als ein dutzendmal – über seine Wiege beugen.
Hatte er ʼmal eine unruhige Nacht und war er daher tagsüber besonders ruhebedürftig, so wußte er schon im voraus, daß die bösen Menschen ihn heutʼ doppelt quälen würden. Sie schleppten alles mögliche Spielzeug heran, mit dem er durchaus nichts anzufangen wußte. Die meisten Gegenstände verübten sogar noch Lärm, klapperten, quietschten, knatterten und miauten und wurden in ihrer Wirkung höchstens noch durch den Lärm der Umstehenden übertönt, die allʼ dies Zeug mit süßem Lächeln in Bewegung setzten.
In solchen Fällen sehnte Günther das Ende des Tages herbei und streckte Emma, wenn sie des Abends zum Waschen kam, mit doppelter Bereitwilligkeit die kleinen Ärmchen entgegen. Cäcilie begriff er gar nicht. – Daß sie ihm mit ihrem Munde unaufhörlich im Gesicht herumfuhr, ließ er sich gefallen, weil er dachte, das gehöre zu den Dingen, die, wie das Bürsten, Waschen und Kämmen, sein müssen. Daß sie aber, so oft er einen Laut von sich gab, wobei er sich gar nichts dachte, in Begeisterung geriet, vor Freude aufschrie, ihn in die Höhe riß und an sich drückte, verstand er nicht. So lag er denn nie ruhiger, als wenn Cäcilie vor ihm stand.
»Du kannst mir glauben,« sagte sie zu Leo, »der Junge denkt.«
In Günthers kleiner Vorstellungswelt, in deren Mittelpunkt Emma, Fiffi und Cäcilie standen, wirkte Cäcilie auf seine Gehörs-, Fiffi auf seine Geruchs-, Emma auf seine Geschmacksnerven. Leo, der ihm alle Tage neue Spielsachen aufs Bett baute, mochte er gar nicht. Leo hatte die Angewohnheit, ihm mit zwei Fingern auf den Bauch zu stuken und dabei zu sagen:
»Wie macht die Kuh? – Muh! Muh!«
So kam es, daß Günther, der gar nicht wußte, was eine Kuh war, die Begriffe verwechselte, Leo für eine Kuh hielt und, wenn er gerade bei Laune war, »muh, muh!« sagte, sobald Leo sich über sein Bettchen beugte. Da daraufhin aber regelmäßig ein Jubel losbrach, der ihm wehʼ tat, so gab er auch das bald auf.
Am wenigsten konnte es Günther leiden, wenn er des Nachmittags nach vorn gebracht und von Arm zu Arm gereicht wurde. Daß es sich dabei um Cäciliens Teegesellschaften handelte, wußte er natürlich nicht. Aber etwas anderes hatte er bemerkt: Einmal, als es ihn dabei überkam, war so eine Tante, die ihn gerade im Arm hielt und »kille kille« mit ihm machte – was er, da er kitzlich war, auf den Tod nicht leiden konnte – aufgesprungen, hatte entsetzt aufgeschrien und ihn Fiffi wieder in den Arm gelegt. Und danach war er nicht weitergereicht, sondern in sein Zimmer getragen worden. Das wiederholte sich ein zweites und ein drittes Mal. Und schließlich empfand er so etwas wie einen Zusammenhang zwischen dem »Überkommen«, dem Aufschrei, der Rückkehr in Fiffis Arme, dem Hinausgetragenwerden und der Rückkehr in sein Bett, in dem er endlich Ruhe hatte.
Und so entwickelte sich in ihm der Wille. Er dachte schon von dem Augenblick an, in dem man ihn nach vorn trug, an nichts anderes. Und oft machte sich seine Willensäußerung schon fühlbar, wenn Cäcilie ihn vor den entzückten Augen ihrer Gäste der Amme Fiffi aus dem Arm nahm. Die Vorstellung mußte dann vorzeitig abgebrochen werden.
Cäcilie war außer sich. Daß man Günther bewunderte, war eins der vielen Imponderabilien, die ihr mütterliches Glück ausmachten. Sie wandte sich besorgt an den Sanitätsrat und war sofort für Hinzuziehung eines Spezialisten. Aber der Arzt sah in Günthers Verhalten keinen Grund zur Besorgnis. —
Günther wurde nicht mehr herumgereicht und bereitete damit Cäcilie die erste Enttäuschung.—
Während so Günther schon in seinem ersten Lebensjahre viel auszustehen hatte, lebte Frida bei Linkes ein ruhiges Leben. Sie wurde von Emma pünktlich und gewissenhaft besorgt, in die Luft gefahren, von Paul geschaukelt, durch die Stube gefahren und von keinem Menschen sonst belästigt.
Für Laute, die sie von sich gab und die sich trotz dem Unterschiede im Körpergewicht in nichts von den Lauten Günthers unterschieden, interessierte sich niemand. Franz, der mehrmals am Tage durch das Zimmer kam, in dem sie lag, trat so leise wie möglich auf und sah beim Vorübergehen zu ihr hinüber. Hatte sie die Augen offen, so trat er an ihr Bettchen heran und nickte ihr zu. Aber weder zwang sie jemand zu lachen, noch hatte sie es, wie ihr Altersgenosse im ersten Stock, nötig, sich zu etwas zu zwingen, was ihr nicht von selbst kam.
Kein Zweifel, daß Frida von den beiden Kindern das glücklichere war.
Daran vermochte auch die Tatsache nichts zu ändern, daß Frida Günthers abgelegte Sachen trug. Denn, was Berndts im Laufe des Jahres ablegten, was unmodern oder Günther zu eng wurde, verschenkten sie mit herrschaftlicher Miene am Heiligabend ihren Leuten.
Da stand in seinem Lichtstrahl dann der Riesenbaum mitten im Zimmer und bildete die Grenze für die beiden Welten, die sich einmal im Jahre auf ein paar Stunden hier begegneten.
Rechts vom Baum streckte sich sechs Meter lang die stolze Herrschaftstafel, die über und über mit Geschenken für die drei Berndts und Cäciliens Bruder bepackt war. Kleine Fähnchen in verschiedenen Farben wiesen jedem seinen Platz. Am weitesten dehnte sich Günthers Reich, das sinnig durch grüne Fähnchen markiert war. Ein ganzes Spielwarenlager war hier zusammengetragen. Musik- und Gesang-Apparate neuester Konstruktion, die ganz harmlos dastanden, aber für Günther, der die Ruhe liebte, später zur Hölle wurden. Aber auch das heliotropfarbene Revier Cäciliens konnte sich sehen lassen. Nahmen die Schmucksachen, die Leo herangeschafft hatte, auch weniger Raum ein, so verkündeten doch laut die mit peinlicher Sorgfalt nach vorn gekehrten Preise ihren Wert.
Links vom Baum stand schüchtern die Leutetafel, auf der die Geschenke für die fünfköpfige Familie Linke und sechs Bediente lagen. Es war nicht überwältigend, und hier und da berührten sich die Zettel, die mit dem Namen der Beschenkten auf den Gegenständen lagen. Immerhin: als Cäciliens Bruder, der Referendar und auch sonst ein hübscher Kerl war, auf dem neuen Steinwayflügel ein Weihnachtslied spielte und Cäcilie an Leos Arm, gefolgt von Fiffi, die Günther trug, dem Personal voran in den erleuchteten Saal schritt, roch es nach Wohlhabenheit.
Vor dem Baum blieb Cäcilie stehen. Alle bildeten einen Kreis. Cäcilie sang laut das Lied von der heiligen Nacht, und alle sahen zu ihr auf. Und vom zweiten Vers an sangen sie mit.
Als das Lied zu Ende war, lehnte sie den Kopf zurück, schloß die Augen und sagte hoheitsvoll: »Ich danke Ihnen!«
Dann wies sie mit feierlicher Geste auf die Leutetafel:
»Alles, was dort liegt, ist für Sie! Es steht überall bei, für wen es ist. Die Geschenke sind der Ausdruck unserer Anerkennung für die Dienste, die Sie unserem Hause geleistet haben. Lassen Sie dieselben einen Ansporn sein, in treuer Pflichterfüllung auch weiterhin zu uns zu stehen. In Freudʼ und Leid!«
Sie schloß zum Zeichen, daß sie zu Ende war, die Augen wieder, wandte sich zu Leo, Fiffi und ihrem Bruder, der Referendar und auch sonst ein hübscher Kerl war, wies auf die fette Herrschaftstafel und sagte:
»So! und das sind wir!«
Alles stand jetzt um die Tische herum und besah die Geschenke. Emma hielt den »Ansporn treuer Pflichterfüllung« in Gestalt eines von Cäcilie abgelegten Ballkleides in der Hand.
»Wahrscheinlich sollst du zu den Berndtschen Hoffestlichkeiten zugezogen werden,« spottete Franz, der sich gerade ein Paar abgelegte Hosen von Leo anhielt.
»Vata!« rief Paul. »Hast de denn herrschaftliche Beine, wenn de Herrn Berndts seine Hosen anhast?«
Linke lachte; aber Cäcilie, die es hörte, rief auf die Leuteseite hinüber:
»So belehren Sie Ihren Sohn doch!«
Linke sah sie fragend an.
»Daß das Herrschaftliche nicht im Äußern liegt.« dozierte Cäcilie. »Wenigstens nicht ausschließlich«
»Worin denn?« fragte Paul.
»Du mußt die gnädige Frau bitten, daß sie es dir sagt.«
Paul sah zu Cäcilie auf.
»Das liegt im ganzen,« sagte sie breit. – »Verstehst du?«
Paul erwiderte: »Nein!«
»Erklären Sieʼs ihm!« sagte Cäcilie zu Linke, und der meinte:
»Herrschaft, das sind die, die sich bedienen lassen.«
»Also die kleine Frida!« rief Paul strahlend.
»Unsinn!« sagte Cäcilie. – »Aber Günther! Denn Herrschaft sind die, die herrschen und deren Kinder; und Dienerschaft die, die dienen und deren Kinder. So, nun weißt duʼs.«
»Und wer macht das?« fragte Paul.
Cäcilie überlegte einen Augenblick; dann sagte sie:
»Der liebe Gott.«
»Und warum macht er das?«
»So fragʼ doch nicht so viel,« sagte Emma.
Aber Cäcilie widersprach:
»Man soll Kindern auf alles eine Antwort geben,« sagte sie und wandte sich wieder an Paul. »Das macht der liebe Gott, um zu zeigen, daß er allmächtig ist.«
»ʼnen Reicheren als den lieben Gott gibtʼs denn wohl nicht?« fragte Paul.
»Gewiß nicht!« erwiderte Cäcilie.
Diese Religionslehre erschien Linke denn doch etwas zu materiell. Den lieben Gott auf eine Stufe mit Rockefeller und Rothschild stellen, das hieß denn doch die Lehre Christi ins Gegenteil kehren.
Oder wie? Er dachte nach. Diese Gegenüberstellung machte ihn stutzig. Hatte Cäcilie etwa recht? War es nicht so? Sprach sie nicht nur aus, was tatsächlich der Fall war? Und Paul, das Kind, hatte ganz unbewußt die Nutzanwendung daraus gezogen.
Linke war kein Mensch, der Problemen nachhing. Aber als Paul seine Frage stellte, war es ihm wie eine Erleuchtung durch den Kopf geschossen. Das Christentum war eine Angelegenheit der Armen. Also war es für die Reichen nur ein Vorwand. Und darüber hinaus ein Schutzwall, an dem sich die Feindschaft und der Haß der Armen brach. – Den Armen gab es Trost, ihnen Sicherheit.
Die Überzeugung fraß sich in Franz fest. Ohne seinen Willen. Und mit der Zeit verdichtete sie sich zu einer Art Weltanschauung, die er auch Emma gegenüber mit Leidenschaft verfocht. —
Unter Günthers Geschenken war auch eine Soldatenmütze und eine Litewka aus weicher, grauer Wolle. Und an dem schmalen umgeklappten Kragen prangten stolz die Gardelitzen. Das Ganze sah aus wie ein Puppenspielzeug. Fiffi mußte Günther auf Leos Befehl Mütze und Litewka anlegen. Günther, der sich schon längst aus diesem Trubel heraussehnte, sträubte sich. Aber es half nichts.
»Je früher er sich daran gewöhnt,« sagte Cäcilie, »umso besser.«
Seine militärische Einkleidung wurde erzwungen und der junge Held auf den hohen Kinderstuhl gesetzt. Mit Tränen kämpfend und mit zusammengekniffenem Munde sah er wahrhaft martialisch aus.
Cäciliens Phantasie feierte Triumphe.
»Leo, schieb den Thron unter den Baum!« rief sie ihrem Manne zu.
Und wie hypnotisiert rollte Leo Günthers Stuhl unter den leuchtenden Tannenbaum.
Günther dachte entsetzt:
»Was kommt denn nun schon wieder?«
Dann mußten alle im Halbkreis um den Baum treten. Auf einen Wink hin saß Cäciliens Bruder, der Referendar, wieder am Flügel, und Cäcilie, die dem Stuhl Günthers gegenüberstand, sang:
»Feinde ringsum! Feinde ringsum!
Um diese zischende Schlange, Vaterland
Ist dir so bange. Warum? bange, warum?
Vater und Sohn! Vater und Sohn! Flammende
Säbel gezogen, kommen wie Raben geflogen!
Sprechen im Hohn. Sprechen im Hohn.
Feldherr voran! Feldherr voran! Seht auf
Dem Rappen ihn sitzen; schaut wie die
Augen ihm blitzen.«
Die ganze Korona sang den Kehrreim mit. Vom zweiten Vers an sangen sie alle.
Cäciliens Augen waren strahlend auf Günther gerichtet. Der fuhr mit den Patschen über die blanken Knöpfe, sah dann alle der Reihe nach an, bis seine Augen auf Cäciliens verklärtem Gesichte ruhen blieben. Ihr Gesang quälte ihn furchtbar. Er rutschte erst unruhig auf seinem Stuhl umher. Dann schmiß er die Stimmung, indem er sich die Mütze vom Kopf riß und sie der dicht vor ihm stehenden Cäcilie ins Gesicht warf.
Paul lachte laut auf und rief:
»So ʼn Luder!«
Cäcilie wankte. Dieses Luder, mit dem Paul ihren Günther bewarf, traf sie schwerer als die Mütze, obschon ihr Haar in Unordnung geriet und ihr linkes Auge tränte.
Der Gesang brach ab; Cäciliens Bruder stand vom Flügel auf. Leo, an dessen Arm Cäcilie mit halbgeschlossenen Augen lehnte, sah drohend zu Paul hinüber. Günther, froh, daß der Lärm ein Ende hatte, zerrte wieder an den blanken Knöpfen, die zu seiner Freude bereits nachgaben und locker wurden. Die Dienerschaft starrte erwartungsvoll die Herrschaft an, die noch immer eine Gruppe bildete. Frida, die auf Linkes Arm saß, streckte die Hände nach dem Platz aus, auf dem Cäciliens Brillanten lagen, piepste: »Ha . . . habn« – und patschte mit ihren kleinen Pfoten auf eine Smaragdbrosche. Cäcilie stürzte von Leo weg auf das Kind zu, schlug es wütend auf die Hände und schrie:
»Dumme Jöhre!« wandte sich zornig an Emma und rief:
»Schämen Sie sich! So verwahrloste Kinder!«
Frida brüllte laut.
Emma riß ihrem Manne das Kind aus dem Arm.
»Das verbittʼ ich mir!« rief sie Cäcilie zu. – »Sonst . . .« und sie warf drohende Blicke auf Günther.
»Himmel!« schrie Cäcilie und stürzte auf den Stuhl zu, auf dem Günther saß.
Als der sie kommen sah, heulte er laut.
Sie nahm ihn hoch. Da heulte er noch lauter.
Die beiden Mütter mit den beiden Kindern standen sich gegenüber.
»Wehe dem, der mein Kind anrührt!« brüllte Cäcilie.
»Und wer meinʼs anrührt . . .« schrie Emma, zitternd vor Erregung.
Aber das Geheul der Kinder übertönte das der Mütter.
Linkes verließen den Saal. Die Dienerschaft folgte. Berndts blieben zurück.
»So beruhige dich doch!« sagte Leo.
Cäcilie streichelte und drückte den von oben bis unten nassen Günther an sich.
»Mein Prinz!« sagte sie zärtlich. »Aber deine Mutter wird dir den Pöbel schon vom Leibe halten!«