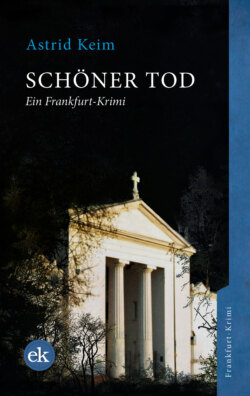Читать книгу Schöner Tod - Astrid Keim - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеAls sie am nächsten Morgen aufwacht, fühlt sie sich wie gerädert. Das Nachthemd ist völlig verschwitzt und das Bettzeug so zerwühlt, als hätte ein Nahkampf stattgefunden. Dunkel erinnert sie sich, in einem verwahrlosten Haus nach dem Ausgang gesucht und sich in einem Labyrinth wiedergefunden zu haben. Es war ein Endlostraum, aus dem sie mehrmals hochschreckte, aber sofort wieder einschlief und weiterträumte. Sie geht ins Bad, beugt sich über das Waschbecken und schüttet sich mit beiden Händen kaltes Wasser ins Gesicht. Als sie in den Spiegel schaut, fühlt sie sich keineswegs besser. Eine blasse ältere Frau mit wirren Haaren und dunklen Ringen unter den Augen blickt ihr entgegen. Auch die Falten kommen ihr tiefer vor als sonst. Nun gut, da lässt sich etwas tun. Eine Feuchtigkeitsmaske kann einiges bewirken. Christoph hatte sich immer amüsiert, wenn sie ihre Schönheitstour machte, wie er es nannte, und versichert, das habe sie gar nicht nötig. Ihr schienen jedoch Zweifel angebracht, denn allzu deutlich machten sich langsam, aber sicher die Spuren des Alters bemerkbar.
Damit hatte sie in ihrer Jugend überhaupt nicht gerechnet, mit 17 empfand sie bereits 30jährige als ziemlich betagt. Altern war etwas, das andere betraf. Alte Menschen brauchten sich ohnehin nicht mehr ums Aussehen zu kümmern, da war sowieso alles zu spät. Welche Fehleinschätzung! Jetzt gehört sie dazu und kümmert sich sehr ums Aussehen. Aber das teilt sie mit der Mehrheit ihrer Altersgenossinnen, denn kaum eine findet sich so ohne Weiteres mit den unangenehmen Begleiterscheinungen der zunehmenden Jahre ab. Außer Renate. Die hat als Einzige offenbar keine Probleme mit Äußerlichkeiten. Damit ist sie das genaue Gegenteil ihrer glamourösen Mutter, die Schönheit, Charisma und Charme bis zu ihrem Lebensende bewahrte. Und selbst dieses war spektakulär: Bei der Gala zu ihrem 75. Geburtstag stolperte sie über ein Kabel und stürzte von der Bühne. Beim Aufprall erlitt sie einen Schädelbasisbruch, der nach einwöchigem Koma zum Tode führte.
Abgesehen von ihrem scharfen Intellekt ist dagegen an Renate so gar nichts Spektakuläres. Mittelgroß, mittelbraunes Haar, mittlerweile graumeliert, mittelmäßiges Aussehen. Dabei hätte sie Potential, so kommt es zumindest Laura immer vor, aber sie ist eine der Frauen, »die nichts aus ihrem Typ machen«, wie es die einschlägigen Magazine formulieren. In alten Filmen gibt es eine wiederkehrende Szene: Irgendein Schönling nimmt der blaustrümpfigen Sekretärin die überdimensionale Hornbrille ab, die Klammer aus dem Haar und schon verwandelt sich die Raupe in einen Schmetterling. Renate hat an solche Metamorphosen offenbar nie den geringsten Gedanken verschwendet, vielleicht um der Mutter keine Chance auf die Hoffnung zu geben, sie könne einst in ihre Fußstapfen treten. Laura nimmt sich vor, dieses Thema bald einmal anzusprechen, denn sie wüsste doch zu gerne, weshalb ihre Freundin in dieser Angelegenheit so ein Desinteresse an den Tag legt.
Kritisch betrachtet sie sich im Spiegel. Die braunen Augen, ein voller Mund, leicht gewelltes, halblanges Haar, dessen Dunkelblond langsam vom Grau überdeckt wird. Christoph hat vom Färben überhaupt nichts gehalten. »Steh zu deinem Alter«, versuchte er sie zu überzeugen. »Graue Haare und Falten sind schön. Gelebtes Leben. Schau dir doch nur die operierten Gesichter an, mit aufgespritzten Lippen, zentimeterdickem Make-up und wallendem Blondhaar. Möchtest du so aussehen?« Und als er hinzufügte, dass er sie genau so liebe, wie sie sei, war sie sehr gerührt und nahm sich vor, das Unausweichliche tapfer hinzunehmen.
Leider sagt ihr das heute niemand mehr, und trotz aller Anstrengungen will es ihr nicht so richtig gelingen, Falten schön zu finden. Daran ist unerfreulicherweise nur wenig zu ändern, aber ändern lässt sich etwas anderes. Heute, entscheidet sie, heute werde ich wenigstens meine alte Haarfarbe zurückbekommen. Die Frisur bleibt so, wie sie ist, ab und zu etwas kürzen, fertig. Das kann sie zur Not auch selber. Färben ist etwas anderes, da gibt sie sich lieber in die Hände eines Fachmanns. Es wimmelt hier von Friseurläden. Einer wird sie bestimmt drannehmen, ohne lange Wartezeiten.
Nach dem Frühstück macht sie sich sofort auf den Weg. Sie braucht nicht lange zu suchen, gleich der erste Salon hat noch Kapazitäten frei. Eine freundliche Dame ihres Jahrgangs führt sie zu einem Sessel und legt ihr ein Cape um die Schultern. Laura schaut sich um: Die Siebziger lassen grüßen. Braune Waschbecken, ockerfarbene Wände, praktischer Linoleumboden. In der Ecke steht ein großer Besen. Hoffentlich sind wenigstens die Geräte modern, hoffentlich ruft die Farbe keine Verätzungen hervor. Die freundliche Dame steht jetzt hinter ihr und fragt nach den Wünschen der geschätzten Kundin. Laura erklärt dem Spiegelbild ihre Wünsche und nimmt dabei einen ziemlich penetranten Geruch nach Zigaretten wahr, der etwas abgemildert auch im Raum hängt. Nicht sehr angenehm, aber sie sollte nicht so zimperlich sein. Früher wurde immer und überall geraucht, besonders beim Friseur, um die Wartezeit zu verkürzen. Als die Dame mit allen zehn Fingern ihre Haare aufschüttelt, geraten nikotingelbe Finger ins Blickfeld. Noch weniger angenehm. Aber Laura beschließt, durchzuhalten und sich nichts anmerken zu lassen. Dieser Entschluss wird allerdings auf eine harte Probe gestellt, als die Nachrichten des Radios im Hintergrund zu Ende sind und deutsche Schlager ertönen. Die Dame summt mit. Laura schließt die Augen und versucht an etwas anderes zu denken. Vielleicht wäre eine Zeitschrift hilfreich. Neue Post, Frau aktuell und Bunte stehen zur Auswahl. Sie entscheidet sich für die Neue Post und liest intime Details über Affären berühmter Stars, von denen sie nicht einmal die Namen kennt. Resignierend fügt sie sich in ihr Schicksal und hofft, dass die Prozedur bald zu Ende sei. Aber das zieht sich. Die Farbe muss einwirken. Während der Einwirkzeit kommen Vater und Sohn, um sich die Haare schneiden zu lassen. Beim Kleinen geht es schnell, aber beim Erzeuger braucht es seine Zeit. Längst hat eine Art Wecker geschrillt, um das Ende der Einwirkzeit zu signalisieren. Ungerührt stellt die Dame das Gerät wieder an mit der Bemerkung, ein paar Minuten mehr würden nicht schaden, während sie sich in aller Ruhe ihrem anderen Klienten widmet. Lauras Kopfhaut beginnt zu jucken. Erst als der Herr gezahlt hat, wird der geschätzten Kundin wieder Aufmerksamkeit zuteil. Die ist mehr als erleichtert, von der Schmiere befreit zu werden und freudig überrascht vom Ergebnis der Sitzung. Die Friseurin versteht ihr Handwerk. Das Grau ist verschwunden und die natürliche Farbe perfekt getroffen. Grund genug, die Imponderabilien zu vergessen und dem moderaten Honorar ein großzügiges Trinkgeld hinzuzufügen.
Gerade als Laura den Salon verlassen hat, klingelt das Handy. Renate ist dran und reklamiert die ausstehenden Neuigkeiten. Sie verabreden sich um zwei am Palmengarten. Das Wetter ist mild wie am Vortag und ein kleiner Spaziergang wird beiden guttun.
Renate ist schon da. Sie besitzt eine Jahreskarte, die den Vorteil hat, auch bei den Nebeneingängen zu funktionieren. So können sie sich zusammen durchs Drehkreuz quetschen. Eingehüllt in den betäubenden Duft der Hyazinthen und Narzissen, schlendern sie durch die Frühlingsblumenschau. Tulpen in der ganzen Breite des Farbspektrums stehen in voller Blüte, von Wachsweiß bis zu einem fast schwarzen Violett. Geflammte Kelche sind darunter, gefüllte, solche mit ausgefransten, gezackten, gezahnten und glatten Blütenblättern. Die Vielfalt der Farben und Formen ist überwältigend. Laura spürt zwar die Neugier der Freundin, bringt es aber angesichts dieser Pracht nicht fertig, ihre Geschichte zu erzählen. Erst als sie auf der Bank über dem Wasserfall des Palmenhauses sitzen, berichtet sie.
Renate fällt aus allen Wolken. »Das kann doch nicht wahr sein, du hast die Leiche gefunden?«
»Wieso, woher weißt du von der Sache?« Laura ist verblüfft.
»Hast du noch keine Zeitung gelesen? Da steht alles drin, in großer Aufmachung!«
Klar, wie dumm, nicht daran gedacht zu haben. Sie hatte kurz überlegt, die Zeitung zum Frühstück zu holen, dann aber den Gang zum Briefkasten gescheut. Dankbar konstatiert sie, dass ihr Name offenbar nicht erwähnt ist. Thomas hat Wort gehalten.
Laura muss ihrer Freundin nun genauso detailliert Auskunft geben wie der Polizei. »Und du musst mir die Stelle zeigen. Weiß man schon, woran die Frau gestorben ist? Davon stand nämlich nichts in der Zeitung.«
Laura muss sie enttäuschen. »Das wird noch etwas dauern. Die Obduktion erfolgt erst heute, das weiß ich von der Polizistin. Der Körper war steifgefroren. Thomas hat versprochen, mich zu benachrichtigen.«
Als hätte er auf dieses Stichwort gewartet, erscheint seine Nummer auf Lauras Handy. Was die Todesursache betrifft, hat er noch keine Neuigkeiten. Die seien am späten Nachmittag zu erwarten. »Aber woher wusstest du, wie man mit dem Auto in den Friedhof kommt? Das könnte nämlich ermittlungsrelevant sein. Der Täter muss ja ein Fahrzeug benutzt haben, um die Tote zu transportieren. Wir haben Reifenspuren gefunden, die nicht von den Fahrzeugen der Friedhofsgärtnereien stammen. Sie werden gerade analysiert. Vielleicht lässt sich damit die Personengruppe einkreisen.«
Daran hatte sie noch gar nicht gedacht, ein neuer Aspekt. Das mit der Zufahrt weiß wirklich nicht jeder. Sie erfuhr es auch erst durch Maren, die sie um Hilfe beim Neubepflanzen des Grabs ihres Schwiegervaters gebeten hatte. Mit jeder Menge Erde und Blumen im Kofferraum waren sie durch die Schranke gefahren, die in solchen Fällen geöffnet wird.
Laura setzt Thomas darüber in Kenntnis, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Schranke auf Anforderung immer geöffnet wird. »Da fragt keiner genauer nach, deshalb kommt im Grunde jeder rein.«
»Trotzdem danke für die Information. Mal sehen, ob wir damit einen Schritt weiterkommen.«
Renate hat das Gespräch verfolgt und zieht die Brauen hoch. »Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber könnte nicht doch jemandem ein Fahrzeug um diese Jahreszeit aufgefallen sein? Es war doch eiskalt zum angenommenen Tatzeitpunkt und die Erde gefroren. Da kann man auf keinen Fall etwas einpflanzen, und bauliche Maßnahmen an Grabsteinen, für die man Werkzeug transportieren müsste, halte ich auch für ausgeschlossen.«
»Du hast recht! Zu dieser Zeit waren dort mit Sicherheit nur wenige Menschen unterwegs. Und gerade deshalb kann sich vielleicht jemand erinnern.«
Sie ist kurz davor, Thomas anzurufen, um ihm diese Überlegung mitzuteilen, aber es ist anzunehmen, dass er mit seiner ausgeprägten Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen, bereits selbst darauf gekommen ist. Sie möchte keinesfalls seine Intelligenz beleidigen. Sie denkt nach. »Vielleicht könnte ich auf eigene Faust versuchen, in dieser Beziehung etwas herauszubekommen …«
»Nein!«, Renate ist entschieden dagegen. »Das würde gerade noch fehlen. Ich verstehe zwar, dass es dich in den Fingern juckt, in diesem selbst erlebten Fall, aber du würdest nur die offiziellen Ermittlungen stören. Wenn du noch arbeiten würdest, könnte ich das verstehen, aber dein Abschied war doch definitiv, oder habe ich da etwas falsch verstanden?«
Laura muss ihr recht geben. In beiden Punkten. Als sie fast zeitgleich mit Christoph in den Ruhestand wechselte, tat sie das mit dem festen Vorsatz, sich nicht mehr mit den kriminellen Seiten des menschlichen Daseins zu beschäftigen, sondern die angenehmen mit Christoph zu genießen.
»Es ist so, wie du sagst«, wendet sie sich an Renate, »und ich werde mich raushalten, obwohl es tatsächlich in den Fingern juckt. Thomas und seine Kollegen werden ihr Bestes geben, und ich bin immerhin dicht dran. Ja, du auch«, beantwortet sie den fragenden Blick ihrer Freundin, »wenn du versprichst, niemandem etwas davon zu sagen. Obwohl, das wäre egal, er wird nur Dinge erzählen, welche die laufenden Ermittlungen nicht gefährden.«
»Genau, und gerade deswegen solltest du nichts auf eigene Faust versuchen. Wer weiß, ob es nicht sogar gefährlich werden könnte: Der Täter plant offenbar eiskalt.«
Auch da hat Renate recht. Die ganze Vorgehensweise spricht für eine akribische Planung. Allerdings auch für ein gerüttelt Maß an Risikobereitschaft. Viel einfacher wäre es doch, die Leiche irgendwo im Wald abzulegen. Es muss also einen wichtigen Grund für die Inszenierung gegeben haben – so wichtig, dass das Risiko bewusst in Kauf genommen wurde.
Renate nickt. »Und der Grund führt wahrscheinlich zum Motiv. Oder umgekehrt. Es liegt auf der Hand, dass beides zusammenhängt. Warten wir ab, was die Obduktion ergibt. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkel ...« Sie schaut auf die Uhr. »Ach, ich muss los. Ich habe Alf versprochen, noch mal reinzuschauen. Er hat ein neues Projekt am Start.«
Und auf Lauras fragenden Blick: »Er will sich an eine größere Skulptur wagen, eine eigene Interpretation der antiken Figurengruppe des Laokoon mit seinen beiden Söhnen im Kampf mit dem Meeresungeheuer.«
Als wäre das Erklärung genug, steht sie auf und zieht ihre Jacke an.
Laura hält sie am Ärmel fest. »Lebensgroß?«
»Klar. Etwas Spektakuläres muss es schon sein.«
»Aber wieso, für was?«
»So genau weiß ich das bis jetzt auch nicht, aber es hängt mit seinem Engagement gegen die Verschmutzung der Meere zusammen. Es ist als Metapher gedacht.«
»Und wie kannst du ihn dabei unterstützen?«
»Er braucht einen größeren Raum und auch Material. Ich habe versprochen, mich darum zu kümmern.«
Laura weiß nicht so genau, ob das Ganze wirklich seriös ist, Renates ernsthafter Gesichtsausdruck spricht aber dafür.
»So schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe: Er verbindet Kunst mit dem Kampf für den Umweltschutz.«
Damit hat er Renate natürlich auf seiner Seite, und auch Laura muss zugeben, dass man sein Geld für schlechtere Dinge ausgeben kann. Obwohl Alf über beachtliches Talent verfügt und in der Kunstszene durchaus einen Namen hat, will sich kein größerer finanzieller Erfolg einstellen. Es genügt zum Leben, da er keine großen Ansprüche stellt. An Renate wendet er sich nur, wenn es für ein künstlerisches Vorhaben nicht reicht. Sie würde ihn weitaus mehr unterstützen, aber das anzunehmen, verbietet sein Stolz. Jetzt, bereits in den Sechzigern, hat er sich mit den Gegebenheiten arrangiert und wohl auch die Hoffnung auf einen Durchbruch aufgegeben. Vielleicht, so hat man ihm nahegelegt, würde die Hinwendung zu abstrakter Kunst auf bessere Resonanz stoßen, aber das lehnt Alf ab. »Nein, das ist nichts für mich«, hat er erst letztens wieder entschieden mitgeteilt und sich sofort anderen Themen zugewandt, um dieser unumstößlichen Tatsache Nachdruck zu verleihen. Laura nahm sich damals vor, ihn bei Gelegenheit noch einmal darauf anzusprechen, denn auch ihr wollen sich viele Werke absolut nicht erschließen.
Das war, als sie zu viert in Renates Küche saßen, Alf in Begleitung seiner Muse. Tatsächlich, so stellt er Vanessa vor, das ist ihr offizieller Titel. Von Renate weiß Laura, dass sich die beiden vor knapp fünf Jahren in einem Café kennenlernten, wo sie kellnerte, und seitdem voneinander profitieren. Vanessa, eine strahlende Schönheit, die gerne im Mittelpunkt steht, aber auf intellektuellem Gebiet ein paar kleinere Defizite aufweist, lernt durch ihn eine Menge Leute aus Kreisen kennen, die ihr sonst verschlossen blieben. Und Alf, mit dieser Frau an seiner Seite, erfährt ein gutes Stück mehr Aufmerksamkeit für seine Arbeiten, als er sonst bekäme.
»Und die beiden haben nichts miteinander?«, wollte Laura damals wissen.
»Nein, mit Sicherheit nicht«, erklärte Renate, »das ist rein platonisch. Vanessa mit ihren 24 Jahren hat nicht das geringste Interesse an einem alternden Künstler, der in der Szene zwar einen guten Ruf genießt, aber finanziell immer am Rand eines Desasters balanciert. Und Alf, der Ästhet, erfreut sich einfach an ihrem Anblick und dem Interesse, das sie erweckt. Auch ich mag sie übrigens gern. Sie ist nett, unkompliziert, lacht viel. Sie hat einfach die Gabe, gute Laune zu verbreiten.«
»Kann ich mitkommen?« Laura erscheint der avisierte Besuch als gute Gelegenheit, auf andere Gedanken zu kommen.
»Klar, wenn ich gewusst hätte, dass du Lust dazu hast, hätte ich dich sofort gefragt. Alf wird sich freuen, dich zu sehen.«
Beide sind mit dem Fahrrad da und so dauert es nicht lang bis zur Humboldtstraße. Alf bewohnt dort seit fast dreißig Jahren zwei Zimmer im Erdgeschoss eines Altbaus. Ein geräumiger Mansardenraum, ehemals Unterkunft für Bedienstete, gehört dazu. Er hat ihn selbst ausgebaut, mit gehöriger Dämmung gegen Hitze und Kälte und zwei großen Fenstern im Dach, durch die mildes Nordlicht fällt. Normalerweise ist er groß genug für seine Projekte, das neue Werk jedoch erfordert andere Dimensionen. Als er die Wohnung mietete, war das Nordend noch keine so angesagte Wohngegend wie heute. Vor allem Studenten und junge Akademiker zog es dorthin, der urbanen (und gastronomischen) Vielfalt wegen. Heute sind die Mieten kaum noch erschwinglich: Die Gutverdiener haben auch diesen Stadtteil für sich entdeckt.
Alf braucht zum Glück keine Kündigung oder Mieterhöhung zu befürchten, denn er ist mit dem Besitzer des Hauses befreundet, seit sich dessen Frau von ihm trennte und die Kinder mitnahm. Alf konnte nicht mit ansehen, wie er niedergedrückt durchs Treppenhaus schlich, und lud ihn auf ein Glas Wein in seine Wohnung. Das war der Beginn ihrer Freundschaft, die durch ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Schachspiel gefestigt wurde, offenbar Alfs einziger Leidenschaft außer der Kunst, wie es Laura vorkommt. Neben Vanessa, der Muse, gibt es nur wenige Frauen in seinem Umfeld, und keine ist dabei, die auf eine intime Beziehung schließen ließe. Laura hat sich oft darüber gewundert, auch die Vermutung angestellt, ob er vielleicht schwul sei, ist aber nie zu einem Ergebnis gekommen. Sein Sexualleben ist ein Buch mit sieben Siegeln.
Sie sitzen, mit Wolldecken gegen den leichten Wind geschützt, auf dem kleinen Freisitz hinter dem Haus. Alf durfte ihn im Garten anlegen. Theoretisch steht er auch den anderen Bewohnern zur Verfügung, aber nur selten macht jemand Gebrauch davon. Obwohl erst kurz nach drei, beginnt die Sonne schon ihre Kraft zu verlieren. Lang wird man hier nicht mehr sitzen können, aber ein langer Besuch ist auch nicht geplant.
Renate kommt gleich zur Sache: »Es wird schon klappen. Ich habe gehört, dass bei einer Künstlergemeinschaft in einer ehemaligen Fabrik etwas frei wird. Ein Atelier mit Nordlicht muss es bei diesem Projekt ja wohl nicht sein.«
Alf nickt. »Nur die Größe ist ausschlaggebend. 50 m2 wären ideal.«
Da zu diesem Thema offenbar kein Diskussionsbedarf mehr besteht, kommt Laura auf die Frage zurück, die sie beim letzten Treffen in Renates Küche nicht mehr stellen konnte: »Alf, warum siehst du eigentlich die abstrakte Kunst so kritisch?«
»Nicht die abstrakte Kunst per se«, korrigiert er, »da habe ich mich wohl zu pauschal ausgedrückt. Nur gewisse Richtungen. Warst du nach dem Umbau schon mal im Städel?«
Und als Laura den Kopf schüttelt: »Solltest du aber. Schau dir die neue Abteilung für Moderne Kunst im Untergeschoss an.«
Er schweigt, als sei damit alles gesagt.
Aber Laura lässt nicht locker. »Wegen der neuen Räumlichkeiten?«
»Ja, auch, architektonisch sind die wirklich gelungen, aber vor allem wegen dem, was drin ist. Abstraktes satt, und zwar in einer Form, als hätten die Erschaffer niemals gelernt, einen Pinsel zu führen, was sich vermutlich auch so verhält. Ich habe es schon immer für eine Verspottung des Intellekts gehalten, monochrome Farbflächen oder wirre Muster als Kunst zu bezeichnen!«
»Da bist du aber einer der wenigen«, wirft Renate ein.
»Schon klar, aber weißt du, weswegen? Weil sich keiner traut, so etwas laut zu sagen. Da wird man sofort als Banause und Ignorant an den Pranger gestellt. Als ewig Gestriger. Das vor allem mit unserem unseligen Erbe. Kunst aber, die ich als solche bezeichne, hat etwas mit Organisation und Struktur zu tun. Mit Ästhetik! Was da in gewissen Bereichen der abstrakten Kunst gefeiert wird, ist die angebliche ›Ästhetik‹ des Destruktiven. Ich bitte euch, was soll man davon halten? Alles in der Natur strebt nach Harmonie. Selbst in der Chaostheorie: Da ordnen sich die Fraktale zu harmonischen Mustern. Wie weit sind wir mit unserer Zivilisation gekommen, dass wir das Gegenteil davon als Ausdruck großer Kunst feiern! Das lässt Rückschlusse auf den Zustand der Gesellschaft zu. Wir selbst sind destrukturiert, desorientiert und zerrissen. Nur deshalb konnte ein Begriff wie ›Die Ästhetik des Hässlichen‹ überhaupt aufkommen. Man muss sich mal vorstellen, dass dafür eigene Museen oder zumindest Abteilungen in Museen geschaffen werden!«
Alf steht auf und holt tief Luft. Es ist ihm anzumerken, dass ihn dieses Thema umtreibt. Wie jedes Mal denkt Laura, dass er etwas Mephistophelisches hat mit seiner ewig schwarzen Kleidung, der asketischen Gestalt, den dunklen, mittlerweile von weißen Fäden durchzogenen Haaren, die in einer Welle ins Gesicht fallen – und den nach oben strebenden Augenbrauen. Jetzt sind sie über der Nasenwurzel zusammengezogen, ein deutliches Anzeichen tiefster Missbilligung.
Doch Laura fühlt sich irgendwie erleichtert. Ihr diffuses Unbehagen angesichts einiger dieser Werke wurde in Worte gefasst. Auch sie hat das Bedürfnis nach Harmonie, dem »Schönen, Wahren, Guten«, das jahrhundertelang das Selbstverständnis von Kunst zum Ausdruck brachte. Dieses Bedürfnis ist vielen anscheinend abhandengekommen, was wiederum den Schluss nach sich zieht, dass Alf so falsch nicht liegt.
Renate beugt sich vor. »Ich kann da nur zustimmen. Verunsicherung in den Lebensumständen ruft Verunsicherung in der Beurteilung von Dingen hervor. Aber das Verunsicherndste ist, dass man auf Unverständnis stößt, wenn man diese Richtung infrage stellt. Als hätten sich die führenden Köpfe darauf geeinigt, das ästhetische Empfinden aus den Köpfen der anderen zu treiben. Kunst ist zur Allerweltssache verkommen, seit alles zur Kunst erklärt werden kann.«
»Genau, und Joseph Beuys hat nicht unerheblich dazu beigetragen, mit seinem Jeder ist ein Künstler«, wirft Laura ein. »Und er hat die Ästhetik des Hässlichen auf die Spitze getrieben. Denkt nur an die Fett- und Filzinstallationen, bei denen auch noch Ekel dazukam.«
Alf grinst. »Kein Wunder, dass zumindest eine davon dem gesunden Menschenverstand in Person einer Putzfrau zum Opfer fiel.« Alf ist so richtig in seinem Element, zumal er Verbündete gefunden hat. »Kunst sollte doch positive Gefühle auslösen. Bewunderung, Hochachtung, Einsicht, Verständnis, vielleicht Begeisterung, aber auch Ehrfurcht oder Staunen. Das war vor nicht allzu langer Zeit noch allgemeiner Konsens. Was ficht uns also an, diese Reaktionen infrage zu stellen, sie gar als kunstfeindlich zu brandmarken? Mir ist bis jetzt keine Antwort dazu eingefallen!«
»Mir auch nicht«, pflichtet Renate bei. »Letztens sah ich im Fernsehen ein sogenanntes Kunstwerk«, sie dreht die Augen gen Himmel, »da blieb mir die Spucke weg. Eingeweide über ein Gestell drapiert, und das Ganze nannte sich ›Das Innere wird sichtbar‹ oder so ähnlich. Da kann man nur staunen, und zwar über die Bereitschaft, solche Schöpfungen auch noch mit ordentlich viel Geld zu belohnen.« Sie zieht ihre Decke enger um sich. »Aber lasst uns reingehen. Es ist kühl geworden.«
Das ist es in der Tat, auch Laura fröstelt seit einigen Minuten, wollte aber das Gespräch nicht unterbrechen. »Finde ich auch. Außerdem bekomme ich langsam Hunger. Ich werde nach Hause fahren und schauen, was der Kühlschrank hergibt.«