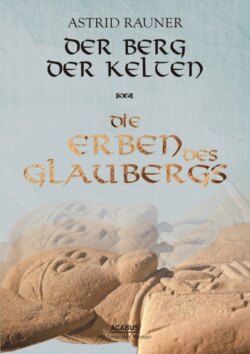Читать книгу Der Berg der Kelten. Die Erben des Glaubergs - Astrid Rauner - Страница 9
2
ОглавлениеAdavall strich sich lächelnd mit dem Zeigefinger um die Mundwinkel. Es stellte sich immer wieder als schieres Fest heraus, den alten Baldhon zu besuchen, der sich bereits am Türbalken festhielt, um nicht schüttelnd vor Lachen in die Knie zu gehen. Einer der Becher, die seine Ehefrau mutigerweise direkt vor ihm auf einem kleinen Schemel abgestellt hatte, war schon beinahe zu Bruch gegangen, als der alte Mann sich auf die Schenkel geschlagen hatte und nun zum vierten Mal wiederholte, was sein junger Gast ihm erzählt hatte.
„Nein, nein, Adavall, das kannst du mich nicht glauben machen. Das …“ Für die übrigen Worte fehlte dem alten Bauern die Luft. Mit Tränen in den Augen stützte er sich am Türrahmen ab, das sonnenverbrannte Gesicht nun so gerötet, dass es ungesund auszusehen begann. Doch Adavall war froh darüber, den wahren Grund für die vermeintlich kränkliche Rötung zu kennen. Er zählte die Herzschläge, bis Baldhon endlich wieder Luft zum Sprechen gefunden hatte. Tief atmend ließ er sich vor seinem Gast auf dem einfach gezimmerten Stuhl nieder, den er allein des Besuches wegen durch den niedrigen Eingang seines Hauses gezogen hatte, damit sie es sich vor seinem Heim im Schatten des tiefen Daches hatten gemütlich machen können.
Und Adavall war ihm außerordentlich dankbar dafür. Kaum zehn Tage nach der Sonnenwende hatte der Sommer die Uedhoreiba ganz und gar eingeholt. Die Sonne brannte so unbarmherzig vom wolkenfreien Himmel, dass es niemand freiwillig in den stickigen Häusern aushielt, wo sich die Luft fast so heiß und trocken anstaute wie auf dem offenen Feld. Auch jetzt noch musste der junge Mann sich immer wieder mit dem Zipfel seines Leinenhemdes die Schweißperlen von der Stirn wischen, obgleich es Baldhons Frau gelungen war, ihre Bierfässer so tief in den Vorratsgruben zu verstauen, dass sie eine angenehme Temperatur behalten hatten.
Der einzige, der sich an all dem nicht zu stören schien, war Baldhon. Der Bauer war weit über vierzig Jahre alt und hatte damit den Zenit seines Lebens längst hinter sich gelassen. Viele munkelten noch heute darüber, er würde den Göttern im Geheimen wertvolle Opfer darbringen, die er sich eigentlich gar nicht leisten konnte, nur, um noch Jahr für Jahr am Leben zu bleiben. Eine andere Erklärung schien es gar nicht dafür zu geben, dass es einem Mann wie ihm, der sein Leben lang schwer auf den Feldern geschuftet hatte, vergönnt gewesen war, noch bei der Geburt seiner Kindeskinder zugegen gewesen zu sein. Zumal er obendrein vor drei Jahren sein letztes eigenes Kind gezeugt hatte.
Es war dieses kleine Mädchen, das Adavall auch jetzt gerade nach seiner Mutter schreien hörte. Sie hatte gewagt, es einen kurzen Moment allein mit den Hühnern im Schatten des Hauses zurückzulassen, wo die Temperaturen gerade noch erträglich waren. Die kleine Siedlung, die Adavall an diesem Tag besuchte, lag auf einer kleineren Anhöhe im Tal am Süd-West-Fuß des Glaubergs. Mit Blick auf das sumpfige Flusstal hatten sich über die Jahre hinweg viele einzelne Bauerngehöfte zu einem kleinen Dorf zusammengefunden, das längst nicht mehr allein vom Ackerbau zehrte. Die Hohe Straße, die uralte Handelsroute gen Osten verlief nahe genug der kleinen Ansiedlung, dass Dhalaitus’ Vater dem Dorfältesten vor gut zwanzig Jahren das Recht erteilt hatte, in seinem Namen Herberge und Geleitschutz für die vorbeiziehenden Händler zu bieten, die ihre wertvollen Waren auch auf dem Glauberg zum Tausch anboten, und im Gegenzug dafür eine angemessene Belohnung von den Fremden einzuziehen. Nicht selten lagerten hier nach langer Reise Händler aus fremden Stämmen jenseits der Raino ihre Waren ein, bis auf dem Glauberg der Markt eröffnet wurde.
Das Geschäft mit den Händlern hatte den Bewohnern des Dorfes einen bescheidenen Reichtum ermöglicht, den Dhalaitus in den ersten Jahren seiner Herrschaft noch auf andere Weise gemehrt hatte. Von Baldhons Haus aus, das an der Ostspitze der Siedlung gelegen war, sah Adavall gut die roten Sandsteinfelsen, die übermannshoch, wie eine Wunde, aus dem schier unendlichen Wald des Hügellandes hervorblickten. Ein Schamane hatte dem Fürsten in Jugendjahren bereits offenbart, dass die Erdenmutter diesem Ort einen besonderen Segen gespendet hatte, auf dass ihr eigener Geist jeden Felsen, jedes Staubkorn beseelt hatte. Dhalaitus hatte es sich ein gewaltiges Opfer kosten lassen müssen, aber seitdem war kein anderer Steinbruch mehr für das Rohmaterial seiner vier Statuen in Frage gekommen, die er sich anfertigen lassen wollte.
„Adavall …“, riss der alte Bauer seinen Gast aus den Gedanken. „Adavall, ich sage dir, wenn alle Schwätzer wie dein kleiner Freund so mutig werden und versuchen, anstelle eines Bauern Handwerker zu werden, wird Uedhoreiba bald keine Waffen mehr haben – oder kein Eisen!“ Baldhon lachte wieder über seine eigene Bemerkung, gab Adavall jedoch, indem er sich einen Schluck Bier gönnte, Gelegenheit, auch endlich einmal das Wort zu ergreifen: „Nun, es hätte funktionieren können.“ Der junge Bauer wischte sich eine Schweißperle aus dem Auge. „Raelhia hält eigentlich recht viel auf die Arbeiten, die er bei Ihlain in der Schmiede verrichtet hat. Selbst Hahles und sein Vater haben gemeint, er könnte tatsächlich einen brauchbaren Schmied abgeben, wenn jemand ihn in die Lehre nehmen würde.“
„Und wer soll das sein?“, höhnte Baldhon. „Jeder Schmied auf dem Glauberg hat mindestens ein eigenes Kind oder Anverwandten, an den er sein Handwerk weitergibt. Er müsste sich schon sehr gute Freunde machen, damit einer von ihnen deinen kleinen Schwätzer in die Lehre nimmt – gerade in seinem Alter.“
„Ja, mag sein“, winkte Adavall ab. „Deswegen bin ich aber eigentlich gar nicht zu dir gekommen.“
„Wie schade. Es ist zu köstlich.“
Auf diesen Kommentar schenkte der Bauer dem Alten nur noch ein mildes Lächeln, bevor er einen Schluck aus dem allmählich angewärmten Bierbecher nahm und begann: „Eigentlich habe ich mit dir über dein Vieh sprechen wollen.“
„Oh, hat dich nach deiner Hochzeit der große Reichtum ereilt?“
„Nein, nein“, winkte der junge Mann ab. „Eher das Gegenteil ist der Fall. Der Brautpreis, den ich für Raelhia gezahlt habe, ist bedeutend höher ausgefallen, als ich erwartet hatte. Dass Ihlain mir die Hürde nicht freiwillig so hoch gestellt hat, weiß ich. Aber wenn er ihn geringer angesetzt hätte, wäre womöglich Raelhias Ehre in Zweifel gezogen worden – oder noch etwas schlimmeres.“
„So etwas habe ich vor kurzem erst von einer Töpfertochter gehört“, warf Baldhon ein. „Das junge Ding muss so hübsch gewesen sein, dass ein reicher Händlerspross um sie angehalten hat – und der Vater sein Glück herausforderte. Niemand außer einem verliebten Narren hätte bezahlt, was er verlangte. Aber der dumme Bengel ist tatsächlich darauf eingegangen. Bis eine fremde Hebamme eines Tages bei dem Alten und seiner Tochter erschienen ist und kurz darauf der Brautpreis um zwei ganze Schweine gesenkt wurde. Herausgestellt hat sich, dass die Kleine immer Tücher in ihre Kleidung gesteckt hat, um die schmalen Hüften zu vertuschen. Jung mochte sie wohl gewesen sein, aber mit diesem Körper hätte sie kein lebendes Kind zur Welt gebracht!“
Adavall zuckte mit der Augenbraue über Baldhons fachmännische Beurteilung, die klang, als wäre der alte Bauer bei jener Untersuchung selbst dabei gewesen. In der Hoffnung, dass man ihm die angespannten Nerven nicht anmerken würde, kam der junge Mann zum eigentlichen Thema zurück: „Was das Vieh betrifft …“
„Richtig.“
„Vater hatte letztes Jahr doch unsere Mutterkuh von einem Bullen aus der Siedlung decken lassen. Die Kälber, die sie von ihm ausgetragen hat, sind so klein und schmächtig, dass keines von ihnen den Winter überleben wird. Wir hatten erst die Befürchtung, sie wäre allmählich zu alt. Aber ich habe von einem Freund gehört, dass keines der Kälber, die der Bulle im vergangenen Jahr gezeugt hatte, größer geworden war. Eines ist sogar gar nicht lebend zur Welt gekommen. Es hat deswegen auch schon einiges an Aufheben gegeben – und ich sage dir, ich bekomme die Messer zurückgezahlt, mit denen ich für die Deckung bezahlt habe! Nur kann es sein, dass die alte Kuh vielleicht mit ihren Kälbern im Winter stirbt und ich nächstes Jahr gleich eine neue kaufen muss. Und ich muss gestehen, momentan fehlen mir dazu die Mittel!“
Baldhon nickte. „Ich verstehe schon. Der Junge hofft, dass Baldhon ihm einen besseren Preis macht als der Vater seiner Herzensdame.“
„Ich bin nicht gekommen, um dich übers Ohr zu hauen!“, beeilte Adavall sich, ihn zu beschwichtigen. Der alte Mann jedoch übernahm es zu seiner Erleichterung selbst. Milde lächelnd lehnte er sich dabei in den Stuhl zurück, kippte den letzten Schluck Bier hinunter, wobei ein Rest in seinem struppigen Bart hängen blieb und meinte wohlwollend: „Wenn du sie hierher schaffst, kann der dicke Braune ruhig mal eine Runde auf deiner Kuh reiten!“
Baldhon deutete nickend zum nahen Wald, der sich wie ein Mantel um die Hänge des Umlandes schmiegte, und fasste die Silhouette einiger hochgewachsener Rinder ins Auge, die gut zweihundert Fuß entfernt zwischen den licht stehenden Bäumen am Waldrand grasten. Fast verschwörerisch wurde dann plötzlich sein Blick, als er mit gedämpfter Stimme hinzufügte: „Vielleicht kaufe ich mir aber auch bald einen noch besseren, einen riesigen Bullen! So einem Kerl aus einem Dorf in den Vogelbergen ist es gelungen, Auerochsen zu zähmen. Die Kälber, die seine Kühe seitdem bekommen, sind nach zwei Monaten fast so groß wie sie selbst! So einen würde ich mir schon gefallen lassen. Auch wenn man sich dann eben noch die entsprechende Kuh leisten müsste. Aber die ganze Milch …“
Adavalls Augen waren im Laufe dieser Enthüllung immer größer geworden. Die Zweifel, die sich in seiner Miene widerspiegelten, waren gerade genug verborgen, um nicht als unhöflich zu gelten. Trotzdem schwangen sie in seiner Frage mit: „Und wie bitte kannst du dir das leisten?“
Nun stutzte Baldhon. Der Alte hatte gerade den Mund geöffnet, um weiter von den Auerochsen zu schwärmen, sodass ihm besonders diese Nachfrage nicht zu schmecken schien. Adavall ahnte bereits, dass er sich eine geschönte Version der Wahrheit zurechtlegte. Anstatt ihm diese aber aufzutischen, erhob sich Baldhon auf einmal von seinem Platz und verschwand im Haus. Über die Miene des Bauern hatte sich bei seiner Rückkehr ein so ernster Schatten gelegt, dass Adavall noch kritischer die Stirn runzelte. Baldhon für seinen Teil beobachtete argwöhnisch die Frau seines Nachbarn, die hinter ihrem Haus heilsame Kräuter aus einem Beet erntete, von den beiden Männern aber gar keine Notiz zu nehmen schien.
„Du wirst keinem was sagen, hast du verstanden, Junge?“
Adavall nickte verunsichert. Nachdem Baldhon sich noch ein zweites Mal keiner unliebsamen Zuhörer versichert hatte, ging er direkt neben seinem sitzenden Gast in die Knie und offenbarte diesem in seiner Pranke ein kleines Lederbündel, das er behutsam auseinanderfingerte.
Kaum, da sein Inhalt ans Tageslicht trat, weiteten sich Adavalls Augen vor Staunen. Der junge Mann wollte nach dem kleinen Gegenstand greifen, der dort in Baldhons gewaltiger Hand lag, als könnte er sich nur auf diese Weise von seiner Existenz überzeugen. Der alte Bauer aber zog schnell seine Hand zurück und kam seiner unausgesprochenen Frage zuvor:
„Mein Zweitältester, der Garro, hat es gefunden.“
„Gefunden?“ Adavall traute seinen Ohren nicht. „So etwas findet man doch nicht einfach irgendwo!“ Und Baldhon wusste, dass er recht hatte. In der Hand des Bauern lag ein Schmuckstück, eine Fibel, groß genug, um damit einen leichten Mantel zu halten. Ein tiergestaltiger Wassergeist, ähnlich einem Hund, war als kleine Figur über einer Nadel befestigt worden, aus goldschimmerndem Metall gegossen. Er verjüngte sich nach hinten über dem Gewinde zu zwei stark stilisierten Drachenköpfen, die das Schmuckstück in dreieckiger Form auslaufen ließen.
„Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob ich wirklich zwei Rinder für das Schmuckstück hier bekomme. Hab‘ mich noch nicht getraut, jemanden zu fragen, ob das wirklich Gold ist oder nur Bronze. Und ob so ein bisschen Gold reicht, um zwei Rinder zu kaufen. Ich kann gar nicht sagen, wie viel man für so ein Schmuckstück eintauschen kann. Sowas hab ich ja nie besessen …“
„Baldhon!“ Es war Adavalls scharfer Ton, der den Bauern zum Schweigen brachte. Der junge Mann hatte für einen kurzen Moment tief atmend die Augen geschlossen. Das, was sein alter Freund dort in den Händen hielt, war eine wahrlich kunstvoll gefertigte Fibel. Bei dem Material handelte es sich eindeutig um Bronze, das verrieten schon die Schatten von Grünspan in den feinen Rillen. Adavall aber interessierte sich weder für die Kunstfertigkeit noch das Edelmetall. Eine Erinnerung, ein Bild, hing wie ein Omen vor seinem inneren Auge. Förmlich hielt er sie noch in den Händen, die passende Gussform.
„Wo hast du dieses Schmuckstück her?“ Der junge Mann hatte diesmal mit solchem Nachdruck gefragt, dass Baldhon nicht mehr auszuweichen versuchte. Verunsichert nun schien er erst für kurze Zeit über Adavalls plötzlichen Stimmungswechsel zu spekulieren, bis er durchatmete und flüsternd gestand:
„Du hast doch von der Toten gehört, die kurz nach der Tag-und-Nacht-Gleiche eines Morgens im Steinbruch gelegen hat?“ Adavall nickte nur. „Mein Zweitältester, der Garro, hat sie als erster gefunden. Er hat die Schweine der Hohen Straße zu getrieben, um sie im Wald auf die Weide zu bringen, als sie dort gelegen hat. Der Junge hat sehen wollen, ob sie noch lebt, hat ihre Bluse geöffnet und dann … dann unter ihrer Brust … versteckt … die Fibel hier gefunden. All ihre Bündel und Beutel waren aufgerissen, als hätte man sie ausgeraubt. Deshalb hat er sich gedacht, er könnte das Schmuckstück nehmen. Der Alten hat er dafür eine seiner eigenen Spangen zugesteckt. Damit wird sie vor den Göttern bestimmt nicht schlechter dastehen!“
Adavall lauschte kopfschüttelnd. Wieder und wieder musste er sich vor Augen führen, was der alte Bauer ihm soeben erzählte, der seine Reaktion immer weniger begriff. So gern hätte er es ihm erklärt, erzählt, was Adavall selbst erst begreiflich wurde. Doch er hoffte noch immer, dass er sich täuschte. Er sah die Gussform noch vor sich, die Form, die Ihlains Vater seiner Tage im Auftrag des Fürsten geschnitzt hatte. Die Gussform, in der jenes Schmuckstück vor über zwanzig Jahren gegossen worden war. Gegossen sein musste.
Er hat sie meinem Großvater aus dem Kopf beschrieben – ganz so, wie er sie sich vorgestellt hatte. Deswegen hat dieser dem Fürsten auch das Versprechen geben müssen, dass kein anderer außer ihm Abgüsse aus dieser Form empfangen dürfe. Dhalaitus‘ Vater wollte niemanden sonst diesen Schmuck tragen sehen als seine Frau!
Diesen Schmuck. Diese Fibel.
Es war das gleiche Schmuckstück, das Ihlains Vater einst für den Vater des Dhalaitus angefertigt hatte. Wie, bei allen Göttern, war diese Tote in seinen Besitz gelangt? Adavall schwirrte der Kopf. Ein solch wertvolles, so persönliches Schmuckstück würde sie unmöglich gestohlen haben können. Lediglich eine untreue Sklavin hätte es ihrem Herrn entwenden und an sie weitergeben können, doch wozu? Wozu solcher Bronzeschmuck, der einen viel geringeren Tauschwert besaß als all das viele Gold, das Dhalaitus als Zeichen seiner Würde trug und aufbewahrte?
Baldhon hatte Adavalls Grübelei nun völlig verunsichert. Abwechselnd sah der Alte von dem Schmuckstück zu seinem jungen Freund, schien fast schon zu befürchten, die Kühnheit seines Sohnes hätte ihn mit einem bösen Geist gestraft, der an diese Fibel gebunden war. Der Bauer schien sie bereits vor sich auf den Boden fallen lassen zu wollen, als Adavall endlich aus seiner Starre erwachte: „Du darfst diese Fibel auf keinen Fall zum Tausch anbieten!“
„Warum nicht?“ Jeder Widerstand war aus Baldhons Stimme gewichen.
„Ich kenne sie. Hahles’ Großvater hat sie für die Fürstenfamilie selbst angefertigt. Sie gehört Dhalaitus!“
Raschelnd ging das Schmuckstück im Gras nieder. So schnell hatte Baldhon die Hand zurückgezogen, dass man an einen Fluch hätte glauben können, den die Fibel auf ihren unrechtmäßigen Besitzer legte. Die Worte überschlugen sich nun im Mund des alten Bauern, voller Angst vor der Wahrheit, die er sich niemals hatte vorstellen können: „Das … das wusste ich nicht, das musst du mir glauben! Dhalaitus wird sie wiederbekommen, jederzeit. Du wirst ihm doch nicht sagen, dass mein Sohn die Fibel von einer Toten genommen hat? Wer weiß, wer sie gewesen ist?“
Ja, wer war diese Frau? Die Stirn in Falten gelegt griff Adavall nach dem Schmuckstück und befreite es vom Staub des trockenen Bodens. Wie kam jemand wie sie in den Besitz eines so persönlichen Gegenstandes aus der Fürstenfamilie? Der junge Mann dachte es mehr, als dass er wahrnahm, wie er laut feststellte: „Niemand hat die Tote gekannt, wenn ich mich recht erinnere.“
„Nein, wirklich nicht“, versicherte Baldhon mit heftigem Kopfschütteln. „Sogar Krieger aus der Festung sind gekommen und haben sie sich besehen. Die Kleidung und der wenige Schmuck, den sie trug, ließen auch nicht erkennen, welchem Stamm sie entstammte. Sicher war nur, dass sie nicht von hier kam.“
Wahrscheinlich, stellte Adavall diese Bemerkung in Frage, behielt die Zweifel aber für sich. Was hatte es schon für einen Zweck, Baldhon Vorhaltungen zu machen, obwohl er sich auf dieses Geschehen selbst keinen Reim machen konnte. Hingegen steigerte er dessen Panik mit der Anmerkung weiter: „Vielleicht sollten wir Dhalaitus die Fibel einfach zeigen.“
„Bloß nicht!“ Der Alte stürzte dem jungen Bauern so rasch entgegen, dass dieser schon befürchtete, er würde ihm den Bronzeschmuck mit Gewalt aus der Hand reißen. Stattdessen erschien Baldhon aber von Herzschlag zu Herzschlag ratloser. Die Sorgen, die ihn trieben, waren Adavall nur allzu verständlich, weshalb er ihn zu besänftigen versuchte: „Hahles ist doch mit Dhalaitus’ Bruder, Borigennos, im Moment auf Reisen. Wenn sie wiederkommen, kann ich ihnen die Fibel geben, ohne dass dein Name dabei fällt. Ich werde ihnen einfach erzählen, sie wäre in den Habseligkeiten der Toten versteckt gewesen und bis vor kurzem gar nicht entdeckt worden.“
Der alte Bauer nickte, noch immer verunsichert.
„Baldhon!“
„Ist ja gut. Nimm es! Nimm dieses Ding nur mit dir!“ Und mit diesen Worten ließen die beiden Männer das Thema ruhen. Adavall wusste, dass eine weitere Diskussion mit dem alten Mann keinerlei Früchte tragen würde. Als dieser jedoch wieder begann, die Gerüchte seines Dorfes zu entfalten, kreisten Adavalls Gedanken noch immer um den Bronzeschmuck in seiner Hand, der trotz der Wärme seines Fleisches nicht an Temperatur zu gewinnen schien. Vielleicht, dachte er sich mit einem mulmigen Gefühl, wohnt tatsächlich ein Geist darin.
Durch die Fürstenhalle schallte die Stimme einer Leibwache, dann öffnete sich auf einen Wink hin die Tür. Der Ablauf war so eingeübt, so vertraut, ein seit Generationen ewig gleiches Ritual, dass er zur Seele des Hauses zu gehören schien. Die Vertrautheit schenkte Sicherheit, jedem von ihnen, den Wachen, den Bittstellern, den Sklaven, dem Fürsten selbst. Dhalaitus wusste ganz genau, was dieser Ankündigung folgen sollte. Wie eine sich ständig wiederholende Erinnerung begrüßten sie ihn alle mit den gleichen Gesten, den gleichen Ehrbekundungen. Und dass sich daran nie etwas geändert hatte, war gut so.
Regungslos wie eine Statue thronte der Fürst auf seinem kunstvoll verzierten Stuhl, der ihm den Blick über die ganze Halle ermöglichte. Wer gerade zur Tür hereinkam, war ein auf seine Weise ebenso vertrauter Mensch. Seine braun gebrannte Haut hatte ihn als Fremden schon lange enttarnt und Zeit genug dafür gegeben, dass die Nachricht seiner Ankunft rechtzeitig auf dem Glauberg verbreitet werden konnte.
Seine vertraute Kleidung – eine wollweiße, im Vergleich zum Gewand des Fürsten geradezu unscheinbar wirkende Tunika, die er über eine einheimische, karierte Reiterhose gezogen hatte – verriet ihn als Mann der Stämme, wenngleich seine Heimat viel weiter im Süden lag. Sein kantiger Dialekt hatte seine fremde Herkunft bereits durch die geschlossene Tür hindurch offenbart. Kaum, da der Gast über die Schwelle getreten war, löste er Schwertscheide und Messerheft von seinem Gürtel, sank auf die Knie und hielt dem Fürsten die Waffen den Griff voran entgegen, worauf einer der Leibwachen sie zu Dhalaitus’ Füßen legte. Dieser Akt selbst war symbolisch. Nur ein Wahnsinniger hätte versucht, den Eberfürsten, Ahn des Uedhor-Sohnes Garwan, in seinem eigenen Haus im Angesicht einer zehnköpfigen Leibwache anzugreifen. Die Geste allein jedoch zollte dem Herrscher der Uedhoreiba großen Respekt. Denn sicherlich hatte er bei seinen eigenen Leuten die Kriegerweihe vollführt und trug seine Waffen auch als Zeichen seines Status als freier Mann, der erfolgreich seine Ehre gegen alle Feinde verteidigt hatte.
Eine so respektvolle Begrüßung schuf jedoch eine gute Grundlage für das Anliegen, aufgrund dessen der Fremde den Glauberg überhaupt besuchte. Noch während die Leibwache dessen Waffen ablegte, richtete er das Wort an den Fürsten: „Mein Herr Dhalaitus, Ahn des Uedhor, Geweihter der Götter, ein ganzes Jahr habe ich auf meiner Reise in den Süden verbracht, um dort in Eurem Namen Handel zu betreiben. Für die Waren, die Ihr mir anvertraut habt, habe ich gute Preise erzielen können. Teutates sei Dank, ist nichts davon beim Überqueren der Alpenpässe den Berggeistern oder Wegelagerern zum Opfer gefallen!“
Dhalaitus lauschte seinen Worten mit Wohlwollen. Obgleich die Geschehnisse der vergangenen Tage noch wie ein dunkler Schatten unter der Hallendecke zu hängen schienen, schuf diese Nachricht Zuversicht – wenn auch nur für den Moment. Unweigerlich blitzte wieder Bhranags Bild vor den Augen des Fürsten auf, das leblose Gesicht, im Frieden des Todes ergraut, bevor gierige Flammen es für immer in Asche verwandelten. Auch er hatte den Händler im vergangenen Frühling mit einer Bitte auf Reisen geschickt. Es würde sich zeigen, ob ein anderer Abnehmer an den Waren Interesse hätte.
Mit einem unmerklichen Kopfschütteln gelang es ihm jedoch, die düsteren Erinnerungen für den Moment zu vertreiben. Nickend bekundete der Fürst seine Zufriedenheit über die Nachrichten des Händlers, bevor er die Begrüßung erwiderte: „Es freut mich sehr, Euch, Korhain, nach so langer Zeit wohlbehalten anzutreffen. Die Götter haben mein Bitten erhört.“ Eine kurze Geste seiner Hand verwies den Mann namens Korhain zu einem Stuhl unweit seines eigenen Platzes, was er lächelnd begrüßte. Vorher jedoch rief der Händler zwei sehr fremdländisch klingende Namen in Richtung der Tür, woraufhin zwei braun gebrannte, nur deutlich einfacher bekleidete junge Männer nach und nach Säcke und Karren verschiedenster Handelswaren über die Türschwelle zogen.
Sie allein zogen bereits Dhalaitus’ Aufmerksamkeit auf sich, noch während sie ein Tuch auf dem Boden ausbreiteten, um die Waren dort anschaulich darzustellen. Im Gegensatz zu Korhain, dessen blonde Haare und mit vertrauten Symbolen geschmückten Amulette – ein Sonnenrad und sein Stammestotem, ein stark stilisiertes Pferd – ihn als Kind der Stämme auswiesen, waren die beiden Männer drahtig gebaut und zeichneten sich durch einen hellbraunen Hauttyp aus. Die lockigen, kastanienbraunen Haare trugen sie kürzer als die Eberleute und mit einem Lederband nach hinten gebunden. Beide waren so hoch wie Dhalaitus gewachsen, im Vergleich zu seinen Kriegern jedoch war der Fürst eher klein und zierlich. Keiner von ihnen wagte es, den Blick zu heben oder gar dem neugierigen Fürsten in die Augen zu sehen – ganz so, als hätte man ihnen diese Lektion mit vielen Schlägen ins Gedächtnis geprügelt.
Ganz ohne dass Dhalaitus eine Frage stellen musste, begann Korhain, dem das Interesse des Fürsten nicht entgangen war, zu erzählen: „Im vergangenen Jahr, kurz nach meiner Ankunft im Süden, habe ich das Wagnis auf mich genommen und bin von den Ländern der Salzfürsten bis an den Fuß des Gebirges gereist, in eine Siedlung, die ihre Bewohner Manthva nennen. Die Händler der Salzländer beziehen ihre Waren von den dort ansässigen Einheimischen und bieten diese zum Teil in ganz anderen Mengen und deutlich besseren Preisen an. Den Bernstein, den Ihr von den Küsten im Norden erstanden habt, hatte ich nach nur einem Tag eingetauscht und eine beträchtliche Menge Kostbarkeiten erstanden. Unter anderem meine beiden neuen Sklaven. Gefallen sie Euch, Dhalaitus?“ Korhain witterte bereits ein neues Geschäft. „Einer von ihnen ist ein ganz ausgezeichneter Sänger und hat in seiner Heimat viele Lieder erlernt, wie man sie hier im Norden noch nie gehört hat. Leider ist seine Bereitschaft, sich unsere Sprache anzueignen, dürftig. Wenn es Euch beliebt, gibt er jedoch gern eine Kostprobe seiner Künste.“
„Später gern“, winkte Dhalaitus ab. „Mich würde gerade viel mehr interessieren, was Ihr für meine Tauschwaren außer zwei weiteren hungrigen Mägen erstanden habt.“ Der Fürst schmunzelte über seinen eigenen Scherz und lehnte sich im Stuhl zurück. Korhain, der sogleich aufgesprungen war, um sich nun zu überlegen, was er seinem Herrn als erstes präsentieren sollte, war auf dem Glauberg seit Jahren ein gern gesehener Gast. Obgleich die Pferdeleute noch weiter südwestlich siedelten, an dem gewaltigen Strom Rheno, der sich sechzig Meilen vom Glauberg entfernt mit dem Moenus vereinte, handelte Korhain schon lange auch im Namen der Eberleute. Im Gegensatz zu deren Händlern nämlich ging er das Wagnis ein und folgte mit Schiffen dem Rheno bis in das riesige südliche Gebirge, die Alpen, die Dhalaitus nur aus Geschichten kannte.
Die Waren, die er dort einzutauschen vermochte, bestachen nicht nur durch ihre Qualität, sondern vor allem durch die Exotik ihrer Verarbeitung, ihres Geschmacks. Jedes Mal, wenn Boten Korhains Ankunft auf dem Glauberg verkündeten, freute Dhalaitus sich wie ein Kind darauf zu sehen, was der etwa gleichaltrige Mann aus dem Süden mitgebracht hatte. Und er hatte auch diesmal nicht zu viel versprochen.
Als erstes öffnete Korhain einen mit Wachs versiegelten Tontopf und entnahm diesem braune, schrumpelige Früchte, die golden von Honig im Mittagslicht schimmerten. „Ich habe sie für Euch schon vorbereitet“, berichtete der Händler stolz. „Die Salzstämme haben immer nur von ihnen erzählt, jedoch nie genug dieser Früchte mit über die Berge gebracht, damit es sich gelohnt hätte, sie so weit hierher nach Norden zu bringen. Diese Früchte nennt man Feigen und sie sind von vortrefflichem Geschmack. Zu erhalten sind sie ausschließlich jenseits der Alpen.“
Die letzte Aussage war eine Lüge oder ein Irrtum. Dhalaitus scherte sich nicht darum, denn er hatte vor vielen Jahren schon einmal diese getrockneten Früchte als Gastgeschenk eines südlichen Fürsten erhalten und seitdem brennend nach ihnen im Sortiment der örtlichen Kaufleute gesucht – ohne Erfolg. Aus diesem Grund wartete er die Lobesbekundungen Korhains auf Geschmack und heilsame Wirkung der Feigen gar nicht mehr ab, sondern nahm gleich die Schüssel, in die er sie gelegt hatte, entgegen und schob sich die erste von ihnen in den Mund.
Genüsslich kauend verzichtete er damit auf jegliche Nachfragen, während Korhain mit der Erfahrung jahrelangen Verkaufs seine Waren anpries. Kunstvoll gewebte Stoffe, teils in den Mustern der südlicheren Stämme, teils aber auch mit in Manthva gewebten Borten verziert, reihten sich neben sonderbaren, nach unten hin spitzzulaufenden Tonflaschen ein, in welchen die Bewohner des Südens allerlei Flüssigkeiten transportierten. Diese Flaschen sah Dhalaitus heute nicht zum ersten Mal – ebenso wenig wie deren Inhalt: Ein trüber, roter Saft, der aus an Ranken wachsenden Beeren gewonnen wurde und ebenso gut die Sinne vernebelte wie Met, wenn man ihn unverdünnt zu sich nahm.
Besonders beeindruckt zeigte sich Dhalaitus von einem Töpfchen roten Pulvers, das Korhain ihm mit großem Stolz überreichte. Sein leicht stechender Geruch ließ bereits erahnen, wofür man es verwenden konnte. Erst aber als der Händler ihm ein damit gefärbtes, strahlend rotes Tuch überreichte, erkannte er es als Karmesin, einen Stofffarbstoff, von dem sich bereits Dhalaitus’ Vater einen Mantel geleistet hatte. Das Pulver musste ein Vermögen gekostet haben – allein, weil man es im Süden unter den Geschichten verkaufte, es würde aus Läusen gewonnen. Dhalaitus hielt das alles für findig eingesetzte Lügen, um das Interesse der nördlichen Händler daran zu steigern und somit den Preis in die Höhe zu treiben. Ihm selbst war es gleich, die Farbe war so beeindruckend intensiv und Ausdruck größten Wohlstandes, dass sie wahrlich einem Fürsten würdig war. Und der Eberherrscher war bereit, viel dafür zu bezahlen.
Korhain lauschend, wie dieser die Qualität des Farbstoffes lobte, bemerkte Dhalaitus auf einmal laute Stimmen vor der Tür seiner Halle. Gerade genug Zeit verblieb, um die Feigen beiseitezustellen, als eine Leibwache von außen bereits den Eingang freigab und eine Gruppe junger Männer eintrat, begleitet von einer Frau. Ihr Äußeres wirkte mehr als heruntergekommen. Einstmals wertvolle Stoffe waren von langen Ritten durchgescheuert und verdreckt. Strähnige Haare verrieten die Bemühungen, sich ohne Seife oder Seifenkraut nur in Bächen zu waschen, was jedoch nicht immer den gewünschten Effekt gezeigt hatte.
Dhalaitus jedoch sah nichts von dem. Ohne den irritierten Korhain noch eines Blickes zu würdigen, erhob er sich aus seinem Stuhl, sein Glück kaum fassend. Was er aber sah, war real. Die Götter hatten seine Gebete erhört, seine Opfer angenommen, jedes einzelne von ihnen. Borigennos war zurückgekehrt. Und die Frau, die an seiner Seite lief, war Dunaan.
Achtzehn Tage waren vergangen, bis sich vor den Reisenden endlich aus den Frühnebeln der Glauberg erhob. Das geschäftige Treiben, das selbst in diesen frühen Morgenstunden den Marktplatz bestimmte, dröhnte in ihren Ohren wie Hornstöße, so fremdartig erschien es im Vergleich zu der Einsamkeit der Raino. Die kleine Gruppe ließ sich von der Menschenmenge durch die Wege der Siedlung spülen, bis sie endlich am Ziel war, vor dem Haus ihres Fürsten.
Dunaan konnte die Erleichterung nicht beschreiben, die ihre Schritte ganz von alleine beschleunigte. Sie war zu Hause! Es war mehr als ein Monat vergangen, seit sie gegen ihren Willen die Heimat ihres Onkels hatte verlassen müssen. Und nun – als sie den Glauberg wie ein Trugbild ihrer Träume aus den Nebeln des Morgens auferstehen sah, schien es ihr wie eine unwirkliche Illusion aus jenem vergangenen Krieg, die Schlacht mit den Hirschleuten endlich hinter sich gelassen zu haben.
Eine Illusion, das schien es wahrhaftig zu sein. Die Nachricht des drohenden Krieges mit den Widderleuten und ihren sonderbaren, fremdartigen Verbündeten hatte sich einem Schatten gleich über die Gemüter aller Heimkehrenden gelegt. Schockiert und angetrieben von diesem Wissen war selbst Drabal nicht in seinem Heimatdorf verblieben, sondern hatte den perplexen Licates nach einem Tag der Rast allein zurücklassen müssen. Der Schamane war ihnen, zu Hahles’ Bedauern, nicht gefolgt. Ihm selbst war es verständlich, dass Drabal als dessen langjähriger Freund es vorzog, Dhalaitus vom Glauberg aus in die Schlacht zu folgen, statt an der Grenze zu den Widderleuten wie ein Gastgeschenk auf den drohenden Angriff zu warten. Doch Licates hatte die Menschen, die Bewohner am Rande der Vogelberge, nicht im Stich lassen können. So trennten sich ihre Wege. Und als der Krieger Drabal an diesem Morgen nun an den Pfostenschlitzmauern des Glaubergs vorüberlief, schien er zu zweifeln, ob es nicht die bessere Entscheidung gewesen wäre, an der Seite seines Freundes zu bleiben.
Das Gefühl, die einzigen zu sein, die in diesem bunten Treiben wirklich erahnten, was die Zukunft für jene Bastion zum Fuße der Vogelberge bringen sollte, war für sie alle sonderbar. Dunaan für ihren Teil zwang sich dazu, die Gedanken an einen kommenden Krieg zu verdrängen. Sie war endlich heimgekehrt – und einen Moment lang wollte sie sich einfach nur freuen, bei ihrer Familie zu sein. Bhranag hatte längst aufbrechen und sie und Borigennos mit sich nehmen wollen.
Beflügelt von diesem Gedanken beeilte Dunaan sich, bei der ebenso erstaunten wie erleichterten Wache um Einlass bei Dhalaitus zu bitten. Die Freude über ihre Ankunft hatte ihre Aufmerksamkeit so gefangen genommen, dass niemand besonders auf den nach Verwesung stinkenden Menschenkopf geachtet hatte, der aufgespießt am Rande des Marktplatzes all denen eine Warnung sein sollte, denen der Gedanke des Verrates gekommen war.
Offensichtlich hatte den Fürsten niemand vorgewarnt. Ganz in das Gespräch mit einem Händler vertieft, schien er erst zu begreifen, wer so eben gekommen war, als die jungen Leute mitten im Raum standen. Sprachlos hatte Dhalaitus sich von seinem Platz erhoben, gekleidet in eine bunt karierte Hose und ein waidblaues Hemd von bester Qualität. Die Mittagssonne, die durch den Rauchabzug in den Saal fiel, schien das Blond seines Haares zu entzünden, ein Lichterkranz über dem Torques, dessen Gold rein und klar leuchtete, als schmückte es einen Gott selbst.
Dhalaitus schien es nicht fassen zu können – und wenn Dunaan ehrlich war, erging es ihr nicht anders. Endlich, keiner wusste nach wie langer Zeit, erwachte der Fürst aus seiner Erstarrung. Seine Hand krallte sich um die Lehne seines Stuhls, als entglitt ihm ohne diese Stütze das Gleichgewicht, während er aufstand und auf seine Anverwandten zuging. Riten und Förmlichkeit prallten auf viel menschlichere, viel einfachere Gefühle: Die Freude, die Erleichterung. Keiner von ihnen wusste recht, was man von ihm erwartete, bis Dhalaitus vor seiner Nichte stehen blieb und ihr zuhauchte: „Willkommen zu Hause!“ Dann schloss er sie in die Arme. Er hielt sie, wie ein Vater seine Tochter hätte begrüßen müssen. Eine Geste, stellvertretend für Bhranag, der doch eigentlich an seiner statt hätte stehen müssen, es aber nicht mehr konnte. Dunaan spürte die Wahrheit, bevor sie es wusste. Die Frage, die eine Frage, die für Herzschläge zwischen ihnen schwebte, sprach sie gar nicht mehr aus. Sie wusste plötzlich, was Dhalaitus ihr sagen wollte, der keine rechten Worte dafür fand. Und es war auch nicht mehr nötig gewesen.
Eine einzige Träne entkam der jungen Frau. Ihr ganzer Körper gefror in Dhalaitus’ Umarmung. Dunaan wusste, dass er hier, in seiner Halle, vor allen Augen der Wachen und seiner Gäste, als erstes der Fürst war und dann ihr Onkel. Dunaan stand es nicht zu, so persönlich, ganz ohne die nötige Distanz, die Trauer mit ihm zu teilen, die wie ein Unwetter über ihr zusammenschlug, jeden ihrer Gedanken lähmte. Bhranag war alt gewesen. Niemand hätte es verwundert, wenn er in wenigen Monaten an einer Krankheit oder beim Jagen gestorben wäre. Und doch, nichts, einfach keine der Gewissheiten, die sie sich immer wieder vor Augen hielt, hätten die junge Frau auf diesen Augenblick vorbereiten können.
Die erste Regung, die in Dunaan erwachte, war lange eingeübt. Mit der Förmlichkeit, die diesem Anlass gerecht wurde – einer offiziellen Begrüßung des Fürsten vor seinen Würdenträgern – löste die junge Frau sich aus seiner Umarmung mit der Ruhe eines Felsens. Die Luft im Raum schien plötzlich an Temperatur verloren zu haben. Trotz der Sommerhitze begann Dunaan zu zittern und weckte spätestens jetzt das Misstrauen aller Angekommenen, von welchen Borigennos als erster seine Zurückhaltung einbüßte.
„Ist etwas vorgefallen?“ Auch der Fürstenbruder schien die Wahrheit zu ahnen. Dunaan fühlte wie eine Fremde, dass sein Arm sich stützend um ihre Schulter legte. Sein Blick aber hielt Dhalaitus gefangen, der nicht zu wissen schien, wie er beginnen sollte. Keine Antwort folgte. Sie beide waren die einzigen, die sahen, dass auch seine Lippe sachte zitterte – und damit die Unantastbarkeit seiner Aura zerstörte, in die er sich wie in einen Mantel zu kleiden versuchte.
Statt zu sprechen, öffnete er seine Hand und deutete auf einen kleinen Tisch am Rande des großen Raumes, den der Fürst gewöhnlich für alle offiziellen Angelegenheiten gebrauchte. Dunaan wollte gar nicht hinsehen, als könnte die Wahrheit damit ungeschehen werden. Auf dem Tisch stand ein tönernes Gefäß. Ein geschickter Töpfer hatte kunstvolle Motive in die nasse Erde geritzt, sodass es wirkte wie ein rituelles Opfergefäß. Vorsichtig kam Dunaan näher. Sie hörte, wie Borigennos ihr folgte. Dieses Gefäß war keine gewöhnliche Opferschale. Es war eine Urne – nach den Vorbildern ihrer Ahnen geschaffen.
Ein Stich fuhr durch den Magen der jungen Frau. So unwirklich schien es – und war doch nichts als die Wahrheit. Mit zitternden Händen öffnete sie den Deckel, ihre rechte Hand glitt in die Urne hinein, griff nach seinem Inhalt und hielt die Asche eines Menschen zwischen ihren Fingern.
Niemand im Raum sagte ein Wort. Apathisch starrte Dunaan auf ihre Hand und beobachtete, wie die hauchfeinen Körner in die Urne zurückfielen. Asche. Ihr Vater war zu Asche geworden. Dhalaitus’ Stimme schien wie ein Echo in dem großen Raum widerzuhallen, als er endlich in der Lage war zu sagen: „Bhranag … tötete nach der Schlacht gegen die Hirschleute den Verräter Aehlos, um dich zu rächen, Dunaan. Zur Sonnenwende jedoch rächte diesen dessen Vater, der den Verlust seines Sohnes nicht ertragen konnte. Den Mörder konnten wir fassen und ein angemessenes Urteil walten lassen. Bhranag aber … konnte ich nicht mehr helfen.“
Langsam machte Dunaan drei Schritte rückwärts. Sie sah Dhalaitus nicht an, sondern ließ ihren Blick auf der Urne haften, als hätte diese die Macht, alle Dinge ungeschehen zu machen. Sie fühlte Borigennos’ warmen Körper an ihren Rücken stoßen, dann wich aus ihren Beinen jegliche Kraft. Mit einer schnellen, aber erschrockenen Bewegung fasste der Bruder des Fürsten unter ihre Arme und fing sie gerade noch rechtzeitig auf, bevor sie zu Boden fiel.
Binnen Herzschlägen holte die Verzweiflung sie ein. Sie konnte nicht mehr denken, der Klang ihrer Worte hatte seinen Ausdruck verloren. Wie versteinert blickte sie auf die Urne. Ihr Vater war tot, tot bevor sie zu ihm zurückgekehrt war.
Mit einem harten Schlucken rutschte der Knoten aus ihrer Kehle. Dann begann sie zu weinen. Dunaan spürte, wie Borigennos trostspendend die Arme um sie legte, selber kaum in der Lage, seine Ruhe zu bewahren. Auch für ihn war Bhranag mehr Vater als Bruder gewesen – nun hatte er sie beide verlassen.
Dunaan leistete keinen Widerstand, als Borigennos sie zur Tür hinaus führte. Ihr Geist schien neben ihrem Körper zu stehen, so sah sie sich laufen, kurz davor, jede Beherrschung zu verlieren. Keiner von beiden wusste, was ihnen diese Stärke verlieh, in Würde vor dem Kummer zu flüchten, bis niemand außer ihnen mehr daran teilhaben konnte.
Schweigend, unschlüssig, was es zu sagen gab, blickten die verbliebenen Männer zu ihrem Fürsten hinauf, der nahezu hilflos seiner Nichte und seinem Bruder nachsah. Er wusste, was sie fühlten. Ihm erging es nicht anders.
Mit einer festen, verbissenen Bewegung verschluckte er eine Träne, die es gewagt hatte, aus seinen Augen ans Tageslicht zu treten. Den kurzen Bericht ihrer Reise, den er sich geben ließ, hörte er nur mit erzwungener Aufmerksamkeit. Es war allen anzusehen, wie sehr die Reise an ihren Kräften gezehrt hatte. Und auch deshalb trug er es ihnen nicht nach, dass sie vergaßen, den zerlumpten Fremden, der mit ihnen gekommen war, vorzustellen. Kaum da Halvo, der das Wort ergriffen hatte, seine Rede beendet hatte, bedankte Dhalaitus sich mit einigen knappen Worten für ihre Hilfe und warf sie dann alle hinaus, selbst Korhain, dessen Sklaven die Waren schon wieder verstauten. Angemessen belohnt werden sollten sie alle. Doch in diesem Moment hatte er keinen Sinn dafür. Schweigend blickte der Fürst den vier Kriegern nach, bis er sich endlich daran erinnerte, was von ihm erwartet wurde und ihnen nachrief: „Wartet noch!“
Fragend hielten die Vier an der Tür nach draußen inne. Der Fürst machte ein paar kurze Schritte auf sie zu, bevor er ihnen mit etwas weicherer Stimme sagte: „Ich werde euch bald Nachricht schicken. Alle Bewohner des Glaubergs sollen dabei sein, wenn ich euch belohne, wie es so tapfere Männer verdient haben.“ Die Krieger nickten stumm. Sie gedachten gerade, Borigennos und Dunaan nach draußen zu folgen, als Dhalaitus auf einmal Cernos zurückrief.
Alle anderen schickte der Fürst in die Siedlung hinab. Er bat den Schamanen: „Setzt Euch, wenn Ihr wollt. Ich hatte gehofft, Euch noch einige Fragen stellen zu können!“
Schweigend ließ sich Cernos auf einem Stuhl nahe dem Sitz des Fürsten nieder, während Dhalaitus wieder Platz nahm und mit einem tiefen Atemzug den Gedanken an seinen toten Bruder vertrieb.
Der Schamane wartete geduldig, fühlte sich jedoch sichtlich unwohl, so unvermutet Teil einer Tragödie geworden zu sein, die den Fürsten und seine verbliebene Familie ereilt hatte. Dhalaitus war verwitwet, hatte Cernos einmal von Eburatos gehört. Außer Borigennos und Dunaan schien nun also kein Verwandter seiner Seite mehr am Leben zu sein.
Dhalaitus ließ sich Zeit, seine alte, respektvolle Ruhe wiederzugewinnen, bevor er mit klarer und deutlich gestärkter Stimme zu dem Widdermann sagte: „Die Überbringung der Todesnachricht meines Bruders hat uns bisher nicht viel Zeit gegeben, uns miteinander bekannt zu machen.“ Der Fürst räusperte sich beinahe lautlos. „Nach all dem, was mir bisher von Hahles und Borigennos zugetragen wurde, seid Ihr jener verschwundene Schamane, von dem Hahles uns bereits vor seiner Abreise zu den Widderleuten erzählte.“ Dann auf einmal lächelte er matt. „Hätte Hahles gleich gesagt oder gewusst, dass Ihr Widdermann seid, wäre mir sogar in den Sinn gekommen, wer Ihr seid. Cernos ist Euer Name, richtig? Ihr seid der Cernos, Ehemann von Eburatos’ Halbschwester Mavilis? Ich habe Euch selbst die Schamanenwürde verliehen!“
„Das ist wahr.“ Der Name der Frau verdüsterte Cernos’ Miene. Er war froh darum, dass Dhalaitus diskret blieb und nicht nachhakte. Der Fürst rettete den Schamanen aus seinen Gedanken, indem er weitersprach: „Beinahe fürchte ich, von meiner Seite ist eine Entschuldigung fällig.“
Cernos zog die Augenbrauen in die Höhe.
„Ja, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich Eure Warnungen ungeachtet ignoriert habe. Warnungen, die Euch beinahe das Leben gekostet haben, wie ich gehört habe.“
„Die Götter wissen, was sie tun.“ Obwohl Cernos sich darum bemühte, die Missgunst über Dhalaitus’ Ignoranz nicht in seine Stimme zu legen, sah er, dass der Fürst doch davon Notiz nahm – und sich bemühte, darüber hinwegzusehen. „Solange Ihr noch rechtzeitig handelt, um Heimeran aufzuhalten!“
Auf Dhalaitus‘ Gesicht trat ein spöttisches Lächeln. „Darüber macht Euch keine Sorgen. Ich verspreche Euch, heute werde ich zuhören. Ihr selbst werdet mir sicher Genaueres erzählen können, als die verunsicherten Boten, die Ihr mir geschickt habt. Verratet mir, warum habt Ihr Euch von Eburatos abgewandt?“
„Ihr habt recht“, begann Cernos. „Dass ich als Gefangener Eurer Nichte begegnet bin, erfolgte auf den Befehl von Eburatos selbst. Er hat mich zum Tode verurteilt, obwohl sein Name längst verflucht ist. Eburatos hat seine, Eure, Götter verraten und ist damit nicht mehr mein Fürst!“
Dhalaitus zog eine Augenbraue in die Höhe. „Ihr habt Eburatos verraten. Verraten wegen Vermutungen, die Ihr mir gesandt habt, Befürchtungen, die Ihr zu dieser Zeit noch nicht beweisen konntet. Natürlich hat es mich nachdenklich gestimmt, dass Eure Boten sagten, Eburatos hätte sein Heer für die kurze Schlacht mit den Wolfsleuten durch Söldner verstärkt. Gerne hätte ich davon gewusst, aber was spricht dagegen? Das habe ich auch schon getan.“ Cernos presste missfällig die Lippen aufeinander und der Eberfürst nickte verstehend.
„Warum bitte sollte ich Euch vertrauen, wenn Ihr selbst Eurem eigenen Fürsten nicht die Treue halten könnt?“
„Ihr habt ja keine Ahnung!“, begehrte Cernos nun auf. „Er hat Uedhor verraten – und Dunaan ist dafür meine Zeugin.“ Jene Worte hinterließen in seinem Mund einen bitteren Nachgeschmack. Mit finsterem Blick schob sich der Schamane eine seiner ergrauten Haarsträhnen hinter das Ohr und stellte sich wieder Dhalaitus’ Musterung.
„Was hat er getan?“
Für einen Herzschlag schwebte die Frage zwischen den Männern, wurde zu einer Grenze, die für beide einen neuen Abschnitt in ihrem Leben eröffnete. Cernos wusste, dass dies die letzte Chance war, alles ungeschehen zu machen, zurückzukehren, wohin es längst keine Rückkehr mehr gab. Nur würde ein Augenblick der Feigheit nichts rückgängig machen, gar nichts. Deshalb begann er zu erzählen, alles, was er wusste und erfahren hatte, seit er den letzten Boten zu den Eberleuten geschickt hatte. Vor dem Eberfürsten wagte er nicht, den Lehrmeister zu spielen, womit er Dunaans Nerven herausgefordert hatte. Dhalaitus folgte seinen Ausführungen schweigend und hörte sie ganz bis zum Ende. Und so wie Dunaan fiel auch ihm es schwer, sie zu glauben. „Das ist die Wahrheit?“ In seiner Stimme schwangen Zweifel mit, obwohl seine Augen verrieten, dass die Erzählung gar nicht unmöglich klang. Cernos nickte. „Die ganze und reine, so wahr die Götter meine Zeugen sind.“
Hinter Dhalaitus’ Stirn begann es zu arbeiten. Cernos kämpfte gegen die Erschöpfung an, die seinen Beinen nach und nach jede Kraft entzog. Froh darüber, ohne zu zittern eine Verbeugung zustande zu bringen, fragte er danach: „Gibt es … sonst noch etwas, das ich für meinen Fürsten tun kann?“
„Ob ich wahrhaftig Euer Fürst sein werde, entscheiden wir an anderer Stelle.“ Der scharfe, wenn auch nicht unfreundliche Ton des Fürsten, ließ den Schamanen zurückweichen, bevor er Cernos entließ: „Aber wenn wir davon absehen, gibt es im Moment nichts, was Ihr tun könntet. Ich danke Euch.“
Der Schamane verabschiedete sich darauf mit einer stummen Geste und verließ zügig das Haus des Dhalaitus – auch wenn er nicht wusste, welcher Drang ihn zur Flucht verleitete. Soeben hatte er sich festgelegt, seine Loyalität war neu geschworen. Der Schamane konnte nicht sagen, was er fühlte. Er war geflohen, geflohen aus seiner Heimat und fremden Menschen gefolgt, die er zuvor weder gesehen noch gekannt hatte. Sicherlich, bei den Eberleuten war er aufgewachsen – doch machte dies das Land Uedhoreiba zu seiner Heimat?
Mit einem stummen Gruß entfernte sich Cernos von der Leibwache des Fürsten, verließ mit einigen großen Schritten das Plateau und sah versonnen auf den heiligen Bezirk hinab. Andere Schamanen, gekleidet in die Trachten ihres Standes, schritten auf einer schweigenden Prozession zu den heiligen Hainen des Glaubergs hinauf.
Der Glauberg. Er war es gewesen, der Cernos schon als Kind zum Diener der Götter hatte werden lassen wollen. Seit er sehen und laufen konnte, hatte der Schamane sie gespürt, die ruhende Kraft dieses Berges mit den Geistern längst Verblichener aus fernen Jahrhunderten.
So recht wusste Cernos jedoch nicht, was er nun tun sollte. Angekommen von seiner Reise, seinen Auftrag ausgeführt, stand der Schamane nun wie am Anfang eines eigenen, neuen Lebens. Eine laue Brise zog über das hölzerne Ahnendenkmal hinweg. Nun gab es nichts mehr.
Nichts mehr und doch alles. Im Grunde war es wahr, er war ein Verräter – und somit kein Widdermann mehr. Er war niemand. Ausgeschlossen von seinem Stamm und den Einzug in einen neuen verweigert, war Cernos im Grunde mittellos. Kein Fürst schuldete ihm Schutz oder Gerechtigkeit. Man konnte ihn angreifen, verletzen, töten – und niemandem drohte Strafe. Nur Dhalaitus’ Wohlwollen konnte ihn schützen. Mochte er dieses jedoch verlieren, war er der Willkür von jedem einfachen Tagedieb ausgesetzt.
Cernos wandte seinen Weg noch ein Stück abwärts den Hang hinab. Was mochte es ihn kümmern, welche Pläne Dhalaitus schmiedete? Ihn kümmerte nichts, in diesem Moment wirklich gar nichts. Sein Kopf war wie leer. Jegliche Gedanken, ob an Krieg oder an die Zukunft hatten mit einem einzigen Augenblick an Bedeutung verloren. Als käme jene Reise zum Glauberg einer Einkehr in die Andere Welt gleich, so fühlte er nun. Er hatte alles getan, alles was er mit seinem Leben gerne bezahlt hätte. Sein ganzes Leben für einen kurzen, nichtigen Augenblick. Dhalaitus hatte seine Worte wahrgenommen, er hatte ihm geglaubt, ihm gedankt – und nun? Nun war alles vorbei. Dhalaitus war ein wahrer Erbe des Uedhor, vielleicht sogar der wiedergeborene Garwan. Was sollte sich ihm noch in den Weg stellen außer den Göttern selbst?
Noch feucht vom trocknenden Tau der Nacht strich das Gras der Wiese um die Hose des Schamanen. Für wenige Tauschgüter hatten die Eberleute in einer kleinen Siedlung in den Vogelbergen für Cernos neue Kleider erstanden. Notwendig waren sie gewesen, doch verbergen mochten sie nicht, welche Narben die Zeit der Entbehrung hinterlassen hatten. Er war mager geworden. Alle Muskeln, die er sich hart hatte antrainieren und erarbeiten müssen, waren zu einem Minimum zusammengeschrumpft und verweigerten somit dem Schamanen den Dienst, den er ihnen zu gerne abverlangt hätte. Eine schleichende Müdigkeit war seit ihrer Ankunft am Glauberg in seine Lider gekrochen, und je länger Cernos sich seinen Weg über die verlassenen Wiesen suchte, desto mehr fühlte er sich wie benommen. Schier ziellos schritt er durch das Gras, als er auf einmal vor sich eine Gestalt am Hang sitzen sah.
Cernos den Rücken zugewandt und ihre Arme um sich geschlungen, als wiege sie sich selbst in den Schlaf, kauerte Dunaan auf der feuchten Erde der Wiese. Ein Zittern lief über ihre nackten Arme, die aus den weiten Ärmeln ihrer Bluse hinaussahen. Der Schamane konnte nicht sagen, ob sie weinte, ob sie fror, ob es eine andere Art Kälte war, die ihren Körper gefangen hielt. Doch was immer es sein mochte, es verlief lautlos.
Im ersten Augenblick wusste der Schamane gar nicht, was er tun sollte. Leise, in der Hoffnung die junge Frau nicht zu stören, wollte Cernos sich bereits umdrehen, als er auf einmal Dunaan fragen hörte: „Was führt Euch hierher, Cernos? Ich dachte, Ihr habt Dhalaitus wichtige Nachrichten zu übermitteln!“
Ihre Stimme war tonlos. Wie als schwebe ihr Geist weit weg von ihrem Körper über den Wiesen des Glaubergs und spräche nur von fern durch ihren Mund. Leer waren ihre Augen, leer und ohne Glanz. Unschlüssig antwortete Cernos, mehr der Höflichkeit wegen: „Ich habe Euren Onkel bereits unterrichtet. Er hat wahrgenommen, was er wissen muss.“
„Gut …“
Wüsste der Schamane nicht, welche Situation bleischwer auf den Schultern der Fürstennichte lastete, hätte er glauben können, sie hätte sich an den Rauschmitteln für religiöse Zeremonien bedient. Dunaan schien gar nicht anwesend, ihr Geist war fort, weit weg, fortgereist in alte, längst vergangene Tage. Die junge Frau schwieg. Cernos stritt innerlich mit der Frage, ob er nun bleiben oder fortgehen sollte. Doch als er Dunaan so sitzen sah, ihre Augen leer und die Lider zugeschwollen, wie es einer Greisin hätte zustehen können, hielt er es für angebracht zu sagen: „Es tut mir Leid … um Euren Vater. Ich zweifle nicht daran, dass er ein großer Mann gewesen ist und er ruhmreich in die Reihen Eurer Ahnen aufgenommen wurde!“
Dunaan antwortete nicht. Cernos konnte ihr Gesicht nicht erkennen, um zu sagen, ob es stumme Tränen waren, die über ihre Wangen liefen oder ob sie die Schwelle übertreten hatte, da man nicht mehr weinen konnte.
Es dauerte lange, sehr lange, bis die junge Frau seinen Worten endlich entgegnete: „Manchmal glaube ich, Borigennos trifft sein Tod schwerer als mich. Er hat zwar nicht darüber gesprochen und ich weiß, er wird es auch nicht tun, doch ich kann es fühlen. Und fühlen muss ich wohl, denn solche Dinge in Worte zu fassen, gehört nicht zu seinen Stärken.“
„Er wollte nicht bei Euch bleiben, nehme ich an“, formulierte der Schamane knapp und hoffte, dass die junge Frau ihn bald aus diesem Gespräch entlassen würde. Die emotionale Angriffsfläche, die man ihm bot, war Cernos nicht wohl.
„Nein …, nicht jetzt.“ Nach diesen Worten versank Dunaan wieder in Schweigen. Der Schamane glaubte bereits, sich entfernen zu können, als ihn die junge Frau fragte: „Was wollt ihr jetzt tun? Jetzt, da Ihr getan habt, was Euch Euer Leben wert war. Werdet Ihr bei uns bleiben oder verlasst Ihr uns wieder, um Euch eine andere Heimat zu suchen?“
Cernos schwieg lange, während er sich auf die Lippen biss. Sie schien in seine Gedanken zu greifen. Dunaan hatte soeben die Frage ausformuliert, die ihn seit ihrer Ankunft auf dem Glauberg im Magen drückte. Sollte er bleiben? Cernos wusste nicht, was er antworten sollte. Dunaan jedoch griff ihm bereits vorweg: „Ihr solltet nicht bleiben! Wenn es so kommt, wie Ihr es Dhalaitus berichtet habt, werden hier bald Dinge geschehen, die nur die wenigsten gerne miterleben würden!“
Dunaan wandte sich langsam und mit kraftlosen Bewegungen zu Cernos um. Dieser erschrak innerlich, als er sehen konnte, welche Leere sich über ihren Geist gebreitet hatte, einem Vakuum gleich, das alles hinausließ, aber nichts mehr hinein. Ausdruckslos, als wären ihre Augen aus hellem Kristall, sah Dunaan zu ihm hinauf, und er fühlte, wie es ihm einen Stich versetzte, als er sie sagen hörte: „Ich mag niemals ein gutes Gefühl für das Überirdische besessen haben, doch selbst ich als Uneingeweihte kann sehen, dass hier etwas im Gange ist. Etwas, das wir vielleicht noch bereuen werden, in die Wege geleitet zu haben!“