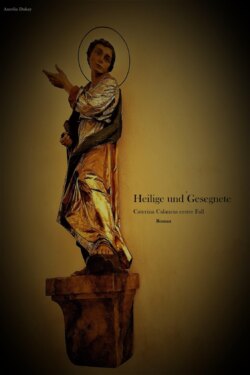Читать книгу Heilige und Gesegnete - Aurelia Dukay - Страница 5
1. Gesang der Nymphen
ОглавлениеEin Opfer? Nein, ich bin kein Opfer. Wahrhaftig nicht!
Opfer sind passiv. Ich hingegen habe gehandelt. Habe dies alles gewollt. Vielleicht nicht bewusst, aber ich habe es gewollt. Also, weil ich es nicht bewusst gewollt habe, bin ich schuldig. Wie soll ich das bloß erklären –
In der dunkeln Stille der Nacht entsinne ich mich meiner Fehler. Jener Taten, die die schrecklichen Ereignisse nach sich zogen, für die ich so hart bestraft werde. Derentwegen ich jetzt am Abgrund stehe und sehnsüchtig auf den Asphalt fünf Stockwerke tiefer starre.
Unglaublich, wenn man bedenkt, dass ich bis vor Kurzem eine Königin war. Aber vielleicht stimmt es, was sie sagen.
Sie beschuldigen mich des Opportunismus. Ich sei eine kalte, berechnende Frau gewesen. Ein skrupelloser Emporkömmling.
Hierzu möchte ich sofort etwas klarstellen.
Ich war weder auf der Suche nach schnellem Erfolg noch hegte ich die Absicht, die Frau eines solchen Mannes zu werden.
Das Einzige – und das schwöre ich -, was mich zum Handeln trieb, war die Suche nach einem Ausweg aus meiner prekären Lage. Aber stattdessen landete ich im tiefsten Abgrund der menschlichen Existenz.
Wie es passierte? Eine banale Schwäche brachte mich zu Fall. Ich ließ mich von der Macht verführen, ohne den Preis dafür zahlen zu wollen. Ich glaubte, die Zeit würde schon alles richten. Ich glaubte aber auch an die Liebe, die Freundschaft, die Staatsgewalt. Die hingegen ließen mich glauben, ich sei verrückt.
Dies ist kein Tagebuch. Ich verwahre meine Gedanken nicht als seien sie kostbare Perlen. Gedanken sind nichts. Nichts als die Ausgeburt meiner gequälten Seele. Ich sammle sie wie Muscheln auf einem langen weichen Sandstrand, um sie gleich wieder fallen zu lassen.
Denn meine Ansichten zählen nicht. Was zählt sind Fakten. Fakten die zur Wahrheit führen. Als Journalistin – denn das bin ich, eine investigative Journalistin – füge ich sie zu einem plausiblen Ganzen zusammen, ohne Umschweife, frei von Ängsten und Sehnsüchten. Hier, in meinem Notizbuch, demselben Notizbuch, in das ich meine Artikel schrieb, demselben, in das ich einst seine Worte aufzeichnete. Hier schrieb ich die Tatsachen nieder, Wort für Wort, Seite für Seite, auf reinem Papier, um zu verstehen. Verstehen, ob ich alles noch mal tun würde. Verstehen, was ich in den nächsten Augenblicken tun werde.
Caterina Calanca klappte den ledernen Taccuino zu und blickte in zwei tiefschwarze Augen, die Brauen darüber hochgezogen.
„Und, Signora Commissario, was sagen Sie?“
„Darf ich das Notizbuch mitnehmen? Vielleicht finde ich darin Hinweise. Ich möchte Ihnen aber keine großen Hoffnungen machen, Signore Bellacqua“, sagte sie ernst.
„Bitte, aber bitte doch, alles was diese schreckliche Tat aufklären kann, Signora Commissario. Schauen Sie, schauen Sie doch nur.“
Seine ledernen Arbeiterhände zitterten, als er ihr einen Bilderrahmen vor die Nase hielt. „Meine Emma hatte ein Gesicht wie ein Engel, wie ein Engel.“
Ja, aber dieses Engelsgesicht lag nun zerschmettert in einer Blutlache auf dem Asphalt vor seiner Haustür, umgeben von Polizisten und Schaulustigen. Was für ein grausames Ende, dachte Caterina.
Allerdings passte das Foto genauso wenig zu der Toten wie die fast aristokratischen Manieren des Signore Bellacqua in das karge, kleinbürgerliche Umfeld.
„Sie hätte so etwas niemals getan. Sie wäre zu so einer Schande nicht fähig. O mein Gott, wie soll ich sie nun beisetzen. Der Priester weigert sich, in mein Haus zu kommen.“
Der kleine Mann mit dem Schnurrbart schlug die Hände vors Gesicht und fing an zu schluchzen.
„Setzen Sie sich doch einen Moment, Signore Bellacqua.“
Er nahm auf einem Holzstuhl Platz, der an der Wand gelehnt hatte, über ihm hing ein vergilbtes Heiligenbild. In der Küche war es einigermaßen still. Nebenan im Wohnzimmer tobte ein Gewusel von unzähligen Menschen, denn die schreckliche Tat hatte sich blitzschnell im Viertel herumgesprochen. Alle kamen sie zur Haustür hereinmarschiert, um ihr Beileid auszudrücken. Mit Empörung auf den zerknirschten Gesichtern sparten sie nicht mit Klageworten, die wie Beschwörungen klangen: Natürlich handelte es sich um einen Unfall, keine Frage, so ein braves Mädchen, und wenn nicht, dann nur weil diese verdammte Arbeitslosigkeit den Geist des zarten Geschöpfes vergiftet hatte. Besessen von einem Dämon, der sie in den Tod getrieben hatte. Eine verirrte Seele – das müsse die Kirche doch einsehen.
Und dennoch, Caterina spürte es ganz genau, irgendetwas stimmte nicht. Das sagte ihr unfehlbarer Instinkt, der dem eines Raubtieres glich. Was genau nicht stimmte, musste sie noch herausfinden.
Signore Bellacqua schien die Ereignisse nur noch am Rande wahrzunehmen, dafür aber Caterina, die seinen musternden Blick auf sich spürte, auf ihrer schlanken Figur, ihren roten Haaren, ihrer hellen Haut und ihren blauen Augen und ihrer eleganten Kleidung. Eine jahrhundertealte Ehrfurcht vor allem Höheren, vor Gott, seinem Willen, dem Schicksal und den Autoritäten – in diesem Fall der Polizei vermischten sich in seinem Blick mit der natürlichen Skepsis gegenüber Frauen in einer Machtposition.
„Ich bin ein einfacher Mann, Signora Commissario, mit einfachen Ansprüchen. Vierzig Jahre lang stand ich jeden Morgen um vier Uhr auf, schuftetet wie ein Tier, um ihr ein besseres Leben zu bieten. Sie war mein ganzer Stolz. Als meine Frau – Gott hab sie selig - starb, wollte sie unbedingt aus dem Ausland zurückkommen, um mich nicht alleine zu lassen. Ich verbat es ihr, aber sie tat es trotzdem. Stur, meine Emma.“
In dem düsteren Appartement mit den vergilbten Heiligenbildern und den massiven Holzmöbeln wurde die Luft langsam schwer.
Hier gab es nichts mehr zu tun, der Leichnam war auf dem Weg in die Gerichtsmedizin, und Caterina hatte keine Lust, Zeit mit Fragen zu verschwenden, auf die sie die Antwort bereits kannte. Arbeitslosigkeit, familiärer Druck, Isolation, Verzweiflung – Ende.
Zugegeben, sie hatte das Notizbuch nur eingesteckt, weil es ihre Neugierde geweckt hatte, denn es bestand kein Zweifel daran, dass der Engel sich ganz alleine in die Hölle gestürzt hatte.
„Wann kann ich sie wiederhaben“, fragte Signore Bellacqua fast apathisch.
„Sobald die Gerichtsmedizin sie freigibt. Es tut mir wirklich leid um Ihre Tochter.“
Seine Miene verfinsterte sich.
Grübelnd verließ Caterina den fünfstöckigen Palazzo, ein bröseliger Betonbau aus den Achtzigern in der Via Garibaldi, im quartiere popolare del Mercato Antico, dem proletarischen Viertel der Stadt.
Draußen drängelten sich hinter der Absperrung inmitten der Schaulustigen mehrere Kameras, darum scharrten sich die vermeintlichen Kollegen der Toten mit ihrer vorgetäuschten Bestürzung. Caterina hasste sie, diese Zunft aufgeblasener Reporter, die überall ihre Nase reinsteckten und vor nichts Halt machten.
„Commissario, ein Kommentar, eine Stellungnahme“, riefen sie laut wie ein Knabenchor in der Kirche, sobald Caterina vor die Haustür trat.
„War es Selbstmord, ein Unfall oder etwa Mord?“
Sie setzte ihre Sonnenbrille auf und unterdrückte das aufkeimende Gefühl der Befriedigung angesichts der Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wurde und lief mit gleichgültigem Blick an der Meute vorbei zu ihrem Auto.
Der kleine Cinquecento stand verloren im Halteverbot, die leuchtend rote Lackierung war vom Wüstenwind ergraut, der von der Sahara herüberblies und seit zwei Tagen die Stadt in eine bleierne Staubwolke hüllte und auf allem eine pudrige Sandschicht hinterließ. Bald würde es regnen. Nach dem Wüstenwind kam immer der Regen, wie ihr die Kollegen erklärt hatten.
Noch war die Luft jedoch stickig und erfüllt vom hektischen Alltag, dem Autohupen, den schimpfenden Menschen die sich über die selbstverschuldeten, unzivilisierten Umgangsformen empörten. Der Weg zum Auto führte an dem bevölkerten Mercato Antico vorbei, wo Caterina bereits auf dem Hinweg ein paar saftige Tomaten ins Auge gefasst hatte.
Sie hatte nun Gelegenheit, welche für das Abendessen zu besorgen.
Den lauten Rufen folgend betrat sie die überdachte Markthalle. Zugegeben das folkloristische Treiben stresste sie, machte aber dennoch den Kopf frei vom schrecklichen Anblick der jungen Selbstmörderin. Die lauten Schreie, die fließend in ohrenbetäubende Gesänge übergingen. Dazu der würzige Duft von wildem Oregano und die raue, bunte Vielfalt der Waren: Aufgeblähte Thunfischlaibe in blutige Stücke zerteilt, gebettet in zerschlagenem Eis wie eine klaffende Wunde, grausam und schön, primitiv und ehrlich, wie nur die Natur es sein konnte, dachte sie. Dazu gesellte sich eine Schar seifiger Tintenfische mit lang schlängelnden Kraken, und Caterina hätte schwören können, ja wirklich, dass sie sich noch bewegten.
Unaufhaltsam floss der Fischsud von den Ständen auf die Pflastersteine und verlor sich in dessen Ritzen, um als penetranter Geruch wieder emporzusteigen.
Caterinas ausgeprägte Abneigung gegen alles Glitschige führte sie an den Fischständen vorbei, zu den überladenen Obstständen bis zum Gemüsehändler an der Ecke.
Aber auch inmitten des Gewirrs spürte Caterina, wie bereits zuvor in der Wohnung der Bellacquas, zwischen den Menschen jene subtile Wolke aus Nichtgesagtem, das zwischen den Worten lag, in einer Geste, in einem Blick, das aber das Wesentliche ausmachte. Das Wesentliche lag im Nichtgesagten! Es konnte sich nur um einen eingefleischten Kodex handeln, der sich durch die Epochen hinweg unter dem Einfluss verschiedener Kulturen zu einem festen Bestandteil der Verständigung geformt hatte. Eine passive Rebellion, eine würdevolle Arterhaltung gegen die vielen Fremdherrschaften, die diese Region seit Jahrhunderten erdulden musste.
Sie wusste, dass sie niemals Zugang zu dieser wortlosen Sprache bekommen würde, so wie ein Hund niemals miauen und ein Kanarienvogel niemals bellen würde. Sie, die blasse Rothaarige aus Verona, mit ihrem engmaschigen Akzent (die Vokale sprach sie geschlossen und nicht wie die Hiesigen, offen aus) war ein Fremdkörper in dieser mediterranen Üppigkeit. Und das würde ihr ihre Arbeit erschweren.
Vor dem Gemüsestand kickten zwei schlaksige Jungs im blauen Fußballtrikot einen Ball hin und her. Der eine hatte "Del Piero", der andere „Buffon“ in weißen Buchstaben auf seinem Rücken stehen.
Dahinter bediente ein Mann gerade eine robuste Frau mit schwarzgelocktem Haar und in einem rot-schwarz gepunkteten Wickelkleid. Dabei amüsierte Caterina, wie sich die Punkte auf dem voluminösen Körper zu eierförmigen Kreisen dehnten und an Blutspritzer erinnerten. Mein Beruf verdirbt mich, dachte sie und beobachtete die Einheimische weiter.
In der linken Hand hielt die Frau mehrere Tüten von vorherigen Einkäufen, während sie mit der rechten Tomaten begutachtete, indem sie den Zeigefinger in das rote Fleisch drückte.
Caterina studierte ihr Verhalten genau, denn sie wollte etwas über die Menschen hier lernen.
„Pierino, gib mir ein Kilo hiervon“, krähte die Frau. Das Fleisch an ihren Füßen quoll durch die Riemen der Sandalen, als seien sie damit verwachsen. Caterina betrachtete ihre eigenen schlanken Füße in den dreihundert-Euro-teuren Dekolleté-Schuhen und wunderte sich über die Laune der Natur.
Pierino wog etliche Zentner und in sein derbes Gesicht hatte dieselbe erbarmungslose Sonne, die auch seinen Tomaten den fruchtigen Duft und die rötliche Farbe verlieh, ihre Spuren hinterlassen. Er machte Anstalten, der Frau etwas in scharfem Dialekt zu sagen. Caterina – für die der Dialekt eine Fremdsprache war - meinte herauszuhören, wie er über die vermeintliche Selbstmörderin sprach.
„Man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber - der Herr im Himmel möge es mir verzeihen - wer zu viel will … Ob der Alte wusste, dass seine Tochter so eine war?“
„Ach, woher sollen wir das wissen? Geben Sie mir noch ein Pfund von den Zwiebeln da.“
„Ein Kilo Tomaten, ein Pfund Zwiebeln, das macht fünf Euro, Signora Lo Presti. Na gut, für Sie drei. Und Grüße an ihren Mann.“
„Danke, Pierino, Gott wird es dir danken. Man sieht sich.“
„Nehmen Sie doch von den Zucchiniblüten”, sagte der Gemüsehändler dann reserviert, aber freundlich zu Caterina.
„Ich nehme ein Kilo von den Tomaten.“
„Aber wieso denn, mögen Sie die Zucchiniblüten etwa nicht, sagen die Ihnen nicht zu, sind sie nicht frisch genug?“
„Doch, aber ich möchte ein Kilo Tomaten, bitte!“
„Sie sind nicht von hier, was?“
„Nein.“
„Touristin? Aus dem Norden, wie. Das macht dann vier Euro.” Caterina protestierte nicht.
„Sie kannten die Tote von der Via Garibaldi?“, fragte sie stattdessen forsch.
Er nickte nur und gab ihr das Wechselgeld. Es war nicht leicht, die hiesigen Anwohner zum Reden zu bringen. Pierinos Blick wanderte zu einer Gruppe von Männern einige Stände weiter.
„Das ist jemand, der weiß, wie man Probleme löst“, murmelte er. „Fremde, die verstehen uns nicht.“
Leicht wie Federn flogen die schmeichelnden Worte des Pierino an Caterina vorbei, während ihr Blick die Männer in der Ferne fixierte, die in Anzügen und mit angespannten Gesichtern vor einem Obststand Halt machten. Sie beschloss, keine Limoni mehr zu kaufen und in Richtung der Männer zu gehen. Doch das vom heruntertropfenden Wasser der Fischverkäufer glitschige Kopfsteinpflaster war nicht der ideale Untergrund für die Ledersohlen ihrer hochhackigen Sergio-Rossi-Schuhe, sodass sie das Gleichgewicht verlor und mit aller Wucht auf ihrem Hintern landete.
Die beiden Jungs, Del Piero und Buffon, unterbrachen schlagartig ihr Spiel, gefroren in einem Ausdruck des Erstaunens mit aufgerissenen Augen, um dann in schallendes Gelächter auszubrechen.
Aus der Menschentraube brach ein junger Anzugträger mit schulterlangem schwarzem Haar aus, um der fluchenden Kommissarin aufzuhelfen.
„Ist alles in Ordnung, brauchen Sie einen Arzt“, fragte der Mann, der um die zwanzig sein mochte.
„Ja, vielen Dank, ich meine: nein“, sagte Caterina noch etwas
benommen.
Die gaffenden Menschen gingen wieder ihren Beschäftigungen nach, die sie aufgrund des Sturzes für einen Atemzug unterbrochen hatten, während eine peinlich berührte Kommissarin etwas wacklig vor ihrem Helfer stand.
„Sie lassen ja die Heiligen vom Himmel plumpsen“, scherzte er.
„Normalerweise fluche ich nicht so“, sagte sie verlegen.
Er lächelte freundlich und vergewisserte sich erneut, ob ihr nichts fehlte. In seinen Augen las sie eine geduldige Gefügigkeit, die er stumm hinzunehmen schien.
„Rico, kommst du, wir müssen gehen“, rief eine gereizte Stimme aus der Menge von Leibwächtern.
„Ich muss los, Ihnen noch einen schönen Tag. Und achten Sie auf die Pflastersteine, die trocknen hier nie“, sagte der junge Mann und rannte eifrig zum Gemüsestand und der sich fortbewegenden Menschentraube zurück.
Leise vor sich hin schimpfend humpelte Caterina zurück zu ihrem Auto, der beige Rock war hinüber und ein zunehmend pochender Schmerz erschwerte ihr das Denken. Sonst wäre ihr wahrscheinlich aufgefallen, dass es doch etwas seltsam war, dass sich ein hochrangiger Politiker samt schmieriger Eskorte in der Nähe des „Unfallorts“ befunden hatte. Nur ein Zufall? War er auf Stimmenfang angesichts der anstehenden Wahlen in zwei Monaten, oder gab es vielleicht doch einen verborgenen Zusammenhang? Der Schlüssel könnte in dem schwarzen Notizbuch liegen, aber weiter konnte ihr von Schmerz benebeltes Hirn nicht denken.
Ächzend und stöhnend stieg sie ins Auto, als ein penetrantes Pfeifen sie davon abhielt loszufahren.
„Halt“, brüllte eine Stimme und ein Mann in abgetragenen Kleidern näherte sich.
„Das mach zwei Euro.“
„Wofür?“
„Dafür, dass ihr Wagen noch hier steht und ich Ihnen beim Ausparken helfe.“
Diese selbsternannten Parkwächter waren zu einer Plage geworden.
Caterina zückte das Portemonnaie aus der cremefarbenen Tasche und zeigte ihre Marke.
„Commissario – aber für Sie mache ich doch eine Ausnahme.“ Wie ein geölter Blitz verschwand er in der Menge.
In dem kleinen Cinquecento kämpfte sich Caterina ihren Weg durch den Mittagsverkehr: Gehupe, rasende Motorräder wirbelten den Sand auf dem heißen Asphalt auf, wütende Menschen empörten sich über die zügellose Missachtung der Regeln, die sie selbst nicht befolgten.
Und dann die ewige Parkplatzsuche vor der Wohnung. Zum Weggelaufen war das hier! „Tu es für die Karriere“, hatte man ihr gesagt. „Du wirst die jüngste Kommissarin des Landes sein!“ Unsinn, man hatte sie nur aus dem Weg schaffen wollen, um … ah ein Parkplatz, endlich!
Ihre Wohnung in einem Jugendstilhaus lag in einer Seitenstraße der zentralen Viale Federico II, die so prunkvoll wie sein Namensgeber war, sich aber nicht der gleichen edelmütigen Demut erfreute. Luxusgeschäfte reihten sich aneinander und verdrängten die charakteristischen Boutiquen, um der Stadt nach und nach das anonyme Antlitz einer typischen, vom Konsum gleichgeschalteten Metropole zu verleihen. Wieder war die Stadt erobert worden, diesmal von Weltkonzernen. Trotz der vermeintlichen Wirtschaftskrise, kauften die hiesigen Damen teure Taschen und Uhren, die sie stolz durch die heruntergekommenen Gassen trugen – und zwar mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der sie sich in der Kirche bekreuzigten.
Am Abend, wenn die Rollläden heruntergelassen und die Lokale geöffnet waren, versammelten sich Scharen junger, modisch gekleideter Menschen, deren einziges Bestreben es war, aufzufallen. Einheitlich zuckten sie zu lauter Musik, wenn man so etwas überhaupt Musik nennen konnte. Neues Geld floss in Alkohol, Drogen und in den Traum, ins Fernsehen zu kommen.
Endlich zu Hause, in ihrem zugegeben noblem Appartement, machte sich Caterina daran, die restlichen Kartons auszupacken. Ins Kommissariat würde sie heute nicht mehr gehen.
Der Nachmittag verging sehr schnell und nach einem leichten Abendessen, die sonnengereiften Tomaten hatten ihr Versprechen gehalten, setzte sich Caterina mit einem Glas Rotwein auf den Balkon. Der Mond schien milchig hinter dem Sandvorhang und offenbarte eine funkelnde Stadt am dunklen Meer. Fischerboote balancierten wie kleine Glühwürmer auf den Wellen. Noch blieb die ganz große Hitze aus, aber der Scirocco sorgte dafür, dass man nicht vor Mitternacht ins Bett konnte, ohne sich - trotz Klimaanlage - in seinem schweißdurchtränkten Laken hin und her zu wälzen.
Caterina öffnete das Notizbuch der Journalistin und begann darin zu lesen. Die Zeilen waren wie von einem Schulmädchen in einer klaren sauberen Schrift verfasst.
10. Oktober
Alles begann genau heute vor einem Jahr. An jenem Tag verspürte ich zum ersten Mal nach dem tragischen Tod meiner Mutter so etwas wie ein vages Glücksgefühl. Mein Herz machte einen Sprung, als hätte es gerade eben begonnen zu schlagen, als ich im Landeanflug die Küste und das tiefblaue unendlich weite Meer vor mir sah.
Ich hätte diesen Moment vollends genießen können, wäre da nicht dieser dicke Mann auf dem Sitz neben mir gewesen, der sich mit einem weißen Stofftaschentuch die schweißbenetzte Stirn abtupfte und dabei wie ein Pferd schnaufte. Er hatte Panik in den Augen. Ich war auch nicht bereit zu sterben (schon gar nicht neben diesem Typen), aber wenigstens behielt ich die Fassung. Das Flugzeug hüpfte auf und ab wie eine furiose Tangotänzerin. Obwohl sich mir der Magen verdrehte, blätterte ich eifrig den Katalog der Fluggesellschaft, um krampfhaft einer Konversation zu entgehen. Vergeblich.
„Leben Sie in Dänemark, werden Sie den Urlaub hier verbringen?“, fragte der Dicke und versuchte, durch Ablenkung die Panik zu überwinden.
„Nein, kein Urlaub. Ich komme zurück, um wieder hier zu leben.“
Diese Worte aus meinem Mund zu hören, machte mich euphorisch. Endlich zu Hause, endlich frei von dem eng geschnürten Korsett der dänischen Regeln, dem Frust der Menschen und der erstickenden Kälte der nordischen Völker. Mein Platz war hier, wo die Menschen warmherzig und das Leben so leicht und luftig war wie die Leinengewänder, die sie im Sommer trugen. Wo Toleranz und Flexibilität den Alltag erträglicher machten.
Toleranz, wirklich?
„Von hier oben aus scheint es wie ein Paradies. Aber diese Schönheit trügt. Wie eine schöne Frau mit einem schlechten Charakter. Sie zieht dich in ihren Bann, um dich dann zu zerstören“, fauchte mein Sitznachbar, noch sichtlich erschüttert von den Turbolenzen. „Dies ist eine verlorene Stadt, wo Korruption, Vetternwirtschaft, Ignoranz und Dekadenz herrschen. Hören Sie auf mich, kehren Sie so schnell wie möglich nach Dänemark zurück.“
Aber ich wollte nicht hören. Ich hörte nur die Turbinen, die mich immer näher an mein Ziel brachten und meine innere Stimme, die deutlich sagte: Du tust das Richtige!
Das Flugzeug landete wenige Minuten später zur Freude meines Sitznachbarn auf der Rollbahn.
Bereits an der Schwelle der Flugzeugtür riss der heftige Wind mir beinahe die braune Lederjacke vom Leib, dafür empfing mich eine strahlend helle, warme Sonne und eine Flut von Nachrichten auf dem eben eingeschalteten Handy.
„Vodafone heißt sie Herzlich Willkommen und möchte Sie daran erinnern, dass es eine beschissene Stadt ist, in die man immer wieder zurückkehrt“ Absender: Papá .
Rückblickend waren dies vielleicht die ersten Warnsignale, die ich gekonnt ignorierte, geblendet von einer romantischen Vorstellung von dieser Stadt, ausgedörrt und hungernd nach menschlicher Wärme wie ich war und überwältig von dem Bedürfnis an einen Ort zurückzukehren, der mir die Illusion der Zugehörigkeit gab. In diesem Moment hatte ich allerdings an einer Sache keinerlei Zweifel: Ich opferte eine hoch zivilisierte Gesellschaft für authentische, zwischenmenschliche Beziehungen.
Nach der endlosen Warterei am Gepäckband schob ich den schweren Wagen mit dem Kofferberg Richtung Ausgang zum großen Parkplatz, wo Papá mich bereits erwartete. Gerade wollte ich die Straße zwischen Ausgang und Parkplatz überqueren, als ich beinahe von einer rasenden Karawane sogenannter „blauer Autos“ überfahren wurde. Drei A-Klasse Mercedes mit verdunkelten Fensterscheiben und lauten Sirenen schossen ungeachtet des Zebrastreifens, den ich überqueren wollte, an mir vorbei, um laut quietschend vor der Einfahrt des Flughafens zu bremsen. Mit derselben Geschwindigkeit wie sie angerast kamen, sprangen vier Anzugträger aus dem mittleren Auto und öffneten die Hintertür des Mercedes. Ein ebenfalls in Anzug und Krawatte gekleideter Mann mit verspiegelter Sonnenbrille stieg aus und wurde von den anderen in das Flughafengebäude begleitet. Wer bitte war das?
„Der Regionalpräsident“, sagte ein Taxifahrer neben mir als Antwort auf mein verwundertes Gesicht.
„Aha.“
„Immer ein enormer Aufwand, wenn er unterwegs ist. Reist um die Welt mit unseren Steuergeldern“, kommentierte der Taxifahrer trocken, während er sich eine Zigarette anzündete.
„Verstehe“, sagte ich, ohne ihm viel Beachtung zu schenken.
„Da ruft Sie jemand“, fügte er hinzu und deutete lächelnd mit dem Kinn in Richtung Parkplatz. „Sie brauchen dann wohl kein Taxi.“
Ich war so überwältigt von der Szene gewesen, dass ich am Zebrastreifen verharrt war, ohne den kleinen weißen Seat von meinem Papá wahrzunehmen. Der aber stand im Halteverbot und so rannte ich ihm entgegen, verstaute schnell die Koffer überall wo Platz war, ohne Zeit für Umarmungen, denn die könnten uns teuer zu stehen bekommen, wie die Politesse mit ihrem mahnenden Blick andeutete.
Während der Fahrt redeten wir kaum. Mein Vater war ein Mann weniger Worte, zudem billigte er meine Rückkehr nicht. Um Diskussionen zu vermeiden, schwiegen wir. Ich genoss die Fahrt auf der Autobahn. Die milde Luft, die aus dem geöffneten Fenster hineinströmte umschmeichelte meine erkaltete Seele. Ich sah über die in den blauen Himmel ragenden Müllberge hinweg zu den kleinen Fischerbooten am Meereshorizont, die in der sengenden Sonne vor sich hintrieben. So fuhren wir schweigend über die unebene Küstenstraße bis zur Stadt. Nur mein Telefon unterbrach die Stille.
„Willkommen zurück.“ Die fröhlich klare Stimme meiner Cousine Stella war die schönste Begrüßung. „Kommt doch heute Abend zu uns zum Essen. Meine Mutter hat bereits ein Festmahl vorbereitet.“ Ich willigte mit Zustimmung von Papá ein.
Den von der Autobahn kommenden Besuchern zeigte die Stadt seine abscheulichste Seite. Große karge Betonbauten wandten den Anreisenden ihr abschreckendes Äußeres zu, als wollten sie sagen: „Nein, komm nicht hierher, geh weg, wir wollen dich nicht.“ Wagte man sich dennoch in die Innenstadt, blieb man verzaubert von seinen Palmenalleen, den Brunnen, dem malerischen Hafen und den antiken Gebäuden. Schade um die Bewohner, sagte so manch böse Zunge, die sind borniert und arglistig. Nur Neider, fand ich.
Im ratternden Seat überquerten wir die lange Viale Federico II mit den Prachtbauten, dann die heruntergekommenen Altstadt, bis sich dahinter bröckelige Hochhäuser auftaten, fast am Stadtrand, nicht weit weg von der Autobahn, die in den Süden führte. Dort war mein altes, neues Zuhause, nur wenige Schritte vom Markt entfernt. In einem sechsstöckigen Palazzo, eigentlich waren es fünf Stockwerke, der sechste Stock wurde nur halb fertig, wegen der fehlenden Baugenehmigung. So kam ich aus einem hochmodernen Appartement mit Ikea-Einrichtung in Kopenhagen zurück an diesen schmucklosen italienischen Stadtrand.