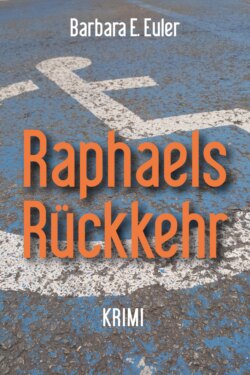Читать книгу Raphaels Rückkehr - Barbara E. Euler - Страница 3
Kapitel 1
ОглавлениеRAPHAELS RÜCKKEHR
Barbara E. Euler
For Wolf, always
Drei Jahre war er jetzt fort gewesen und der Kaffeeautomat war immer noch defekt.
Früher hatte er dagegengetreten.
Jetzt legte er den Kopf zurück und beobachtete, wie Anna auf den Rückgabeknopf einschlug, der sich in unerreichbaren Höhen befand, direkt neben dem Schlitz, der seinen Euro verschluckt hatte, auch er unerreichbar hoch.
„Lass gut sein“, sagte er gegen ihren Bauchnabel. Oder die Stelle, wo er ihren Bauchnabel vermutete. Er wendete seinen Rollstuhl und fuhr hinter Anna her ins Büro zurück. Dieses gläserne Büro, in dem er schutzlos war.
Drei Jahre. Das erste Jahr war ein wattiges Kontinuum aus Schwindel und Erbrechen und Schmerz gewesen, an das er wenig Erinnerung hatte.
Einige Male hatten ihn Kollegen besucht. Er wusste das nicht und das war gut so. Er hätte nicht gewollt, dass sie ihn so sahen.
Das zweite Jahr hatte er mit dem Versuch verbracht, die wattige Welt festzuhalten, in der es keine Erinnerung gab und kein Begreifen. Und damit, zu lernen, wie man weiterlebt, wenn das nicht mehr gelingt. Da besuchte ihn schon lang keiner mehr. Er war mit niemandem sehr vertraut gewesen.
Im dritten Jahr hatten sie ihn rausgeschubst ins Leben, genauer gesagt in eine betreute Wohnung. Die Betreuerin hieß Grit. Sie versorgte auch andere Patienten, aber er war der einzige mit Kategorie 4 und sie wohnte bei ihm. Vor drei Wochen hatte er sie rausgeschmissen. Sie konnte ihm nichts mehr bieten. In Wirklichkeit glaubte er, ihr nichts bieten zu können. Aber um sich das einzugestehen, würde er ein weiteres Jahr brauchen. Oder mehr.
„Grit … Anna …“, er räusperte sich. Die Inspektorin drehte sich zu ihm herum, die Brauen erhoben. Was musste sie jetzt verdammt nochmal so schauen. Raphael kniff die Augen zusammen. „Warum verdammt …“, sagte er und unterbrach sich. „Nichts“, murmelte er. Er sah Gespenster. Er war zu lange fort gewesen. „Die Akte über den Brand, haben wir die noch?“, fragte er, während er an seinen Schreibtisch zurückrollte. „Klar“, sagte sie, „die muss im Archiv sein …“, sie ging zur Tür zurück, „… warte!“ Er riss die Räder herum und verstellte ihr den Weg. „Es ist mein Fall“, sagte er hart und schoss den Gang hinunter, in kurzen, zornigen Schüben.
„Shit“, sagte Anna. „Ja. Shit“, wiederholte Piet, der Chef ihrer Abteilung war und auch mit im Zimmer saß. „Das geht jetzt schon eine Woche so …“, klagte die Polizistin, „Schick ihn heim.“ Sie wussten beide, dass das nicht ging. Raphael war in der Wiedereingliederungsphase. Für ein halbes Jahr. Man konnte ihm nicht kündigen. Man würde ihm nie mehr kündigen können. Er war schwerbehindert. Und jetzt hatte er auch noch einen eigenen Fall. Der Quotenkrüppel. Einmal war das Wort gefallen, als Raphael auf dem Klo war oder eine rauchen. Es war keiner aus ihrer Abteilung gewesen. Es war von ganz oben gekommen. Widersprochen hatte niemand. Natürlich nicht. Ihnen konnte man kündigen. Ihnen schon.
Im Lift starrte jemand auf die provozierende Leere unter Raphaels Rumpf. Raphael starrte zurück. Er konnte es nicht verbergen, verdammt. Man konnte nicht nichts verbergen.
„Die … Tattoos …“, hatte er gelallt, als der Arzt seinen Bericht beendet hatte. Die farbenprächtige Landschaft aus Totenköpfen und Schwertern und Rosen und mehr Totenköpfen, die von seinen Zehen bis fast in die Leiste wucherte, hatte ihn Tausend Euro und zwölf schmerzhafte Sitzungen gekostet und für ein paar selige Stunden war das das einzige gewesen, woran er denken konnte. Mitten in der Nacht hatte er dann zu schreien begonnen; die einzig angemessene Reaktion. Aber keine, die er beliebig wiederholen konnte. Leider. So war er in den Nebel zurückgeflohen, für sehr lange Zeit.
„Die Akte Brabantia, bitte“, sagte er jetzt und ignorierte den Schrecken, den sein Anrollen in den Augen der Archivarin entfacht hatte. Er war ein verdammtes Monster. Er hätte niemals herkommen sollen. Sicher nicht in den Keller. „Danke“, sagte er sanft, als die Frau zurückkam. Er steckte die vergilbte Akte in die Tasche hinter sich und wandte sich zum Ausgang.
„Es hat neulich schon mal jemand nach dieser Akte gefragt“, sagte die Frau auf einmal nachdenklich. Raphael drehte sich zu ihr herum. „Tatsächlich …?“, sagte er gedehnt. Er war immer gut darin gewesen, eine Befragung wie beiläufiges Geplauder aussehen zu lassen. Mal sehen, ob er es noch beherrschte. Er verzog sich hinter einen massiven Schreibtisch, in sicherem Abstand zu der Frau. „Das kommt nicht oft vor, was?“, fragte er und begann mit dem Stempelkarussell zu spielen, das vor ihm stand. Drei Minuten später hatte er den Namen. Aber erst als er eine Tasse Kaffee mit ihr getrunken hatte, ließ die Archivarin ihn wieder fort. Jetzt wusste er schon ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass sie guten Kaffee machten hier unten, heiß und stark. Nicht diese Plörre, die aus dem Automaten kam – wenn sie kam. „Bis bald“, sagte er und brachte die Akte in sein Büro.
Die meiste Zeit schmökerte Raphael in alten Geschichten und fiel niemandem lästig. Die Brabantia war von der Stadt als Asylbewerberheim eingerichtet worden. Ein ausrangierter Lastkahn, wie ihn jetzt so viele bewohnten. Shabby chic. Eines Tages hatte es einen Brand gegeben. Vermutlich gelegt. Damals hatte sowas noch für Aufsehen gesorgt. Raphael erinnerte sich genau an die Entrüstung und das Entsetzen. Dass der Fall niemals aufgeklärt worden war, erfuhr er erst jetzt. Denn ungefähr eine Woche nach dem Brand war die Sache mit dem Lkw passiert.
Zu fünft hatten sie versucht, den Lkw zu stoppen, aber Raphael war es gewesen, dem es schließlich gelang. Als sie ihn fanden, lag er unter seiner Harley. Die Harley lag unter dem umgekippten Zwanzigtonner. Selbst der Notarzt hielt Raphael für tot. Den Flüchtlingen in dem verschweißten Container war nicht viel passiert. Ein paar Knochenbrüche. Ein paar Platzwunden. Ein, zwei Stunden später, und sie wären alle erstickt. Als Raphael schließlich über den Unfall zu recherchieren begann, meldeten die Verlagsseiten die Zeitungsberichte unisono als veraltet und nicht mehr abrufbar. Sie hatten alles gelöscht. Da hatte er geweint, das erste Mal in der ganzen Zeit.
„Raphael?“ Anna stand vor ihm. „Alles okay?“
„Alles okay, Anna“, bestätigte er kühl.
Quotenkrüppel, hatte Dovenhof gesagt, als Raphael in der Besprechungspause vom Klo kam und ein bisschen zu leise und zu flott hereingerollt war. Dovenhof musste es ja wissen. Als Polizist war der Mann eine Niete. Aber er hatte mehr Dreck am Stecken, als an einen Stecken passte, hatte Fanny, die Kellerfrau, gesagt und ihm bei einem Tässchen Kaffee die ein oder andere Akte aus ihrem Giftschrank gezeigt. Dovenhof hatte sich nicht geändert, nicht in all den Jahren. Im Gegenteil. Wenn man ihn jetzt schasste, würde er eine Menge Leute mit in den Abgrund ziehen. Raphael grinste.
Ihn nicht.
Zu seiner Zeit war Dovenhof nur ein dreckiger kleiner Bulle gewesen, den er, wo er konnte, mied. Als Dovenhofs kometenhafter Aufstieg begann, hatte Raphael bereits ausgecheckt. Außerdem war er in der Wiedereingliederungsphase. Plötzlich fühlte er sich unverwundbar. Und das war eine durchaus denkwürdige Erfahrung.
An den Feierabenden war er allein. Normalerweise jedenfalls.
Bei Dovenhofs Lieblingsfranzosen war ein Hilfskoch unglücklich gestürzt. Tot. Ein Unfall. Reine Routine. Sie hatten die Sache Raphael gegeben, weil sie dem Amt Integrationsbemühungen vorweisen mussten und weil der Hilfskoch ein ehemaliger Flüchtling war. Aus dem Container. Der auf der Harley gelegen hatte. Die auf Raphael gelegen hatte. Die Aktenlage war dünn, aber nicht dünn genug. „Nein!“, hatte Raphael gesagt. Und dann: „Wo?“
Er war selten in der Altstadt unterwegs. Das verdammte Kopfsteinpflaster rüttelte ihm das Kreuz durch und er bekam Panikanfälle, wenn er zwischen die Horden Selfies schießender Touristen geriet. Neulich war ihm eine Japanerin in den Schoß gefallen. Schoß war ein großes Wort dafür. Zu groß. Sie hatte geschrien. Er hatte geschrien. Es hatte verdammt weh getan.
Aber auch als er noch ein 1,82-Mann in Cowboystiefeln gewesen war, hätte er niemals ein Lokal wie Le Coq d‘Or betreten. Zwei Sterne und fünfzehn Punkte im Gault&Millau. Nicht sein Ding. Nicht mal mit Anna. Der kühlen, schönen Anna, die an diesem Abend wie eine Klette an ihm klebte. „Keine Alleingänge“, hatte Piet gesagt. Natürlich. Ordentliche Polizisten traten immer als Duo auf, wie die Zeugen Jehovas. Aber normalerweise nahm Piet das nicht so genau. Raphael seufzte. Wenigstens hatte der Chef das Kleingedruckte nicht gelesen, das in den Unterlagen stand, mit denen das Amt ihn geliefert hatte. „Nur Innendienst“ hatte die Ärztin geschrieben. „Gefahr eines Kreislaufkollaps“. Er hatte sie angefleht, es wegzulassen, aber es war nun mal die Wahrheit. Das wusste er selbst am besten.
Früher war er ein Beschützer gewesen. Heute war er eine Gefahr.
Als er die rot beplüschte Schwelle am Eingang sah, war er zum ersten Mal froh, nicht alleine zu sein; oft genug musste er sich irgendwo von hinten über die blecherne Rampe eines Lieferanteneingangs reinkämpfen wie ein Guerillero. Barrierefrei war für Babys, aber er hasste die Blicke, wenn er unvermittelt aus einer Küche oder einem Lagerraum hereingeplatzt kam und nach einem freien Tisch fragte oder nach einem Oberhemd in L, wenn es ein Kleidergeschäft war. Oder, schlimmer, nach einer Hose. In L.
„Danke, Anna“, sagte er höflich, als sie ihm über die Schwelle half, und „Danke, Anna“, als sie ihn im dezenten Schummerlicht an den zugewiesenen Tisch schob, nachdem der Ober diskret den überflüssigen Stuhl beiseite geschafft hatte. Normalerweise benutzte Raphael einen Stuhl wie alle anderen auch, aber er sagte nichts. Anna sah ihn erstaunt an.
Raphael lächelte zurück. Er war behindert. Bedürftig. Blöd. Darum hatte er den Fall. Es war Schadensbegrenzung, die sie damit betrieben. Glaubten sie. Raphael öffnete die schwere, ledergepolsterte Speisekarte. Wer war er, ihnen ihren Glauben zu nehmen?
„Stehen in Deiner Karte auch keine Preise?“, zischte er der kühlen Kollegin zwischen den Zähnen zu. Sie deutete ein Kopfschütteln an. Raphael biss sich auf die Lippen.
Jemand wollte sie kaufen.
Die Polizisten tauschten einen raschen Blick. Sie hatten das früher oft gemacht, wenn nicht die Zeit oder Gelegenheit zum Reden war. „Okay“, flüsterten sie wie aus einem Mund. Sie würden mitspielen. Einen Augenblick überlegte Raphael, ob Anna eingeweiht war, aber dafür kannte er sie zu gut.
Vor dem Dessert erkundigte Raphael sich beim Ober nach einer Behindertentoilette, aber sie hatten keine, natürlich nicht. Die rot beplüschte Schwelle am Eingang sprach eine deutliche Sprache. Krüppel verkehrten nicht in solchen Lokalen. „Haben Sie vielleicht eine Urinflasche?“, fragte er laut. Alles hatte seinen Preis. Auch er.
Als sie durch die bestürzte Stille nach draußen gelangt waren, zündete Raphael sich eine Zigarette an. Ein Auto fuhr vorbei. Ein Haubentaucher piepste verschlafen. „Musst du jetzt oder nicht?“, fragte Anna. Es sollte amüsiert klingen. Raphael kramte in seiner Tasche, winkte mit seiner Flasche und rollte der Form halber ein paar Meter weiter, die Zigarette im Mundwinkel. „Nicht in die Gracht …“, sagte Anna nervös und sah in die andere Richtung. Das war alles ein bisschen viel.
Die Flasche war weg, als er zurückkam. Sie fragte nicht, was er damit gemacht hatte, ob er den Inhalt gegen die Restaurantmauer gekippt hatte oder in den Kanal, oder ob die Flasche noch voll war und ob man etwas riechen würde. Sie musste das nicht fragen. Er las alles in ihren Augen, jede Einzelheit. „Nicht in die Gracht“, wisperte er ihr verschwörerisch zu, als sie wieder am Tisch saßen.
Beim zweiten Dessert wurde es gemütlich. Entspannt durchstöberte Anna mit Löffelchen und Gäbelchen die putzige Landschaft aus Soufflés und Parfaits und Mousses und Beeren und Bavarois, die auf einer Schieferplatte von der Größe eines Aktenordners angerichtet war. Eines aufgeklappten Aktenordners. Raphael betrachtete sie über den Rand seiner Kaffeetasse. Plötzlich sah Anna ihn an. „Galena“, hauchte sie. Er war nicht so für Süßes, aber was er von dem Löffelchen leckte, das sie ihm hinhielt, schmeckte genau wie die Puddingpulvermarke, die er schon als Kind gekannt hatte.
Also doch. Jetzt bedauerte er, nicht durch die Küche gekommen zu sein.
„Gourmetfix“, ergänzte er leise. Grit hatte ihm auch das Kochen beigebracht – alles, was sie darüber wusste. Anna biss sich auf die Lippen. Die Béarnaise beim Hauptgang. „Und Topfi“, sagte sie leise. Das Püree. Sie hätte sich fast verschluckt, als Raphael nickte. Jemand schenkte Schokosauce nach. Und dann kam Le chef höchstpersönlich an ihren Tisch und zog den überflüssigen Stuhl wieder heran und setzte sich.
„Calvados?“, fragte Flor Bertrand spöttisch. Sie waren im Dienst, das wusste er genau. „Nein“, sagte Anna pflichtgetreu. „Ja“, sagte Raphael gleichzeitig. Anna starrte ihn an. Er sprach ungern darüber, aber er durfte gar nichts trinken, bei all den Medikamenten, die er nahm. „Du musst noch fahren“, sagte sie schnell. Raphael lächelte kalt. „Du fährst“, sagte er ruhig. Wenn er schon mitspielte, dann richtig. „Die Beine kannst du dran lassen“, schob er nach. Das war für Bertrand. Sie waren mit Annas Auto gekommen.
Anna warf Raphael einen bösen Blick zu. Seine Schützengrabenwitze konnte er woanders machen. „Mir auch einen“, sagte sie entschlossen, „Wir nehmen ein Taxi.“
Alkohol. Noch vor dem dritten Schnäpschen war klar, dass Bertrands Probleme mehr als ein Gerücht waren. „Allez buvez!“, rief er ihnen munter zu, als säßen sie auf der anderen Seite des Kanals. Dann beruhigte er sich schlagartig. Zutraulich beugte er sich zu der Beamtin herüber. „Es ist sooo furschtbar …“, hauchte er.
Eilig nahm Anna die Hand wieder herunter, die instinktiv vor ihre Nase gefahren war. So schlimm?, sagten ihre aufgerissenen Augen. Ja, verdammt, antwortete Raphael ihr mit den seinen. Anna fasste sich. „Was ist passiert?“, fragte sie nüchtern.
„Isch-öre eine laute … wie sagt man … Krach. Dann plötzlisch alles ist still …“, flüsterte der Wallone atemlos. „Isch gehe nachsehe …“
„Sie haben den Unfall nicht beobachtet?“, vergewisserte Anna sich. Raphael hustete. Früher hatte er sie unter dem Tisch getreten. Sie würde nie kapieren, warum man so etwas Verhör nannte.
Anna nickte entschuldigend und ließ den Mann reden.
„Gesehen? … oh, non, non, mon Dieu … Isch wäre in Ohnmacht gefallen … Diejarme Mann …“, er machte eine Pause, um die Kehle zu befeuchten. Anna prostete ihm aufmunternd zu.
„Er da liegt und bewegt nischt“, berichtete Bertrand beflissen. „Isch sage allo? allo? und er sprischt nischt. Isch ihn anfasse und er ganz kalt …“
„Kalt?“, sagte Raphael streng. Alles hatte seine Grenzen.
„Isch meine er ganz-eiß … warm … Wie sagt man … lau …“, er hob die Schultern. „Diejarme Mann …“, wiederholte er matt und verfiel in Schweigen. Anna lächelte, eisig jetzt. Der verarscht uns, sagte ihr Blick. Raphael grinste zurück. Das können wir besser.
„Galena“, sagte er schlicht.
Annas Fuß rumste gegen seinen Rollstuhl. Idiot, funkelten ihre Augen. So kühl war sie gar nicht. Raphael grinste und hob sein Glas. Sorry ...
Anna nickte zufrieden und stippte ihr Löffelchen in die Reste des Desserts. „Das schmeckt genau wie früher … als ich ein kleines Mädchen war …“, schwärmte sie und leckte Pudding aus dem Mundwinkel. „Auch die Béarnaise … und das Püree … wie bei meiner Mutter …“ Raphael seufzte. Er wünschte, er könnte nur einmal derart höflich sein. Bertrand lächelte breit. „Sie sind eine Kennerin, Madame!“ Annas Löffelchen tauchte wieder in den Pudding. „Merci … merci, monsieur“, maunzte sie hingebungsvoll. Sie war jetzt richtig in Fahrt. Und ganz ohne Treten. „Es-at noch nie jemand so schön gesagt“, seufzte der Koch. „Viele Gäste verstehe nischt meine concept …“, er nahm noch einen Schluck. „Sie glauben wirklisch, isch verwende diese … wie sagt man …“, er senkte die Stimme, „Convenience“, tuschelte er, als handle es sich um ein Produkt aus dem Sexshop. Anna nickte verständnisvoll.
„Man merkt wirklich keinen Unterschied“, bemerkte Raphael trocken. Sein Glas war schon wieder leer. Und rumms!, bekam er die Quittung. Bloß weil er sich nicht wehren konnte. Er sollte jetzt wütend sein. Aber eigentlich fand er alles ziemlich lustig.
Bertrand war mit Nachschenken beschäftigt. In seinem Zustand eine Aufgabe, die ihn vollkommen beanspruchte. „Sehr schwer …“, sagte er erschöpft und ließ die Flasche auf den Tisch sinken, „… es war sehr schwer, diese Geschmack zu … äh … entwickeln …“ Raphael presste die Lippen an das Glas, um nicht laut loszuprusten. „Bestimmt, monsieur“, bestätigte Anna ernst. Raphael gab es auf. Er rollte Richtung Küche, während er vergebens versuchte, seinen Lachanfall mit einer Serviette zu ersticken. „Der Calvados …“, murmelte Anna hinter ihm her. Es klang ehrlich besorgt.
Bertrand schien sein Abgang nicht zu stören. Während Raphael suchend zwischen Herdblock und Regalen herumkurvte, hörte er den Wallonen weiterwinseln. „Es ist eine neue Linie. Eine Re-vo-lu-tion … Ehrlisch … Aber die Gäste … sie sind sooo dumm. Mon Dieu … Sie-aben misch verlassen … sie sind mir untreu …“, jetzt weinte er beinahe. In der Tat war das Lokal den ganzen Abend verdammt leer gewesen. Gourmetfix und Topfi waren nicht jedermanns Sache.
„Monsieur … monsieur …“, Anna klang, als säße sie schon auf seinem Schoß. Besser, er sah mal nach ihr. Er rollte zum Kücheneingang zurück. Fertigpackungen hatte er keine entdecken können. Natürlich nicht.
Und keine Menschenseele.
„Es ist nach Mitternacht. Isch bin keine Unmensch!“, rief Le chef entrüstet, als Raphael ihn darauf ansprach. Anna nickte artig. Wider Erwarten hatte sie kein bisschen derangiert gewirkt. Die Polizisten blickten einander an. Genug für heute. Sie hatten Bertrand ganz schön durcheinandergebracht.
„Dovenhof ist auch keine Unmensch“, sagte der Koch plötzlich in die Stille hinein.
Raphael verharrte in der Küchentür und hielt den Atem an.
Bertrand musterte ihn durchdringend. „Sie glauben, er ist auf die falsche Seite …“ Raphael atmete langsam aus. Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. „Wenn etwas nischt funktioniert mit die Asylante, es nischt ist seine Schuld“, sagte der Koch konzentriert. Auf einmal wirkte er ziemlich nüchtern. „Sie nischt müsse glaube, wenn jemand sagt anders. Dovenhof … er tut für die Leute, was er kann. Er ist eine gute Poliziste. Er schützt sie …“
Raphael dachte an den Hilfskoch, das schmale, graue Gesicht, den mageren Körper unter dem fahlen Tuch. Die klaffende Wunde am Hinterkopf. Den Toten in der Leichenhalle des St.-Jans-Krankenhauses zu besuchen, war das erste, was Raphael getan hatte, als man ihm den Fall übertrug. „Wo?“, blaffte er und machte die Bremsen los, „Wo ist es passiert?“ Anna schwieg.
Bertrands Hände zitterten, als er in der Küche auf irgendeine Metallkante wies. Raphael fuhr mit den Fingern über die Stelle. Besah den Boden. Es konnte hier passiert sein. Oder auch nicht. Die Sache war kaum dokumentiert. Sie hatten alle Hände voll zu tun gehabt, den Mann ins Krankenhaus zu schaffen. Als der Notarzt gekommen war, hatte der Afrikaner noch gelebt. „Danke“, sagte Raphael mühsam beherrscht und rollte an den Tisch zurück.
Jetzt hatte Bertrand ihn ganz schön durcheinandergebracht.
„Sie haben uns sehr geholfen!“ Annas Stimme klang angestrengt. „Die Rechnung, bitte“, sagte Raphael, nur der Form halber. Mit Bestechung wollten sie nichts zu tun haben.
Es verschlug ihm die Sprache, als die Rechnung tatsächlich kam. Le chef wollte auch nichts mit Bestechung zu tun haben. Raphael starrte auf das Büttenpapier. Sicher nicht bei diesen Summen. Eins zu null für dich, Bertrand Bastard, dachte er und zog seine EC-Karte raus. Verdammt, er würde wieder überziehen. Er machte sein Gesicht locker und lächelte.
Flor Bertrand war das jüngste von sieben Kindern eines wallonischen Bergmannes. Alles Söhne. Mit dem Zeitpunkt seiner Geburt hatte seine Mutter, die einen Gemischtwarenladen betrieb, die Hoffnung auf eine Tochter endgültig begraben. Fortan arbeitete sie härter und reduzierte das Interesse an Mann und Kindern weiter, soweit das überhaupt noch möglich war. Flor aber war zutraulich oder gab sich so, und ging der Mutter gerne zur Hand. Bald bot er kleine selbstgemachte Speisen an, die den Laden zum Hit machten. Suppe, Bratkartoffeln, sowas. Sonntags lungerte er herum wie er’s seinen Vater tun sah. Manchmal schlug er zu wie der Vater es tat. Meistens war er nett. Er machte sich viele Freunde, vor allem, wenn er gratis Schnaps und Schinkenbaguette über den Tresen reichte. Die Mutter verließ sich auf ihn. Es war der einfachste Weg. Irgendwann hatte er das erste eigene Lokal. Irgendwann kam der erste Stern. Seit einem Jahr war Flor Bertrand jetzt in Brügge. Der Bergmannssohn spielte seine Rolle zwischen den Reichen und Schönen gut. Bei ihm gesehen zu werden, war der Ausweis, dass man es geschafft hatte. Das Essen war Nebensache. Hauptsache, es kostete mehr als die normale Börse hergab. Dann war es gut. Flor Bertrand hatte das lange Zeit nicht glauben mögen. Als die Erkenntnis zu kommen drohte, brachte er nicht den Mumm auf, wegzugehen und anderswo neu anzufangen. Er hatte so hart dafür gearbeitet. Er blieb, wo Ruhm und Ehre und Geld waren, und tröstete sich, wie er’s den Vater hatte tun sehen. Mit Alkohol. Das war der Anfang vom Ende.
Das alles ahnte Raphael mehr als dass er es wusste, aus dem, was er gehört und gelesen hatte und aus dem, was er jetzt sah. Niemand wusste es wirklich. Niemand wollte es so genau wissen.
Raphael schon.
Er kannte das Gefühl, wenn man nirgendwo hingehört und etwas will und kann nicht. Flor war ihm sympathisch, auf eine Art, die weh tat.
„Du kannst ganz schön was ab“, sagte Anna, als sie draußen auf ihr Taxi warteten. „Was? Nein“, er lachte. Anna sah, wie er die Plastikflasche rauszog, die er irgendwo in den Weiten seiner riesigen Bikerjacke verborgen gehalten hatte. „Halt mal“, sagte er. Anna nahm die Flasche mit spitzen Fingern und beobachtete, wie Raphael ans Geländer vorrollte. Alkoholgeruch drang an ihre Nase. Calvados. Darum hatte er vorhin draußen mit der Flasche hantiert. Und sie hatte nichts bemerkt. „Cooler Trick“, gluckste sie.
Raphael nahm ihr die Flasche wieder ab. „Hättest du auch machen sollen“, sagte er, als sie unkontrolliert zu kichern begann. „Sechzig Euro …“, betrübt kippte er seinen Apfelbrand in die Reie. Zwölf Euro das Glas. Bei Bertrand Bastard gab es nichts aufs Haus.
Anna bekam einen Schluckauf. „Warum hast du mir nichts gesagt?“, fragte sie zwischen zwei Hicksen. „Man hat uns beobachtet“, informierte sie der Kollege. Anna runzelte die Stirn. „Und jetzt nicht, wie?“ Raphael fuhr sich über das Gesicht. „Nein.“
Er starrte in das dunkle Wasser, während Annas Schluckauf langsam verebbte. Die Sache mit der Flasche war ihm verdammt spät eingefallen. Früher hatte er so etwas besser vorbereitet. Früher war er nicht so nervös gewesen. Früher hatte er ein anderes Auftreten gehabt.
Das Taxi kam. „Du siehst Gespenster“, sagte Anna sanft und half Raphael mit dem Rollstuhl.