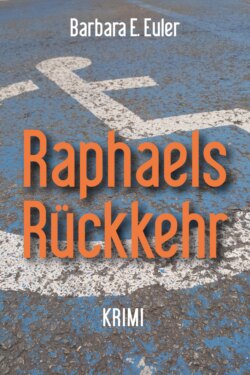Читать книгу Raphaels Rückkehr - Barbara E. Euler - Страница 6
Kapitel 4
ОглавлениеDas Wasser des Ringkanals glitzerte in der hoch stehenden Sommersonne. Am anderen Ufer rauschten die Autos vorbei. Plaudernde Schüler auf kunstblumengeschmückten Nostalgierädern überholten Raphael, als er langsam an den ehemaligen Ladekais entlangrollte. Raphael sog den warmen, brackigen Geruch des Wassers ein. Wie oft hatte er als Junge hier gestanden, an den langen Augustnachmittagen, wenn keine Schule war und auch sonst nichts zu tun, und hatte zugesehen, wie Sand in die schwarzen Tiefen der Transportkähne rauschte, unendlich viel Sand. Wie die tief liegenden Schiffe endlich loszogen, behäbig und stolz, Richtung Ostende. Er war ein paarmal in Ostende gewesen damals, bei Tante Miriam. Schokoladen-Babka mit Streuseln. Verdammt lang her.
Eine Glocke schellte schrill, als die Krakelebrücke sich öffnete. Eine Traube von Radfahrern bildete sich vor der Schranke. Dahinter die Autos. Träge näherte sich ein Lastkahn, fuhr an der gedrehten Brücke vorbei Richtung Schleuse. Von hier aus konnte man die Schleuse nicht sehen. Schon klingelte die nächste Brücke. Die Warandebrücke. Behäbig würde sie sich auf ihrem Pfosten drehen wie eine stumpfe, breite Kompassnadel, die keine Eile hat, den Norden zu finden. Auch die Dampoortbrücke, direkt bei der Schleuse, würde bald klingeln. Würde hochklappen, himmelhoch. Anthrazit gegen Meerblau. Dann würden sich die Schleusentore schließen, langsam, wie unter Anstrengung, gegen die ungeheuren Wassermassen des Kanals. Die Wasser würden hereinströmen und das Schiff heben, bis sich endlich das Schleusentor zur anderen Seite und die Brücke öffnen und das Schiff freigeben würden. Und endlich würden die Brücken sich schließen, die Schranken sich öffnen und die Fahrradfahrer würden losbrechen wie ein Bienenschwarm, und dann würden auch die Autos ihren Weg fortsetzen. Raphael lächelte. Der Rhythmus der Stadt. Ihr Atem.
Wie oft hatte er als kleiner Junge an der Schleuse gestanden und geschaut. Die stolzen Schifferfrauen, die die endlos langen Kähne spielerisch durch die schmalen Tore lenkten. Ihre ruppigen Männer, die schwere Taue warfen und mit dem Schleusenwärter scherzten. Ein Auto, festgezurrt oben an Deck. Wäsche und Wimpel im Wind. Ein kleiner Hund. Und Kinder. Manchmal hatte er sie an Deck spielen sehen, eingewoben in eine sichere Welt aus hohen Netzen. Manchmal hatte er ihnen zugewinkt. Manchmal hätte er mitfahren wollen.
Die Krakelebrücke schloss sich wieder, grell läutend. Radfahrer quollen über den Asphalt; Autos folgten ihnen und brachten den Brückenstahl zum Poltern. Raphael holte tief Atem. Jetzt war alles anders. War das Warten lästig. Auch ihm.
Er besah das Boot, vor dem er stehen geblieben war. In der Ferne läutete die Dampoortbrücke. Der Name ‚Brabantia‘ war ein bisschen verwaschen. Leute schauten von der Terrasse über dem ehemaligen Laderaum auf ihn herab. Gesichter aller Formen und Farben.
Nussbaum, Kirsche, Ebenholz, dachte er. Er hatte mal Schreiner gelernt; wo er herkam, waren Polizisten verpönt. Zwei Typen bauten sich am Eingang auf. Raphael hielt seinen Ausweis hoch und begehrte Einlass. Er las ihre Blicke, als einen Moment lang die Maske fiel: Ärger. Dann Empörung – für sie war wohl ein halber Bulle gerade gut genug. Angst auch. Kein Mitleid, immerhin. Dann schlossen sie wieder ihre Visiere. Er konnte förmlich das feindselige Klicken hören. Trotzdem musste er da hinein. Das war sein Job. Wenn er sich jetzt zierte, würden sie ihm nie vertrauen.
Er musste nur noch an Bord kommen.
Raphael kniff die Augen zusammen und besah die schmale Gangway. Mit Schwung und auf zwei Rädern könnte es gehen. Aber dann dachte er an die Puppenstubenarchitektur, die ihn auf dem Boot erwarten würde, und verwarf es wieder. Er konnte auch auf den Händen gehen, ziemlich gut sogar. Aber das hier war keine Freakshow.
Ergeben hob Raphael die Arme.
Er sah, wie die Typen auf den Teppich aus Tattoos starrten, der sich auf seinen Muskeln blähte. Als er das erste hatte stechen lassen, hatte sein Großvater ihn geschlagen. Niemals wieder, hatte der alte Mann geschrien und ihm das seine hingehalten, blasse Ziffern auf runzliger Haut. Es hatte wie eine Telefonnummer ausgesehen. Wenig später war er gestorben.
Raphael legte seine Arme um die zwei starken, dunklen Nacken, die sich zu ihm beugten, und ließ sich hochnehmen. Er wog immer noch weit über einen Zentner, aber sie balancierten ihn mühelos über die Planke.
Sie setzten ihn auf bunte Kissen, zu anderen, die ihn stumm beäugten. Er versuchte gleichgültig dreinzuschauen, während sein Herz wie eine Bassdrum schlug. Jetzt war er wirklich ein halber Mann. Aktionsradius Null. Oder so gut wie. Vorsichtig zog er die Hand zurück, die instinktiv an die Hüfte gefahren war. Er trug keine Waffe mehr. Er war ja kein Selbstmörder. Als er ein paarmal tief durchgeatmet hatte, bekam er die Gewalt über sich zurück.
Er scannte die dunklen Gesichter.
Es stimmte nicht, dass sie alle gleich aussahen. Nicht, wenn man verdammte zwei Jahre lang Gemüse unter hegenden Händen gewesen war, zu denen meist Gesichter wie diese gehört hatten.
Er zwang sich, zu lächeln.
Er machte Smalltalk. Die afrikanische Art. Er wusste noch, wie das ging. Mein Name ist Raphael. Und deiner? Wie geht es dir? Danke. Gut. Ja, meiner Frau auch. Nur gute Nachrichten, Bruder. Und deine Familie? Alles gut? Er sprach langsam. Englisch. Französisch. Kramte nach den Brocken Kisuaheli, die er damals gekonnt hatte. Sijambo. Es geht mir gut.
Raphael unterdrückte ein Seufzen. Damals. Es war alles noch wie damals. Als es angefangen hatte mit den Flüchtlingen. Dieselbe Fremdheit. Nicht zu wissen, ob sie etwas verstanden hatten. Etwas verstehen wollten. Er fuhr fort, zu lächeln.
Ein Tablett erschien vor seiner Nase „Do you want some tea?“ Er hasste Tee. „Sure. Thanks a lot.“ Die Leute waren schwer einzuschätzen. Und sie kamen und gingen. Er wusste nicht mal, wie viele sie waren. Sie ließen ihn keinen Überblick gewinnen. Er unternahm nichts dagegen. Wie auch?
Raphael trank von dem Tee, der seltsam schmeckte, und lächelte weiter. Er war ein sicherer Schwimmer, aber er wollte es nicht beweisen müssen.
Vielleicht hatte er einen Fehler gemacht. Er dachte an den Rollstuhl, den jemand mit einem Fahrradschloss ans Geländer gekettet hatte. Jemand, der den Schlüssel eingesteckt hatte. Er hätte den Kollegen Bescheid sagen sollen. Aber vielleicht hatten sie inzwischen das Kleingedruckte entdeckt. Jetzt war es sowieso zu spät, darüber nachzudenken. Raphael rückte sich zurecht. Er musste jetzt mal auf den Punkt kommen.
„Wer von euch kennt Flor? Flor Bertrand?“ Niemand reagierte. „Den Koch. Vom ‚Le Coq d’Or‘?“, Raphael sah in die dunklen, stummen Gesichter, eins ums andere. „Bei dem so viele Afrikaner arbeiten.“ Sie murmelten. Raphael hob die Stimme. „Und bei dem es einen Toten gegeben hat, in seiner Küche. Mitten in der … in der Nacht … “
Er unterbrach sich. Der verdammte Tee.
Der Zwanzigtonner war damals auch auf seine Blase gefallen. Ein Stück davon hatten sie retten können. Die Hälfte ungefähr. Normalerweise kam er damit klar. Aber jetzt war er nervös. Deswegen hatte er auch nicht an die Flasche gedacht, die am anderen Ende einer viel zu langen Erklärung in seiner Rollstuhltasche am Ufer steckte. „I must pee“, sagte er und versuchte ruppig zu klingen, was gründlich misslang. Sie rührten sich nicht. „It is damn urgent“, schob er nach und fummelte den ersten Knopf auf. Jetzt war es ihm egal, wie er klang. Plötzlich hielt er eine ziemlich leere Tomatendose in der Hand, die aussah, als hätte jemand sie mit den Zähnen geöffnet. Ein Dutzend Augenpaare stierte ihm zwischen die Beine. Beschnitten war er auch noch. Er konzentrierte sich darauf, sich nicht zu entmannen, während er in die rote Sauce pinkelte.
Fertig. Stoisch knöpfte er seine Jeans wieder zu. Er hatte Schlimmeres erlebt. Furcht und Scham waren seine Sache nicht, nicht mehr, und wer ihn deshalb dämlich oder unverschämt fand, sollte es tun. „Thanks“, er lächelte und gab die Dose vorsichtig zurück. Aus dem Augenwinkel sah er, wie jemand den Inhalt mit spitzen Fingern über Bord wippte. Es war nicht, dass er sich niemals ängstigte oder genierte. Im Gegenteil. Furcht und Scham begleiteten ihn seit seinem Unfall wie Piraten eine Luxusjacht. Er hatte nur gelernt, stärker zu sein. Ihnen ins Gesicht zu lachen. Weiterzumachen.
Grit hatte ihn das gelehrt.
Haddock.
Er betrachtete seine Gastgeber, die ein bisschen verwirrt aussahen. „The truck that took my legs took half my bladder, too“, erklärte er knapp. Es hörte sich wie ein verdammter Songtext an. The Cripple’s Song. Lyrics: Raphael Rozenblad. Sie nickten.
„Tell me about Flor“, bat er und lehnte sich in die Kissen zurück.
„Wait. Which truck?“ Ein Mann trat vor, den er bisher nicht bemerkt hatte. Bingo. „Ein Zwanzigtonner … mit einem zugeschweißten Container drauf“, sagte Raphael vorsichtig, jetzt auf Französisch. Das dunkle, magere Gesicht begann zu leuchten. „So vor drei Jahren“, ergänzte er. Der Mann nickte. Raphael musterte die hohen Wangenknochen. Die auffälligen Stammesnarben. Auf dem alten Polizeifoto waren sie unter einem zerzausten Bart versteckt gewesen. Eine weitere Narbe, auf der Stirn, da, wo auf dem Foto der Verband gewesen war.
Partnerlook, dachte Raphael bitter. Sie hatten drei Klammern für seine Platzwunde gebraucht. Wenigstens sah es verwegen aus. Er hatte Fannys Pflaster nicht benutzt.
Der Mann fuhr sich über die zu tief liegenden Augen. „Danke … danke, Bruder …“, wisperte er, „Es tut mir leid … Es tut mir so leid …“ Raphael sah ihn an. Schon okay, sollte er jetzt wohl sagen, aber das wäre eine verdammte Lüge.
„Was ist …“, begann er. Dann traf ihn ein Blick. Furioser Funkenflug aus schwarzen Augen.
Panik.
Raphael sog die Luft ein. „Schon okay“, murmelte er. Er sah, wie der Mann sich entspannte, und lächelte in die Runde. „Wir waren gerade bei Flor. Bertrand. Ist ein komischer Typ, oder? Hat mich ganz schön abgezockt …“ Ein paar Leute begannen zu grinsen. Jetzt empfanden sie doch Mitleid. Vielleicht war es auch Schadenfreude. Jedenfalls empfanden sie was. „Und dann die Sache mit diesem Koch“, fuhr Raphael fort. „Sie haben mir den Fall gegeben. Reine Routine. Schafft sogar ne halbe Portion wie ich …“, er ließ Raum für die schüchternen Lacher, die jetzt kamen. „War aber keine Routine“, schloss er. Er sagte nichts von Mord. Er hörte zu, weil sie jetzt endlich zu reden begannen.
Er ist ein guter Mann.
Er zahlt gut.
Es ist gute Arbeit. Immer gute Arbeit.
Ein jeder kannte Flor. Der kleine Mann aus Wallonien hatte was, das sie berührte. Er wusste noch, wie es war, wenn man von ganz unten kam. Wenn man die Sprache nicht beherrschte. Die Sitten nicht verstand. Er war einer von ihnen, irgendwie.
„Ein guter Mann, hm …“ Raphael nickte. Jemand brachte Bier. Raphael schüttelte den Kopf. „Ich darf ... ich kann keinen ...“, er räusperte sich. Verdammt. Verdammt schade. Er setzte sein bestes Lächeln auf. „Für mich nicht. Danke.“
Jemand verteilte Blechteller. Dampfende Schüsseln. Brot. „Bitte!“ Eine Wasserschale mit einem lächelnden Mädchengesicht darüber, ein Handtuch. Raphael tauchte die Finger ein und rieb sie sorgsam sauber.
Amina.
Mit ihr hatte er auch hier gesessen, an einem anderen Tag, Bier in der Hand. Auf anderen Kissen, die jetzt verbrannt waren. Sie hatten geplaudert, als das Mädchen zwischen dunklen, schlanken Fingern ein mit Sauce gefülltes Reisbällchen formte, beiläufig und flink; hatten über den Brei gelacht, der aus Raphaels groben Händen gequollen kam, als er's ihr gleichzutun suchte. Die Pampe war auf seine Hose gefallen und er war aufgestanden und hatte die Hose notdürftig gesäubert und Amina hatte ihm geholfen.
„Danke“, sagte Raphael zu dem unbekannten Mädchen und gab das Handtuch zurück.
Der Geruch von Fleisch und Gewürzen mischte sich mit dem fauligen Dunst des Kanals. Raphael schob Aminas Bild weg. Selbst im Tod war sie noch hübsch gewesen. Er konzentrierte sich auf die Bewegungen seiner Finger und darauf, zuzuhören.
Flor musste ein Super-Chef sein, nach allem, was sie so sagten. Zahlte gut, hatte Verständnis für alles und jeden. Teilte sein Wissen. Wenn man ihnen Glauben schenkte, hatte er aus so manch einem beinahe einen Sternekoch gemacht. Auch aus Malouf. Besonders aus ihm. Raphael leckte Sauce von den Fingern. Gourmetfix brauchten sie hier jedenfalls nicht.
„Allah hat ihn geliebt“, sagte der schmale Junge mit den Narben.
„Wen?“ Raphael balancierte einen Reisball in den Mund, unfallfrei.
„Malouf. Er hatte so viel Glück ...“
Raphael schüttelte den Kopf. „Er ist tot, Youssouf.“
Die zu tief liegenden Augen starrten ihn an. „Du kennst meinen Namen?“ Raphael schluckte den letzten Rest Reis runter. „Ich bin Polizist“, erinnerte er behutsam. Bloß keine Psycho-Scheiße. Er war immer gerne der böse Cop gewesen.
Während sie aßen, beobachtete er Youssoufs Gesicht. In den Unterlagen hatte er Youssouf geheißen. Youssouf al-Halabi. Soweit er sehen konnte, war der Mann der einzige hier, der aus dem Container kam. Der einzige von denen, die damals registriert worden waren. Raphael hatte die Liste zwei Nächte lang memoriert. Warum wohnte der Mann noch immer in einer Flüchtlingsunterkunft? Und vor wem hatte er Angst? Vor den anderen? Vor ihm? Vor „der Polizei“? Vor Dovenhof? Vor Bertrand? Das Gesicht verriet nichts außer einem letzten Hauch mühsam niedergekämpfter Panik.
Wortlos beugte Raphael sich über seinen Teller. Schweigen war Gold.
Wäre Gold gewesen.
„Du hast ihn auch geliebt.“ Es war heraus, ehe Raphael etwas dagegen tun konnte. Verdammt. Er hustete. So hatte er das nicht gemeint. Jedenfalls nicht bewusst. Er drückte den Rücken durch. Früher wäre ihm das nicht passiert. Früher hatte er seinen Instinkt nicht auf der Zunge getragen. Sein Herz.
Er wartete. Alles, was geschah, hatte einen Sinn. Wenn er nicht mehr glauben konnte, dass alles, was geschah, einen Sinn hatte, dann ... Raphael kniff die Augen zusammen. Unauffällig rieb er seine Beine. Manchmal half es, ein bisschen wenigstens. „Er hatte eine Braut“, sagte Youssouf in diesem Moment.
Raphael entspannte sich. „Er hatte wirklich Glück.“ Youssouf nickte und lächelte sein trauriges Lächeln. Raphael berührte ihn vorsichtig am Arm. „Weiß sie, was passiert ist?“ Der Mann seufzte schwer und sagte nichts. Raphael sah ihn von der Seite an. Vielleicht war er zu weit gegangen. Weiß sie, was passiert ist ... Was sollte der Mann sagen? Dass er sie kannte und wusste, wo sie war und dass er ihn zu ihr führen würde, jetzt sofort? Dass er sie kannte und wusste, wo sie war, und dass er sie umgebracht hatte aus Eifersucht. Oder ihn. Malouf. Weil er sie geliebt hatte. Weil er ihn geliebt hatte. Raphael starrte in den Reis, der langsam kalt wurde. Nur dass er keine Ahnung hatte, das konnte der Mann nicht sagen. Das nahm ihm keiner ab. Abwesend tauchte Raphael die Finger in den Teller.
„Keine Ahnung“, sagte der Mann.
Raphael musterte ihn nachdenklich. „Sie hatte keine Ahnung“, präzisierte der Mann. Raphael ließ ein Reisbällchen fallen. „Keine Ahnung wovon?“, fragte er lauernd, während er sich Reis aus dem Schritt klaubte.
„Warte ...“ Youssouf streckte die Hand aus. „Finger weg“, sagte Raphael hart. Wenn man klein war, geschah einem sowas. Nur, wenn man klein war. Plötzlich fühlte er sich vollkommen erschöpft. Verdammt, was sollte das hier werden?
„Es war ein Traum. Träume sind Schäume“, sagte der Mann unvermittelt. „Ich weiß“, brach es aus Raphael heraus. Youssouf lächelte weise. „Malouf war ein Spinner“, informierte er, bereitwillig, wie zum Trost. „Er wollte Caroline heiraten. Flors Tochter ...“ Raphael verschluckte sich und spie ein paar Reiskörnchen über die Kissen. „Flor hat eine Tochter?“, war alles, was er sagen konnte. Youssouf lachte. Ein paar Leute sahen zu ihnen herüber. „Ich dachte, du bist Polizist ...“
Raphael ignorierte den Einwand. „Und Flor?“, fragte er scharf. Youssouf lachte noch immer. „Er wusste auch nichts davon. Malouf war feige. Wir haben ihn alle damit aufgezogen.“
„Wir?“
„Ich und die anderen, die bei Flor arbeiten. Eines Tages wollte ich es ihm selber sagen, aber Malouf hat gesagt, er bringt mich um“, jetzt lachte er nicht mehr.
Raphael zog Block und Kuli aus der Innentasche seiner Lederweste und kritzelte drauflos. Das war ja hier ganz großes Kino. „Er hat doch nur Spaß gemacht“, murmelte der Mann. Die anderen, die dichter gerückt waren, pflichteten ihm eilig bei.
„Eine Morddrohung ist kein Spaß“, knurrte Raphael, während er ungerührt weiterschrieb. Langsam wurden die Leute ihm richtig sympathisch. Er hatte eine Schwäche für ernst zu nehmende Gegner.
„Wer hat bei Flor gearbeitet in der Nacht zum dreiundzwanzigsten, als Malouf starb?“, donnerte er. Sie tauschten schnelle Blicke. Schließlich ging eine Hand hoch. Dann noch eine. Youssouf. Und dann noch zwei. „Wir haben nichts Ungewöhnliches bemerkt“, sagte einer von ihnen ein bisschen zu professionell. Vielleicht guckte er diese verdammten Fernsehkrimis. Die anderen nickten zustimmend. „Und zur Tatzeit, wer von euch war da noch im Restaurant?“
„Ich …“ Youssouf, der sich sofort wieder unterbrach und nach Luft schnappte. Vielleicht hatte ihn wer geboxt. Es gab verdammt wenig Überblick, wenn man so weit am Boden war. Raphael schrieb weiter. Was sollte er sonst tun. „… Ich weiß ja gar nicht, wann die Tatzeit war“, sagte Youssouf jetzt. Raphael nickte. Fernsehkrimis. Es waren wirklich ernst zu nehmende Gegner. „Zwischen dreiundzwanzig Uhr fünfundvierzig und null Uhr fünfzehn“, informierte er kühl. Der Notruf war um null Uhr achtzehn eingegangen. Wer ihn abgesetzt hatte, wusste man nicht, aber es musste direkt nach dem Ende der Attacke gewesen sein. Der Mann hatte noch eine Stunde gelebt, nach Auskunft der Pathologin die maximale Überlebenszeit in seiner Lage.
„So lange müssen wir niemals arbeiten. Flor ist kein Unmensch“, sagte der Typ von eben. Raphael seufzte und schrieb. Das hatte er schon mal irgendwo gehört. Sie waren ziemlich clever. Er sah auf. Vielleicht hatten sie einfach nur furchtbare Angst.
Mit jovialer Geste steckte er sein Schreibgerät wieder ein. „Genug für heute. Ich muss das ja alles noch abtippen“, sagte er und beobachtete, wie sich ihre stecknadelkopfgroßen Pupillen trotz der Sommersonne ein bisschen weiteten. Er lächelte. Good cop, bad cop. Es war lange her, aber er konnte es noch.
Sie entspannten sich. Der Mann mit dem Bier hatte eine Gitarre geholt und begann leise zu spielen. Blues, die afrikanische Art. Träume von Timbuktu. Er sang mit geschlossenen Augen. Raphael verstand nicht die Worte, aber den Sinn, den verstand er. Ab und zu hielt der Musiker inne und nahm einen Schluck. Dann spielte er weiter. Auch Raphael schloss die Augen. Die Weise perlte über das Wasser wie eine Sommerbrise. Wie eine Liebkosung.
„Vielleicht hätte es geklappt“, sagte Youssouf nachdenklich. „Er war klug. Er war schön ...“, er brach ab. „Sie ist so eine dämliche Kuh.“
Raphael riss die Augen auf. Da war aber einer mächtig eifersüchtig. Fragte sich bloß, auf wen. Auf Caroline? Auf Malouf? Konnte man auf Tote eifersüchtig sein? Konnten Tote eifersüchtig sein? Er ballte die Fäuste, als er merkte, wie die Gedanken ihm wieder zu entrinnen begannen.
Plötzlich lag Youssoufs Hand auf seiner. Raphael zuckte zurück, aber dann sah er Youssoufs Augen. Er lockerte die Fäuste. „Allah liebt dich“, hörte er den hageren Mann leise sagen. „Allah hilft uns. Vergiss das nie.“ Ein paar Leute murmelten zustimmend. Es klang fast wie eine Beschwörung. Wie ein Gebet. Er fuhr sich über das Gesicht. Bestimmt hatten sie ihm was in den Tee getan. Oder in den Reis.
Oder auch nicht.
Langsam dämmerte es ihm: Er trank nicht und er war beschnitten und sie hatten eins und eins zusammengezählt.
Sie hatten sich verrechnet. Zu seinen Gunsten verrechnet. Nur ein Idiot würde das nicht ausnutzen.
Raphael starrte auf die Zahlenreihe, die sich über seine Fingerknöchel zog.
Großvater war schon eine Weile tot gewesen, als der Geschichtslehrer eines Tages von den eintätowierten Häftlingsnummern erzählt hatte, an denen man die Überlebenden der Konzentrationslager erkannte. Als Raphael es zu Hause erwähnte, sprachen die Eltern drei Tage lang nicht mehr mit ihm. Er hatte sich dann auch eine Nummer stechen lassen. Die Telefonnummer eines Mädchens, mit dem er damals ging. Es war krank, aber er hatte nicht anders gekonnt. Er war so verdammt wütend gewesen. Und so abgrundtief traurig. Und so heillos allein.
„Wir sind Juden“, sagte er schlicht.
Es klang komisch. Es hatte ihm nie etwas bedeutet. Es bedeutete ihm auch jetzt nichts, außer, dass es die Wahrheit war.
„Oh“, sagte das Mädchen. Die anderen sagten nichts.
„Allah liebt dich trotzdem“, beschloss Youssouf. Raphael lächelte höflich. Er kramte nach einem Kärtchen. „Wenn euch noch was einfällt ...“ Love hurts. Er wollte nach Hause. Nur noch nach Hause.
Er verstand nicht gleich, woher das Blut kam, das auf das Kärtchen tropfte. Als einer ihm Klopapier auf die Stirn drückte, fiel es ihm wieder ein. Er hätte doch Fannys Pflaster benutzen sollen. Shit. Fuck. Sorry. Sie fragten, woher er die Platzwunde hatte, und er sagte es ihnen.
Sie nickten anerkennend. Es klang verwegen. Verwegen ehrlich.
Sie brachten einen Verbandskasten. Kaum zu glauben, dass sie hier sowas hatten. Kaum zu glauben auch, was darauf stand, in ernsthafter Druckschrift, die unter dem alten Klebefilm zerlief. Trotzdem gab es keinen Zweifel. Raphael schluckte. Es war eindeutig. Da stand: Werner Huysmans.
Protokoll Zeugenaussage Werner H. folgt.
Mechanisch begann er den Kasten zu öffnen, weil keiner etwas unternahm. Es war ein Autoverbandskasten, lange abgelaufen. Raphael kramte ein einzeln verpacktes knittriges Pflaster heraus und begann das Papier zu lösen. Amina nahm ihm das Pflaster aus der Hand. „Erst sprayen“, sagte sie, „Augen zu!“ Raphael gehorchte und fühlte, wie etwas Kühles seine Stirn benetzte, das nach Krankenhaus roch. Er machte die Augen wieder auf und beobachtete, wie das Mädchen seine Wunde bepflasterte. Hatte er eben Amina gedacht? Verdammt.
„Wer ist Werner Huysmans?“, fragte er hart. Das Mädchen zuckte die Schultern und zeigte ihm einen in Plastikfolie gesteckten Zettel, der in dem Kasten gelegen hatte: „Sprayen – Verbinden – Beobachten. Werner“, stand darauf. In Englisch, Französisch und Deutsch. Und ein Smiley. „Ein Arzt?“, vermutete sie.
Vorsichtig befühlte Raphael sein Pflaster. Ein Arzt, der seinen alten Autoverbandskasten hinterlassen hatte. Und eine handgeschriebene Erste-Hilfe-Anleitung. Falls man das so nennen konnte. Dr. Huysmans. Wunderheiler.
Sein Blick glitt über das Interieur. Irgendetwas hatte er damals übersehen. Raphael besah die dunklen Gesichter, die er immer noch nicht lesen konnte. Keiner der Leute war länger als ein paar Wochen hier. Ein paar Monate allenfalls. Bis auf Youssouf. Keiner von ihnen verstand die alten Zeichen. Bis auf Youssouf vielleicht. Ein Brandfleck hier. Ein schlecht ausgebessertes Paneel da. Ein Vorhang, wo früher eine Tür gewesen war. Raphael legte die Arme um seinen Leib, weil plötzlich das Boot vor ihm erstand, wie er es gekannt hatte. Mit den Menschen, die dort gewesen waren. Amina. Amina.
„Der Brand. Damals. Auf dem Boot. Was wisst ihr davon?“, sagte er mühsam.
Welcher Brand? Sie wurden wieder unruhig. Der Mann mit der Gitarre verstummte. Ein paar Leute bauten sich vor ihm auf. Youssouf mahlte mit den Kiefern. Es war ein Fehler gewesen. „Ist lange her“, sagte Raphael, so gleichgültig wie möglich. Er kannte keinen hier persönlich, aber das musste er auch nicht, um zu wissen, was hinter ihnen lag. Vielleicht fühlten sie sich hier das erste Mal sicher, ein bisschen wenigstens, und sie würden nicht dulden, dass einer ihnen das zerstörte. Sie hatten alles überlebt und manche hatten dafür gestohlen und betrogen und vielleicht auch getötet.
Raphael setzte sich gerade. Zeit, zu gehen. Keinen Augenblick hatte er geglaubt, sie würden ihm vertrauen. Keinen Augenblick hatte er ihnen vertraut. Er hatte es sich nur gewünscht. So sehr gewünscht. Er zog ein neues Kärtchen raus. „Wenn euch noch was einfällt“, sagte er zum zweiten Mal. Es klang ziemlich harsch. „Danke für das Essen. Und für das Pflaster“, schob er nach, sanfter jetzt. „Und für den Tee … und die Dose …“ Er grinste matt und ein paar Leute grinsten zurück.
Muss man jemanden kennen, um Mitgefühl zu haben? Vielleicht war er zu lange in diesem Job. Vielleicht hatte er zu viel gesehen. Vielleicht hatte er mehr mit diesen Leuten gemeinsam, als er zulassen konnte. Vielleicht hatte er wieder mal alles kaputt gemacht. Er hatte zu viel gewollt. Er hatte immer zu viel gewollt.
Raphael sog heftig die Luft ein.
Alleine würde er das hier niemals schaffen.
„Bringt mich raus, bitte“, sagte er und sie trugen ihn an Land.
Er merkte nicht, dass ihm jemand folgte, als er Richtung Auto rollte, eine Belga im Mundwinkel. Einmal noch ließ er den Blick über das Glitzerwasser gleiten; über das alte Boot. Niemand stand an Deck, um ihm nachzusehen. Raphael pumpte Rauch in seine Lungen und hielt ihn. Er war der böse Cop und so fühlte er sich auch. Langsam atmete er aus, bis ihn ein Hustenanfall schüttelte, der ihn einen Moment stoppte. Hustend erreichte er endlich seinen Wagen und kletterte hinein. Er hustete immer noch, als er den Rollstuhl zerlegt und verstaut hatte und den Motor anließ. Er trommelte auf das Lenkrad, während er langsam das Handgas zog.
Warum. Warum waren sie so verschlossen. Begriffen sie nicht, dass sie in Gefahr waren? Warum vertrauten sie ihm nicht? Raphael biss sich auf die Lippen. Vielleicht steckten sie mit drin. Worin auch immer. Vielleicht hatten sie was zu verbergen.
Sie würden ihm nicht helfen. Sie konnten nicht.
Plötzlich stand dieser Mann vor ihm. Raphael rammte den Hebel rein, dass der Wagen quietschend zum Halten kam. Im ersten Moment begriff er nicht, dass es Youssouf war. Youssouf, ohne Visier. Youssouf, der Angst hatte. Und Mut. Raphael sah sich um, langte zur Beifahrertüre rüber und öffnete sie. „Schmeiß den Kram in den Kofferraum und setz dich!“, sagte er, ohne nachzudenken.
„Ich bin bloß … Zigaretten holen …“, keuchte der Afrikaner, während Raphael mit ihm davonbrauste. „Es ist gut“, sagte Raphael. „Es ist alles gut“. Er legte dem Mann die Hand auf die Schulter. „Was gibt’s?“ Er fühlte, wie der Mann zitterte.
Youssouf rang nach Atem. „Sie … Sie wissen nichts davon …“, stammelte er. Raphael steuerte zügig aus der Stadt raus, über die Scheepsdalebrücke Richtung Blankenberge, während er den Rückspiegel im Auge behielt. „… dass ich ein … Spion bin.“ Youssouf nahm die Zigarette, die Raphael ihm rüberreichte, und ritschte ein Dutzendmal mit dem Feuerzeug, bis er sie anbekam. Raphael rollte mit den Augen. „Ja?“, sagte er sanft.
„Der Tobi“, begann Youssouf stockend, während sie über den Blankenbergse Steenweg Richtung Norden rasten. „Ich treff’ mich einmal die Woche mit ihm. Oder wenn was Besonderes ist. Er hilft mir. Dass ich nicht zurück muss. Ich bin… solche wie mich… sie würden mich dort … du verstehst … “ Er schwieg. Raphael schwieg auch. Anna hätte jetzt gefragt, wer der Tobi ist. „Ich soll die Leute im Auge behalten“, fuhr Youssouf fort. „Auf dem Boot. Was sie reden. Wo sie hingehen. Wer zu Besuch kommt … Freunde … Polizei …“ Der Mann straffte sich. „Und wer gut kochen kann. Für Flor. Ich sehe sowas.“ Raphael nickte. „Das Essen heute, das war von dir, oder?“ Youssouf grinste zufrieden. „Hm …“
Raphael lächelte. Vertrauen. Er beherrschte jede Taktik, aber es kam immer wieder wie ein Geschenk. Wie ein Zauber. So unverdient. Und so flüchtig.
„Und der Tobi“, sagte er gedehnt, „kochst du für den auch?“ Youssouf schüttelte den Kopf. „Ich würde gerne, aber er darf nicht an Bord.“ Raphael sah den Mann an. „Wegen dem Boss“, sagte Youssouf und knetete die Hände. „Ich kenne den nicht. Den Boss“, beantwortete er Raphaels stumme Frage. Dann schwieg er erschöpft.
Dankbar nahm er eine weitere Zigarette und rauchte schweigend.
Das war’s. Raphael seufzte. Er würde ein anderes Mal nach Tobi fragen. Er sah auf die Uhr. „Eins noch. Der Brand …“ Sie mussten zurück. „Was weißt du davon?“ Youssouf aschte in den überfüllten Aschenbecher. „Nur was Benne erzählt hat“, ein Lächeln schoss ihm über das Gesicht, wie eine Sternschnuppe. „Es war schlimm, aber er hat es wieder hingekriegt.“
„Benne?“, sagte Raphael, während er den Wagen wendete.
„Nein. Benne“, Youssouf hob die Hände und malte Rauchzeichen in die Luft. „Benne“, wiederholte er hilflos. „Ein Streetworker. Ein netter Mann. Er war dabei. Hat er gesagt. Als es gebrannt hat. Er hat versucht, zu helfen. Er hat gesehen, wie ein Mädchen ins Wasser sprang. Sie konnte nicht schwimmen. Er wollte sie retten. Er hat geweint. Benne. Wie er es erzählt hat.“ Youssouf quetschte die Kippe zu den anderen.
Raphael presste einen Moment lang den Ärmel auf die Augen, weil alles verschwamm. Youssouf sah ihn von der Seite an. „Es ist lange her“, sagte er leise. „Fast drei Jahre.“
„Danke, Youssouf“, sagte Raphael rau. Benne. Nein. Benne. „Benne wie?“, versuchte er es nochmal. „Be-nne“ korrigierte Youssouf. „Sprayen. Verbinden. Beobachten.“ Raphael umklammerte das Steuer. „Werner?“, fragte er ungläubig. Youssouf lachte erleichtert. „Benne! Ja! Er war so nett zu mir. Ich war ganz neu hier.“ Er wurde wieder ernst. „Eines Tages kam er nicht mehr. Er kam nie mehr.“
Werner H., Wunderdoktor. Streetworker. Protokoll folgt. Raphael biss sich auf die Lippen. Er würde ihn finden. Wenn er noch lebte, würde er ihn finden.
Vor der neuen Scheepsdalebrücke mit ihren schwungvollen weißen Designer-Auslegern fuhr er rechts ran. „Die Zigaretten“, sagte er. „Gehen die?“, er zog eine frische Schachtel aus der Westentasche und steckte sie wieder ein. „Nein“, er hatte Youssoufs Gesicht gesehen. „Falsche Marke. Warte.“ Er kurvte in die Stadt zurück und hielt vor einem Tabakladen. „Lauf!“ Dann chauffierte er den Mann zu den Ladekais zurück und parkte in einer Nebenstraße. Er taxierte die Umgebung. „Lauf!“, sagte er wieder. Die Luft war rein. Gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, Youssouf den Rahmen des Rollstuhls wieder aus dem Kofferraum holen zu lassen. Einmal hatte er das vergessen. Er hatte nachts einen Freund nach Hause gefahren. Gegen vier Uhr früh war er wieder in seiner Straße gewesen. Nur er.
Er erinnerte sich verdammt ungern daran.