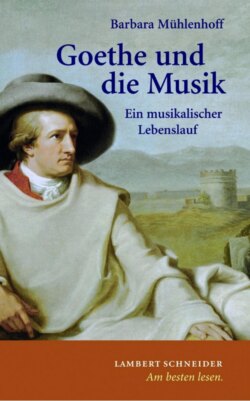Читать книгу Goethe und die Musik - Barbara Mühlenhoff - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Studienzeit in Leipzig (1765–1767): Hillers Singspiele und das „sächsische Kleinparis“
Оглавление„Mein Leipzig Lob’ ich mir! Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute.“
(Faust I, Auerbachs Keller in Leipzig, Erstausgabe 1808)
„Schönste Tugend einer Seele, Reinster Quell der Zärtlichkeit! Mehr als Biron, als Pamele Ideal und Seltenheit! Wenn ein andres Feuer brennet, Flieht dein zärtlich schwaches Licht; Dich fühlt nur, wer dich nicht kennet, Wer dich kennt, der fühlt dich nicht.“
(Erste Strophe von „Unschuld“, entstanden 1767/68)
Auf Wunsch seines Vaters studiert Goethe ab 1765 Jura in Leipzig, einer im Vergleich zu Frankfurt weltoffenen, mondänen Stadt. Aus dem verschlafenen, altväterlichen Frankfurt kommt er in eine pulsierende Metropole des Rokoko. Von Haus aus mit genug Geld ausgestattet, kleidet der junge Student sich zunächst neu ein und nutzt, selbst aus besten bürgerlichen Kreisen stammend und mit entsprechenden Empfehlungen versehen, seinen Zugang zur oberen Leipziger Gesellschaft. In Leipzig trifft er auch seine erste große Liebe, die Tochter eines Zinngießers und Weinhändlers, Anna Katharina („Käthchen“) Schönkopf (1746–1810). Das unstandesgemäße Verhältnis wird 1768 jedoch wieder gelöst. Das Jurastudium beginnt den Schöngeist bald zu langweilen; er hätte lieber intensiver die schönen Wissenschaften, Poetik und Rhetorik, studiert. So hört er Vorlesungen in Philosophie und Philologie, unter anderem bei Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769, bekannt vor allem für seine Morallehre) und dem Schriftsteller, Dramaturgen und Literaturtheoretiker Johann Christoph Gottsched (1700–1766). Schon zu dieser Zeit kristallisiert sich eine von Goethes besonderen Begabungen heraus: Er beginnt, im Dezember 1766 Zeichenunterricht bei dem Maler, Kupferstecher und Bildhauer Adam Friedrich Oeser (1717–1799) zu nehmen. Dieser begeistert ihn für die Ideen des deutschen Archäologen, Antiquars und Kunstschriftstellers Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), der als Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte sowie des geistigen Klassizismus im deutschsprachigen Raum gilt. Der eifrige Schüler erweist sich als hoch begabt und kann sich lange Zeit nicht entscheiden, ob er sein Augenmerk lieber auf die Dicht- oder die Zeichenkunst legen soll. Es wird hier zudem deutlich, wie sehr eine innige Beziehung zu Licht und Farben sein Leben auszeichnet. Sie prägt seinen Dichtungen einen unverkennbar konkret bildhaften Charakter auf, und sein Sinnen und Dichten ist zugleich immer auch ein Schauen. Goethe ist ein „Augenmensch“. Dass er in späteren Jahren als Naturforscher eine eigene Farbenlehre entwickelt, ist nicht zufällig, sondern liegt tief in seinem ganzen Wesen begründet. Mit der Zeit fühlt der angehende Künstler sich immer mehr dazu gedrängt, seine Gefühle in eine Form zu gießen:
„Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige, was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nöthiger als mir, den seine Natur immerfort aus einem Extreme in das andere warf.“
(Dichtung und Wahrheit, II. Teil, 7. Buch)
1767 entsteht als kleines dramatisches Werk „Die Laune des Verliebten“, eine Schäferdichtung mit Lied- und Tanzeinlagen, deren erste Aufführung allerdings erst im Jahr 1779 am 20. Mai auf Schloss Ettersburg bei Weimar mit Musik des deutschen Dichters und Komponisten Karl Siegmund Freiherr von Seckendorff (1744–1785, siehe Kapitel 6) erfolgt. In Weimar wird es am 6. März 1805 und in Berlin am 3. Dezember 1815 (mit Musik von dem Organisten, Kontrabassisten und Komponisten Joseph Augustin Gürlich, 1761–1817) aufgeführt. Im gleichen Jahr verfasst Goethe zudem die „Lieder mit Melodien“, die er Friederike Oeser (1748–1829), der Tochter seines Zeichenlehrers, überreicht. Die beiden verbindet eine Freundschaft, die sich noch eine Reihe von Jahren im Briefwechsel erhalten sollte. Die Anfänge des „Urfaust“ gehen auch auf diese Zeit zurück.
Johann Adam Hiller (1728–1804), der Nachfolger Johann Sebastian Bachs als Thomaskantor in Leipzig, prägt das „sächsische Kleinparis“ ganz anders als sein Vorgänger durch seine idyllisch-empfindsamen Singspiele6. Hier bekommt Goethe ersten Kontakt zu dieser Gattung der Musik sowie zu Hiller selbst:
„Auch ich habe den guten Hiller besucht und bin freundlich von ihm aufgenommen worden; doch wusste er mit meiner wohlwollenden Zudringlichkeit, mit meiner heftigen, durch keine Lehre zu beschwichtigenden Lernbegierde sich so wenig als andere zu befreunden.“
(Goethe’s nachgelassene Werke, S. 283)
Weiterhin erwähnt er: „Auch jene Dlle. [Demoiselle] Schmelling hab’ ich damals bewundert, eine werdende, für uns unerfahrene Knaben höchst vollendete Sängerin“ (Goethe’s sämmtliche Werke in vierzig Bänden, Bd. 26, o. A. der Seite). Gemeint ist Gertrud Elisabet Mara, geb. Schmähling (1749–1833), eine deutsche Opernsängerin, der Goethe 1771 sogar ein Gedicht widmet:
„Der Demoiselle Schmehling nach Aufführung der Hassischen Sta. Elena al Calvario, Leipzig 1771.
Klarster Stimme, froh an Sinn Reinste Jugendgabe Zogst Du mit der Kaiserin Nach dem heil’gen Grabe. Dort, wo alles wohlgelang, Unter die Beglückten Riß Dein herrschender Gesang Mich den Hochentzückten.“
(Goethe’s nachgelassene Werke, S. 140)
Er wird sie nie vergessen, und zu ihrem 82. Geburtstag bedenkt er sie mit einem weiteren Gedicht:
„An Madame Mara, zum frohen Jahresfest, Weimar 1831
Sangreich war Dein Ehrenweg, Jede Brust erweiternd; Sang auch ich auf Pfad und Steg, Müh’ und Schritt erheiternd. Nah dem Ziele, deut’ ich heut Jener Zeit, der süßen; Fühle mit wie mich’s erfreut Segnend Dich zu grüßen!“
(Goethes nachgelassene Werke, S. 141)
Sie wird durch Hiller als erste Konzertsängerin für 600 Taler engagiert, und schon bald gilt sie als beste Sängerin, die Deutschland je hervorgebracht hat. Sie hat einen Stimmumfang vom kleinen g bis zum dreigestrichenen f, also fast drei Oktaven. Dabei soll ihre Stimme innerhalb dieses Umfangs gleichmäßig stark gewesen sein und ihre Interpretationen vor allem durch ihre Leichtigkeit und Schnelligkeit Bewunderung ausgelöst haben. Sie stirbt tragischerweise von Schicksalsschlägen gezeichnet 1833 verarmt in Reval.
Eine weitere wichtige Person, der Goethe in Leipzig begegnet, ist die Sängerin Corona Schröter, die ebenfalls dort engagiert ist und um deren Gunst er später werben wird. Mit dem Gedicht „Auf Miedings Tod“ setzt er ihr ein literarisches Denkmal.
Der junge Bernhard Theodor Breitkopf (1745–1820, ältester Sohn des bekannten Musikverlegers und Notendruckers Immanuel Breitkopf, 1719–1794) vertont in dieser Zeit als Erster einige der Gedichte seines Freundes: „Das Schreien“, „Der Misanthrop“, „Die Nacht“, „Liebe und Tugend“, „Neujahrslied“ und „Wunsch eines jungen Mädchens“, alle veröffentlicht 1769 im „Leipziger Liederbuch“ ohne Nennung des noch unbekannten Dichters. Für 24 Jahre bleibt dies die einzige Liedersammlung zu Texten Goethes. Mit seinen ebenfalls musikbegeisterten Freunden hört der junge Dichter viele Aufführungen italienischer Komponisten, zum Beispiel von Niccolò Jomelli (1714–1774, dessen Bedeutung hauptsächlich auf dem Gebiet der Kirchenmusik und der Oper liegt), Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736, besonders bekannt durch seine sakralen Werke wie z.B. das „Stabat Mater“, das im 18. Jahrhundert am häufigsten gedruckte Musikstück, sowie seine Opern), Francesco Durante (1684–1755, ein reiner Kirchen- und Kammerkomponist, der sich nicht von der Oper „überfluten“ ließ), Nicola Antonio Porpora (1686–1768, zu seinen Lebzeiten der beste Gesangslehrer Italiens [und damit Europas], Hauptvertreter der Opera seria) und Antonio Caldara (1670–1736, der sich mit über 3400 komponierten Werken, darunter mehr als 80 Opern, 43 Oratorien, 150 Messen, Serenaden, Kantaten und Sinfonien einen Namen macht – seine Musik zeichnet sich durch großen Melodienreichtum aus). Auch die Musik deutscher Komponisten wie Nicolaus Hasse (1617–1670 oder 1672, deutscher Komponist und Organist der norddeutschen Orgelschule) oder der Brüder Johann Gottlieb (1703–1770) und Carl Heinrich Graun (1704–1759, Komponisten zahlreicher kirchenmusikalischer und weltlicher Stücke, darunter Passionsmusiken, Sinfonien, Opern, Violin- und Cellokonzerte etc.) verachtet er nicht.
Corona Schröter. Undatiertes Grisaillegemälde von Ernst Hader nach einem zeitgenössischen Bildnis.
1768 erkrankt Goethe schwer (er schreibt von einem Blutsturz – vielleicht handelt es sich um Tuberkulose) und reist am 28. August, seinem Geburtstag, zurück in die Heimat nach Frankfurt. Dort beschäftigt er sich intensiver mit den Vorstellungen des Pietismus, nahegebracht durch eine Freundin der Mutter, der Herrnhuterin Susanne von Klettenberg (1723–1774), die ihn mitunter pflegt. Sie regt ihn zur Lektüre pansophisch-alchemistischer Schriften in neuplatonischer Tradition an, z.B. Paracelsus, Basilius Valentinus und Georg von Wellings „Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum“ aus dem Jahre 1735, einem wichtigen esoterischen Werk. Der wissbegierige junge Student macht daraufhin selbst verschiedene alchemistische Experimente, die sein Interesse für die exakte und aufmerksame Beobachtung von Naturvorgängen wecken.