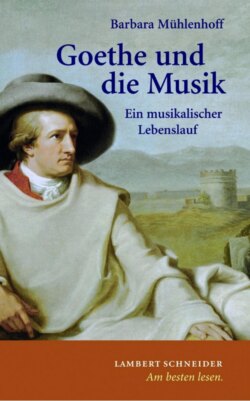Читать книгу Goethe und die Musik - Barbara Mühlenhoff - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Studienzeit in Straßburg (1770–1771): Herder und das deutsche Volkslied
Оглавление„Kleine Blumen, kleine Blätter Streuen mir mit leichter Hand Gute junge Frühlingsgötter Tändelnd auf ein luftig Band.“
(Erste Strophe von „Mit einem gemalten Band“, entstanden 1770)
Die langwierige und schwere Erkrankung Goethes führt zu einem radikalen Umbruch und einer starken geistigen Vertiefung seines Lebens. Nach langer Rekonvaleszenz genesen setzt er seine bisher unvollendete Studienzeit in Straßburg fort. Dort wohnt er in einer Wohnung am Alten Fischmarkt und besucht von April 1770 bis März 1771 Vorlesungen nicht nur in Jura, sondern auch in Geschichte, Staatswissenschaft, Anatomie, Chirurgie und Chemie. Und er macht weitere Erfahrungen im praktischen Umgang mit Musik: Er lernt bei dem Cellisten Busch Cello spielen und wirkt im Ensemble einiger Freunde mit. Im Jahre 1772 schreibt er von Frankfurt an seinen Bekannten, den Juristen und Popularphilosophen Johann Daniel Salzmann (1722–1812), nach Straßburg:
„Wollen Sie bei Gelegenheit meinen Violoncellmeister Buschen Fragen, ob er die Sonaten für zwei Bässe noch hat, die ich mit ihm spielte, sie ihm abhandeln und baldmöglichst mir zuschicken. Ich treibe die Kunst etwas stärker als sonst.“
(Brief an Johann Daniel Salzmann, 3. Februar 1772)
Wie weit er als Musikschüler die „Kunst des Violoncellspiels“ letztendlich getrieben hat, ist allerdings nicht bekannt.
Beim gemeinsamen Mittagstisch im nahe gelegenen Gasthaus in der Rue de l’Ail (Knoblauchgasse) kommt er mit dem pietistischen Schriftsteller und Arzt Johann Heinrich Jung, genannt Stilling (1740–1817), mit Jakob Michael Reinhold Lenz (1751–1792), der als Hofmeister zweier kurländischer Edelleute in Straßburg weilt, und mit dem Theologen Franz Christian Lerse (1749–1800) zusammen. Letzteren nimmt Goethe als Vorbild für die Figur des Götz von Berlichingen und setzt ihm so ein Denkmal. Im Gasthof „Zum Geist“ trifft er dann auf den damals 26 Jahre alten Theologen, Dichter und Philosophen Johann Gottfried Herder (1744–1803), der wegen einer Augenoperation eine längere Reise in Straßburg unterbrechen muss. Es ist die Epoche der Klassik mit ihren Idealen der Einfachheit und Natürlichkeit, in der dieser Herder sich mit den Liedern des „einfachen Volkes“ beschäftigt – er benutzt zunächst den Begriff „Populärlied“ (angelehnt an den englischen Begriff „popular song“7), später kultiviert er den Begriff des „Volksliedes“. Er regt seinen neuen Freund an, der Überlieferung der Volkspoesie im Elsass nachzuforschen. Dieser folgt interessiert der Empfehlung und legt eine Forschungszeit ein. Kurz nach seiner Rückkehr aus Straßburg im Jahr 1771 nach Frankfurt schickt er Herder daraufhin zwölf von ihm selbst aufgezeichnete Lieder. Die Melodien hat Goethe sich wohl gemerkt und seiner Schwester Cornelia vorgesungen. Diese schreibt sie auf, denn ihr Bruder möchte Herder die Noten als Ergänzung zukommen lassen:
„… alle Mägden die Gnade vor meinen Augen finden wollen, müssen sie lernen und singen, meine Schwester soll Ihnen die Melodien die wir haben, (sind NB die alten Melodien, wie sie Gott erschaffen hat) sie soll sie Ihnen abschreiben.“
(Begleitbrief zu den 12 aufgezeichneten Liedern an Herder, Frankfurt, Herbst 1771)
Ihre Handschriften sind jedoch heute verschollen. Goethes Arbeit auf dem Gebiet der Volkslieder setzt sich später noch fort. „Meine frühere Vorliebe für eigentümliche Volksgesänge hat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ist sie durch reiche Mitteilungen von vielen Seiten her nur gesteigert worden“, schreibt er 1823 in dem Aufsatz „Volksgesänge abermals empfohlen“ in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Kunst und Alterthum“. Seine Vorliebe für heiter-gesellige Lieder und seine Neigung zum Strophenlied sind unverkennbar vom Volkslied beeinflusst. Dabei geht es ihm vor allem um Authentizität, den genauen Wortlaut, Rhythmus und Melodie. Gerade in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bahnt sich diese neue Verbindung von Musik und Poesie ihren Weg. Die Humanitätsbewegung entdeckt im Lied im Volkston ein Mittel, um die Lebenshaltung des gesamten Volkes zu veredeln. Die Geselligkeit im Haus und im Freien sowie die Arbeit aller Stände sollen von Musik begleitet werden und ihren eigenen Liedschatz erhalten. Die Komponisten fühlen sich gehalten, den Schwierigkeitsgrad ihrer Kompositionen zu mäßigen und schlicht sangbare Weisen in engem Anschluss an die Poesie hervorzubringen. Volksmusik ist leicht verständlich, meist nur in mündlicher Überlieferung weitergegeben und unterliegt daher einer stetigen regional und kulturell differenzierten Variabilität, sodass sie unterschiedlich in den Volksmund eingeht. Für Goethe ist allein der Standpunkt wichtig: Jedes lyrische Erzeugnis, das nicht zugleich gesungen wird oder werden kann, hat für ihn seine Berufung verfehlt. Die Stimme gilt für ihn damit als eines der schöpferischsten Instrumente, wie er später in seiner Tonlehre (vgl. Kapitel 9) festhält. Die 1778 erstmals erschienene Volksliedsammlung von Herder „Volkslieder nebst untermischten anderen Stücken“ (erst in der 2. Auflage 1807 unter dem Titel „Stimmen der Völker in Liedern“) ist die erste schriftliche Niederlegung des originär mündlichen Volksmusikgutes. Diese Texte, meist ohne musikalische Notation, können heute vor allem literatur- und gesellschaftswissenschaftliche Interessen bedienen, aber genauso als Quelle der Volksmusikpflege gelten. Goethes Beitrag dazu ist mit 12 Liedern verhältnismäßig gering. Wie er weiterhin im oben genannten Begleitbrief ausführt, macht er die Erfahrung, dass er die Volkslieder nur „aus den Kehlen der ältesten Müttergens“ hört, „denn ihre Enkel singen alle: ich liebte nur Ismenen8“. Diese „Stimmen der Völker in Liedern“ wieder zum Klingen zu bringen leitet Herders Interesse beim Sammeln der zufällig im Volk umlaufenden Gesangsstücke. Er macht Goethe auch auf das alte neunstrophige Volkslied des 16. Jahrhunderts aufmerksam, das immer wieder auf die Verszeile „Rößlein auff der Heyden“ zurückkommt. Dieser verfasst daraufhin ein Gedicht, das durch die Schubert-Vertonung als „Heideröslein“ einen großen Bekanntheitsgrad erreicht. Zu jener Zeit hat der junge Dichter eine kurze, aber heftige Liebschaft mit der elsässischen Pfarrerstochter Friederike Brion (1752–1813), an die er das Gedicht richtet.
„Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehn, sah’s mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: „Ich breche dich, Röslein auf der Heiden!“ Röslein sprach: „Ich steche dich, dass du ewig denkst an mich, und ich will’s nicht leiden.“ Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach ’s Röslein auf der Heiden; Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musst’ es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.“
Im Frühjahr 1771 entsteht eine ganze Reihe von Gedichten und Liedern, die manchmal mit „bemalten Bändern“ an die geliebte Friederike gesandt werden; diese „Sesenheimer Lieder“ gehören maßgeblich zum Sturm und Drang und begründen Goethes Ruf als Lyriker. Unter ihnen sind auch das bekannte „Mailied“ („Wie herrlich leuchtet mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur! …“) und „Willkommen und Abschied“ („Es schlug mein Herz. Geschwind, zu Pferde! Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht …“).
Goethes Dissertation über das kirchengeschichtliche Thema „Der Gesetzgeber ist nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet, einen gewissen Kultus festzusetzen, von welchem weder die Geistlichkeit noch die Laien sich lossagen dürfen“ wird abgelehnt aufgrund seiner kühnen Thesen, nach denen die christliche Lehre nicht von Christus stamme, sondern von anderen unter seinem Namen verkündet worden sei. Man gestattet dem Doktoranden aber eine Verteidigung einfacherer Thesen, wodurch er am 6. August 1771 den akademischen Grad eines Lizentiaten der Rechte erwirbt, der in Deutschland gleichwertig dem Doktorat angesehen wurde. Goethe wird dadurch berechtigt, den Titel Dr. juris zu tragen. Zwei Tage nach dem Erhalt der Doktorwürde sieht er Friederike Brion zum letzten Mal. Erst, als er wieder in Frankfurt ist, schreibt er ihr und gibt die Trennung bekannt.
1770 fängt mit dem „Ephemerides“ die Reihe der tagebuchartigen Aufzeichnungen Goethes an, die sich in den „Annalen“ und „Tag- und Jahresheften“ bis in sein Alter hin fortsetzen. Diese wichtigen persönlichen Schriftstücke sind voll von musikalischen Notizen und bieten Einblicke in die Gedankenwelt des Schriftstellers.