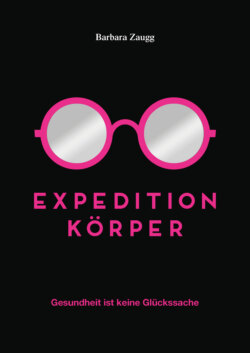Читать книгу Expedition Körper - Barbara Zaugg - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unterwegs im Verdauungstrakt
ОглавлениеWir stehen mitten im Mund. Bereits hier, liebe Leserinnen und Leser, beginnt unser Verdauungstrakt. Haben Sie gewusst, dass wir im Laufe unseres Lebens locker zwischen 30 und 50 Tonnen Nahrung verdauen und so unsere Körperzellen nähren? Eine unvorstellbare Menge! Unserer Verdauung gebührt grosser Dank und Respekt, denn sie leistet Gewaltiges.
Wichtig: Um Ihrer Verdauung behilflich zu sein, müssen die dem Mund zugeführten kompakten Köstlichkeiten gut gekaut werden. Nicht vergebens haben Sie – vorausgesetzt alle Weisheitszähne sind vorhanden – 32 Zähne (je 16 im Ober- und im Unterkiefer). Einerseits sind diese für die Zerkleinerung der Nahrung verantwortlich, andererseits dienen sie auch der Lautbildung beim Sprechen. Wie schräg hört sich ein S oder R an, wenn die oberen Schneidezähne fehlen? Und ohne sie macht auch ein Lächeln vor dem Spiegel keinen Spass. Verabschieden sich die Zähne aus Altersgründen aus unserem Leben, ja dann klingeln die Kassen der Zahnärzte. Denn ohne Gebiss läuft gar nichts mehr, und obendrauf verändern sich noch die Gesichtszüge. Wir werden zum Handeln gezwungen, dies aber auch bei defekten oder ungepflegten Zähnen. Ich bin von der Kernaussage abgeschweift, nämlich: Gut gekaut ist halb verdaut! Je grösser die Speisebrocken, desto härter muss Ihre Verdauung arbeiten, um aus den Mocken zuerst Matsch zu machen. Helfen Sie aktiv mit, es lohnt sich, denn eine reibungslose Verdauung ist garantiert auch in Ihrem Interesse.
Zur Steuerung empfängt und übermittelt der Verdauungstrakt Informationen über das Gehirn. Viele der dafür notwendigen Nervenbahnen befinden sich im Darm. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir ein Darmhirn (enterisches Hirn) besitzen. Dass wir öfter mal vom Bauchgefühl sprechen, kommt nicht von ungefähr. Dieses hat tatsächlich anatomische Strukturen. Ich werde im Kapitel «Das Bauchgefühl – wenn der Körper Sie anruft» eingehend darauf zurückkommen.
Bitte ziehen Sie die wasserfeste und säurebeständige Weste an und klinken Sie die Anseilleine ein, denn in Kürze wird es stürmisch. Unser Weg führt über die Zunge zum Rachenraum. Geben Sie acht auf die links und rechts hervorragenden Zähne, die Sie bei einem Fehltritt sehr schnell irrtümlich zu Kaugummi machen können.
Man fühlt sich in einer Art Tropfsteinhöhle. Das Halszäpfchen sowie die Rachen- und Gaumenmandeln vermitteln diesen Eindruck. Vorsicht, stossen Sie nicht an das Halszäpfchen, sonst wird gleich ein natürlicher Würgeffekt ausgelöst, und Sie kommen arg in die Klemme. Das Halszäpfchen dient nämlich nicht nur der Lautbildung, sondern ist gleichzeitig auch Verkehrspolizist und weist die Speisebrocken in die richtige Spur. Der Würgeffekt verhindert, dass der Nahrungsbrei in die Luftröhre gelangt, was im schlimmsten Fall zu einer Erstickung führen könnte. Glücklicherweise verfügen wir über ein natürliches Sicherheitssystem: die Epiglottis, die ich liebevoll Lotti nenne. Es handelt sich dabei um einen Deckel über der Luftröhre, der sich öffnen und schliessen kann. Lotti sei Dank also, dass wir nicht an unserem Essen ersticken.
Im Vorbeigehen – denn sie gehören nicht zum Verdauungstrakt – erwähne ich die gut erkennbaren Gaumen- und Rachenmandeln. Wer im Kindesalter oft von schmerzhafter Angina geplagt war, kann ein Lied davon singen. Früher wurde solchem Leiden nicht selten mittels operativer Entfernung der Mandeln ein Ende gesetzt. Sie gehören aber zum lymphatischen Rachenring und sind ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. Heutzutage ist man mit der Entfernung deshalb zurückhaltender.
Achtung, jetzt geht es für einen Moment sehr steil hinunter. Wir seilen uns durch die mit unwillkürlicher Muskulatur (glatter Muskulatur) umgebene Speiseröhre ab. Sie hat einen Durchmesser von eineinhalb bis zwei Zentimetern. Während rund einer Lineallänge spüren Sie gleich deutliche Wellenbewegungen. Das sind Muskelkontraktionen (Peristaltik). Sie sind notwendig, damit der Nahrungsbrei, der uns gerade umhüllt, überhaupt zum Magen befördert werden kann. Stopp, es wird eng, sehr eng sogar: Wir stehen vor dem Mageneingang. Hier zieht sich die Muskulatur so fest zusammen, dass ordnungsgemäss keine Magensäure in die Speiseröhre aufsteigen kann. Andernfalls würde die ätzende Magensäure ein sehr unangenehmes brennendes Aufstossen (Reflux) bewirken. Dieses Symptom wird Refluxkrankheit genannt und nach dem jeweiligen Grundübel behandelt.
Allmählich wird es wieder geräumiger, dafür aber stürmisch. Wer glaubt, sich in einer Waschmaschine zu befinden, liegt nicht ganz falsch. Hier im Magen wird der Nahrungsbrei zur Verkleinerung so richtig hin und her gepanscht und zusätzlich mit saurem Magensaft angereichert. Der pH-Wert des Safts liegt in nüchternem Zustand bei eineinhalb bis zwei. Im Magen herrscht also ein aggressives Säureklima. Nicht umsonst tragen wir unsere Schutzweste. Damit sich der Magen mit seiner ätzenden Substanz nicht selbst zerstört, ist er mit einer äusserst gut schützenden Magenschleimhaut umgeben. Aus der anfänglich festen Nahrung ist nach dem «Waschprozess» ein verdaulicher Speisebrei geworden. Der Pförtner, auch Pylorus genannt, am Ende des Magens, ist dafür verantwortlich, den Brei portioniert weiter in den Zwölffingerdarm abzugeben.
Aufgepasst, es wird sehr schlammig und, zugegeben, etwas eklig, darum bitte ich Sie, mir ins Darmboot zu folgen. Kapitän Brownie paddelt uns sicher und komfortabel durch die Gedärme. Schützen Sie sich mit der Maske im Exkursionsgepäck vor üblen Gasen.
Unsere erste Station ist der Zwölffingerdarm (Duodenum). Man nennt ihn so, weil er etwa zwölf Finger lang ist. Hier münden die grossen Verdauungsdrüsen Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ein. Er ist der erste der drei Hauptabschnitte des Dünndarms. Und schon sind wir im zweiten Abschnitt, dem Leerdarm (Jejunum). Es ist etwas makaber, aber sein Name rührt daher, dass er nach dem Tod meist leer ist. Nun folgt der dritte Abschnitt, der sogenannte Krummdarm (Ileum). Insgesamt hat der Dünndarm eine Länge von drei bis fünf Metern. Zusammen mit den drei oben genannten Drüsen leistet der gesamte Dünndarm wichtige Verdauungsarbeit und stellt Hormone und andere Botenstoffe zur Verfügung. Hier wird der saure Speisebrei neutralisiert und die Fettverdauung mittels Gallensaft in Gang gesetzt.
Spannend ist, dass die ganze Dünndarmschleimhaut wie eine Handorgel gefaltet und mit Zotten belegt ist. Würde man sie samt Zotten glatt auslegen, käme man auf eine Gesamtfläche von 400 bis 500 Quadratmetern. Unvorstellbar, nicht? Diese enorme Oberfläche dient der Aufnahme von essenziellen Nährstoffen, die zur lebensnotwendigen Ernährung der Körperzellen an das Transportmittel Blut abgegeben werden. Unsere Zellen sind ziemlich verfressen, ohne Nahrung würden sie kläglich eingehen. Sie brauchen täglich ihr Quantum an Nährstoffen, um ihre Funktionen ordnungsgemäss ausführen zu können.
Mein Tipp: Denken Sie öfter mal an sie, und tragen Sie zu ihrem Wohl bei, indem Sie sich gesund, ausgewogen und schmackhaft ernähren. Ihre Zellen werden es Ihnen gebührend danken.
Darmstrukturen besitzen wie alle anderen Organe eine Muskulatur. Es handelt sich um eine glatte (unwillkürliche, nicht beeinflussbare) Muskulatur, die den Speisebrei in rhythmischen Bewegungen (Peristaltik) sukzessive vorwärtsbefördert. Eine weitere wichtige Aufgabe des Dünndarms ist es, rund 80 Prozent Wasser aus der zersetzten Masse aufzunehmen. Das heisst, diese beginnt sich hier allmählich zu verdicken.
Übrigens: keine Angst vor den uniformierten Heerespolizisten, die uns so prüfend mustern. Sie gehören zur Körperarmee, sprich zum Immunsystem, und erkennen Fremdlinge, Viren oder Bakterien und sagen ihnen nötigenfalls den Kampf an (darmassoziiertes lymphatisches Gewebe). Ich habe ihnen unseren Besuch angekündigt, sie werden uns also nicht angreifen. Die Körperarmee lernen Sie später noch näher kennen.
Wir befinden uns nun am Ende des Dünndarms, also beim Übergang zum Dickdarm. Auf der rechten Seite machen wir eine sonderbare Bekanntschaft. Hier haust er, der oft gefürchtete «blinde» Darm mit seinem wurmartigen Fortsatz, der zwei bis zwanzig Zentimeter lang und circa sechs Millimeter breit sein kann. Im Volksmund nennt man ihn Blinddarm und spricht auch von Blinddarmentzündung (Appendizitis), wenn er in der rechten Unterbauchseite äusserst pikante Schmerzen verursacht! Tatsächlich ist es aber so, dass sich nicht der ganze Blinddarm, sondern lediglich der Wurmfortsatz entzündet. Die ursprüngliche Hauptaufgabe des Wurmfortsatzes liegt in der frühen Kindheit. Da war er nämlich Teil der Immunabwehr.
Wir erreichen den Dickdarm. Er ist dicker und mit rund einem Meter Länge deutlich kürzer als der Dünndarm. Er umgibt diesen mit seinen drei Teilen (aufsteigend, quer liegend, absteigend) wie ein Bilderrahmen. Anschliessend zum absteigenden Teil folgt der S-förmige Bereich (Sigmoid), dann der Mastdarm (Rektum) und schliesslich das Ende des Verdauungstrakts, das allseits bekannte After, das durchaus mal After-Work-Party feiern kann, nämlich dann, wenn es gemein juckt oder brennt. Der Dickdarm hat verschiedene Funktionen. Zum Beispiel entzieht er dem Nahrungsbrei noch mehr Wasser. Dies ist wichtig, sonst müssten wir uns ständig mit unliebsamen Durchfällen auseinandersetzen.
Besonders viel Aufmerksamkeit hat das im Dickdarm hausende Heer von guten Bakterien verdient, das ein bis zwei Kilogramm des Körpergewichts ausmachen kann. Sollten Sie gerade etwas zu viel auf der Waage haben und jetzt die Vermutung hegen … Stopp, die Darmbakterien trifft definitiv keine Schuld! Als sehr gute Freunde unseres Verdauungstrakts leisten sie wertvolle Arbeit. Der Grund für Ihre überschüssigen Pfunde muss woanders liegen. Mit diesen Bakterien besitzen wir ein wahrhaftiges Mikrobenimperium, bekannt als Darmflora. Sie verdaut den übrig gebliebenen Rest unserer Nahrung sehr effizient und sorgt gleichzeitig für ein stimmiges Immunsystem. Die Bakterien sind in der Lage, böse Angreifer zu killen und unschädlich für unseren Organismus zu machen.
Das Darmimmunsystem wird laufend erforscht, und die Ergebnisse sind interessant. So weiss man zum Beispiel, dass die Darmflora Einfluss auf unsere Stimmung hat, also mit Johnny aus der Gute-Laune-Bar verknüpft sein muss. Denn Darmbakterien regulieren unter anderem den Cortisolspiegel. Wenn das Stresshormon Cortisol im Übermass vorhanden ist, setzt das Johnny zu: Er muss diesen Stoff im Auftrag der Hormon AG verwenden, und hat er zu viel davon, ist er gezwungen, Cocktails zu mixen, die Ihnen nicht behagen. Im Übrigen glaubt man zu wissen, dass gute Darmbakterien Lebensmittelallergien in Schach halten können oder zumindest eine gute Basis dafür sind, dass sie gar nicht erst auftreten.
Mein Tipp: Versuchen Sie, Stressfaktoren möglichst gering zu halten. Stress ist Gift für die Darmflora, ja ein wahrhaftiger Killer. Reduziert sich die Belegschaft der guten Bakterien, ist das Risiko von Entzündungen viel grösser. Giftstoffe, Allergieauslöser und andere Krankheitserreger können sich so einfacher im Blutstrom, aber auch in den Nervenleitbahnen verbreiten. Dem Teufelskreis von Krankheiten und psychischen Problemen wird so Nährboden geboten.
Sehr wichtig für die Darmflora sind genügend Ballaststoffe, also faserreiche, pflanzliche Ernährung. Die Bakterien erhalten damit Arbeit. Mit der Zersetzung von Fasern produziert ein Teil der Bakterien unter anderem wertvolle kurzkettige Fettsäuren, die wiederum wichtige Bausteine für das Immunsystems sind. Es ist ratsam, zu stark industriell verarbeitete Nahrung zu umgehen. Denn sie lässt die nützlichen Bakterien kaum prosperieren.
Ein wahrer Graus für Bakterien ist die Infektionswaffe Antibiotika. Sollten Sie sie benötigen, bauen Sie Ihre Darmflora direkt nach der Behandlung wieder mit guten Darmbakterien auf. Produkte dafür gibt es genügend. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten. Sie finden solche Hilfsmittel in Form von schmackhaften Probiotika auch im Fachhandel, allerdings in weniger konzentrierter Form und leider begleitet von künstlichen Zusatzstoffen. Trotzdem, besser als gar nichts!
Weiter geht es in den S-förmigen Abschnitt des Dickdarms (Sigmoid), der sich wie ein Schwanenhals zeigt. Seine Funktion ist es, den Stuhl weiter einzudicken und durch Muskelkontraktionen portioniert in das letzte Stück des Dickdarms, den Mastdarm, zu befördern. Die im Volksmund bekannte unangenehme und schmerzhafte Zottenentzündung (Divertikulitis) findet sich meist in diesem S-förmigen Abschnitt.
Im Mastdarm (Rektum) wird der Stuhl gesammelt, bis sein Volumen den Grenzwert so übersteigt, dass es zum Stuhldrang kommt. Der Stuhl wird zu guter Letzt via After ausgeschieden. Eine bewegte Reise von Mund bis After und ein Happy End für die Nahrung. Ist es nicht eindrücklich, wie sich das Ganze in Aussehen und Geruch verändert hat? Applaus dem Verdauungstrakt für diese Meisterleistung!
Gönnen wir uns eine kleine (Ver-)Schnaufpause, bevor wir in den Lift steigen und K drücken.