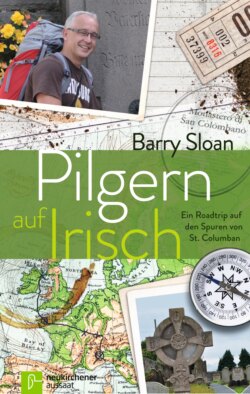Читать книгу Pilgern auf Irisch - Barry Sloan - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. SEGEL SETZEN IN BANGOR
ОглавлениеIch habe mich entschieden, die kurze Strecke von Bangor nach Belfast mit dem Zug zurückzulegen. Nachdem der Zug aus dem Hauptbahnhof ausgefahren ist, passieren wir die Odyssey Arena, die Heimat der Belfast Giants, des einzigen professionellen Eishockeyteams in Nordirland. Keine zwei Kilometer weiter gibt es weitere Giganten von Ulster zu sehen: zwei riesige Kräne mit Kultcharakter, die die Skyline von Belfast dominieren. Sie gehören zu Harland and Wolf, früher die größte Werft der Welt und Wiege der Titanic (Als sie hier ablegte, war sie in Ordnung!). Dann kommt der George Best City Airport, benannt nach einem Typen von hier, der später einer der besten Fußballer der Welt wurde (Falls Sie mir nicht glauben, fragen Sie Brasiliens Pelé!). Der Zug fährt weiter in Richtung Bangor, vorbei an Luxushäusern und schicken Kleinstädten an der »Goldküste« der Bucht von Belfast, die ihren Namen völlig zu Recht trägt.
Man kann sich leicht vorstellen, warum Menschen sich hier niederlassen möchten. Der heilige Patrick sah das offensichtlich auch so. Der Legende nach kamen Patrick und seine Gefährten eines Tages in ein Tal, um sich auszuruhen. Plötzlich wurde das Tal von einer Schar Engel erleuchtet und ein himmlischer Chor sang zur Ehre Gottes. Patrick nannte den Ort Vallis Angelorum. Später wurde dort, im »Tal der Engel«, ein heiliger Ort errichtet, der Irland als das »Land der Heiligen und Gelehrten« bekannt machen sollte. Dieser heilige Ort war Bangor, eine klösterliche Gemeinschaft, gegründet von St. Comgall im Jahr 588.
Während ich aus dem Fenster schaue, wandern meine Gedanken zurück zu dem, was ich in Jonathan Bardons hervorragendem Buch A History of Ulster gelesen habe, als ich mich auf mein Columban-Abenteuer vorbereitete. Nur dadurch konnte ich verstehen, warum Columban und die anderen Mönche von Bangor in der Lage waren, das zu tun, was für einen Iren das Allerschwerste ist – schwerer, als das eigene Leben zu opfern –, nämlich Irland zu verlassen. Ich stellte fest, dass es den Missionaren aus Irland gelungen war, Klöster zu gründen, aus denen bald die europäischen Städte Auxerre, Luxeuil, Bobbio, Würzburg, Regensburg, St. Gallen und Wien entstehen sollten, um nur einige zu nennen. Das Römische Reich – oder dessen Abwesenheit in Irland – und sein Untergang spielen in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle. Die Faszination liegt im Detail.
Julius Cäsar marschierte im Jahr 55 vor Christus in Britannien ein und erweiterte damit die Grenzen des Römischen Reiches bis an die westlichen Ränder Europas. Gnaeus Iulius Agricola, damals Statthalter Britanniens und Kommandeur der XX. Legion sowie der Flottille in der Irischen See, hatte sich im Jahr 82 nach Christus bereit gemacht, die Segel in Richtung Ulster zu setzen, um die Insel Irland (Hibernia) für das Reich einzunehmen. Was allerdings nie geschah. Eine in Galloway stationierte Legion deutscher Rekruten meuterte, so dass der römische Kaiser Domitian gezwungen war, seinen Statthalter nach Norden zu senden, um dort den Aufstand niederzuschlagen. Als der Statthalter Agricola zurückkehrte, zeigten sich erste Risse im Römischen Reich und die Römer waren gezwungen, sich bis hinter den Hadrianswall zurückzuziehen, wo sie mit ganz anderen Dingen als einer Invasion in Ulster beschäftigt waren.
Den Deutschen haben wir es also zu verdanken, dass Irland von den Römern nicht besiegt wurde – und dass wir weitere neunzehnhundert Jahre warten mussten, bis wir vernünftige, gerade Straßen bekamen.
Im vierten und fünften Jahrhundert wurde das Römische Reich von deutschsprachigen Völkern aus Mittel- und Nordeuropa angegriffen. Das führte dazu, dass immer mehr Legionen von den Außenposten des Imperiums abgezogen wurden, um Rom zu verteidigen. Das römische Britannien hingegen wurde barbarischen Eroberern als Beute überlassen. Die Pikten griffen aus dem Norden an, die Engländer aus dem Osten, die Iren aus dem Westen. Plündernde irische Stämme brachten Schätze und Gefangene aus dem römischen Britannien mit nach Irland. Einer dieser Gefangenen war ein junger Mann namens Patricius. Nachdem die Römer nicht bis Irland gekommen waren, sorgte er zusammen mit anderen dafür, dass zumindest ihre Religion es schaffte.
Als Sklave hütete Patrick sechs Jahre lang Schafe in einer Gegend, die in Nordirland heute als County Antrim bekannt ist. Er litt ständig unter Kälte und Hunger, wurde aber bei allem durch seinen christlichen Glauben getröstet. Eines Tages gelang ihm auf einem Piratenschiff die Flucht und er kehrte zurück in sein Heimatland Britannien. Aber Gott, der offensichtlich Sinn für Humor hat, erschien Patrick im Traum und rief ihn zurück nach Irland. Dieses Mal sollte er als Missionar dort hingehen, um seinen ehemaligen Entführern den christlichen Glauben zu bringen. Wenn ich daran denke, wie beide Seiten der religiösen Kluft in Nordirland sich heute um den heiligen Patrick streiten und darüber, auf welcher Seite er stehen würde, könnte ich verzweifeln. Ich stelle mir oft vor, wie großartig es wäre, wenn noch mehr Menschen aus Ulster ihren Glauben so erfahren und leben würden, wie Patrick es getan hat. Ein Glaube, der nicht nur dazu befähigt, nach vorn zu blicken und weiterzugehen, sondern auch dazu, zurückzugehen und gerade denen zu dienen, die einem so viel Schmerz und Verletzung zugefügt haben. Denn das ist wahre Bekehrung.
Patrick wurde Mönch und evangelisierte Ulster etwa in der Mitte des fünften Jahrhunderts. Besonders erfolgreich war er in der herrschenden Klasse. Die gälischen Könige – es gab Hunderte von ihnen – spendeten der Kirche oftmals Land und wurden Patrone der neugegründeten Klöster, die nun in ganz Irland aus dem Boden schossen. Einer dieser monastischen Orte war Bangor an der Nordostküste der Insel.
Wie so viele andere begann auch dieses Kloster, aus dem später eine Stadt werden sollte, mit einigen wenigen Mönchen, die in einfachen Bienenkorbhütten lebten. Die Hütten waren um eine bescheidene Kirche gruppiert, daneben gab es weitere Gebäude, die der Landwirtschaft oder dem Handwerk dienten, dazu Wasch- oder Gästehäuser. Da es in Irland bis in das neunte Jahrhundert keine Dörfer oder Städte gab, wurden die Klosteranlagen zu religiösen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentren. Bangor war keine Ausnahme. Im sechsten Jahrhundert war als Zentrum der Lehre und des christlichen Zeugnisses nur Iona vergleichbar – gegründet von dem anderen großen irischen Missionspionier, St. Columcille von Derry.
Von einer Gruppe Teenager werde ich unsanft ins einundzwanzigste Jahrhundert zurückgeholt. Mit ihrer unflätigen Sprache und ihrem schlechtem Benehmen terrorisieren sie den ganzen Wagen. Leider ist das Land der Heiligen und Gelehrten nicht frei von Sündern und schlichten Gemütern. Als der Zug in den Bahnhof von Bangor einfährt, beobachte ich die Jugendlichen, die in ihren teuren Fußballtrikots und mit den neuesten Smartphones eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Beim Aussteigen spreche ich ein stilles Gebet für sie, für ihre Eltern und auch für mich selbst. Möge Gott uns alle beständig erkennen lassen, dass die wichtigsten Dinge im Leben eben keine Dinge sind.
Ich verlasse den Bahnhof und gehe die Abbey Street hinauf. Dort stürzen von allen Seiten Versuchungen auf mich ein, und ich muss kämpfen, um ihnen zu widerstehen: Fish-and-Chips-Buden. Einer der Nachteile Deutschlands ist, dass man sich in einem Land befindet, das der Fisch-und-Pommes-Gott vergessen hat. Deshalb übertreibe ich es immer ein bisschen, wenn ich meine Familie in Nordirland besuche. In einem Moment der Schwäche bleibe ich vor »Captain Cod« stehen und quäle mich mit Fantasien von Frikadellen in Bierteig und frittierten Zwiebelringen mit jeder Menge Salz und Essig. Das Fleisch ist willig, aber zum Glück ist der Geist nicht schwach, und so bin ich bald wieder auf dem Weg, die geistliche Heimat Columbans vor Augen, nur ein paar hundert Meter weiter die Straße hinunter.
Das Erste, was mir an Bangor Abbey ins Auge fällt, ist der historische Friedhof. Ich lebe seit dreizehn Jahren in Deutschland und hatte vergessen, wie alt irische Gräber und Grabsteine sein können. In Deutschland gibt es einige Dauergräber, aber die allermeisten Grabstellen sind auf vorübergehende Nutzung angelegt und werden nach nur zwanzig Jahren, wenn (vermutlich?) alle sterblichen Überreste vollständig zerfallen sind, »abgeräumt« und für die Wiederverwendung vorbereitet.
Ich habe mich oft gefragt, woher man so genau weiß, wann alle sterblichen Überreste zerfallen sind. Wird das ausprobiert? Muss man dafür womöglich jedes Jahr eine Bodenprobe entnehmen? Ist der biologische Abbauprozess eines menschlichen Körpers eine exakte Wissenschaft mit bewiesenen Formeln, durch die sich genau bestimmen lässt, wie lang eine bestimmte gegebene Masse menschlicher Materie braucht, um zu zerfallen? Stimmt: V = Z x M, wobei V die Verwesung, Z die Zeit und M die Masse ist? Was ist mit sehr großen Leuten? Ist es bei denen anders? Und wie ist es mit der Kleidung, die die Verstorbenen bei ihrem Begräbnis trugen? Manche synthetischen Fasern zerfallen mit Sicherheit erst nach Jahrtausenden.
Die ganze Angelegenheit verwirrt mich. Als ich das erste Mal auf einem deutschen Friedhof war, fiel mir auf, dass alle dort Begrabenen innerhalb der letzten zwanzig Jahre verstorben waren. Warum war niemand davor gestorben? Vielleicht lag es daran, dass es diesen Friedhof erst seit zwanzig Jahren gab? Aber das konnte es nicht sein. Ich war auf anderen Friedhöfen und empfand es als ausgesprochen sonderbar, dass auch dort alle bis auf den letzten Mann innerhalb der letzten zwanzig Jahre gestorben waren. Wo waren all die anderen begraben? Hatte ich irgendetwas verpasst? Hatte ich Millionen von Gräbern übersehen?
Vielleicht hat das deutsche System der Wiederverwendung von Grabstellen etwas mit dem Umstand zu tun, dass es fast 82 Millionen Deutsche gibt. Die gesamte Insel Irland wird nur von sechs Millionen Menschen bewohnt – offensichtlich haben wir mehr Platz. Anders sähe es allerdings aus, wenn wir Kühe beerdigen würden.
Wie auch immer – je länger ich darüber nachdenke, desto überzeugter bin ich davon, dass es mehr mit dem deutschen Sinn für Ordnung und Genauigkeit zu tun hat. Deutsche Friedhöfe werden peinlich genau gepflegt und in tadellosem Zustand gehalten. Ich glaube, die deutsche Psyche würde die überwachsenen Friedhöfen voll schiefer, unleserlicher Grabsteine, die wie Kraut und Rüben dastehen, einfach nicht verkraften.
Die historische Begräbnisstätte am Kloster von Bangor – ich sage Begräbnisstätte, weil »Friedhof« an dieser Stelle einfach zu modern klingen würde – ist definitiv nicht deutsch. Das Gras ist lang, kurz, ungemäht oder nur teilweise geschnitten, gepflegt oder wild, je nachdem, wo man steht; im Großen und Ganzen sind die Grabsteine älter als zwanzig Jahre, und manche von ihnen gehen sogar auf das achtzehnte Jahrhundert zurück. Was zur Folge hat, dass sie einsinken, sich neigen oder man ihnen insgesamt die Auswirkungen von dreihundert Jahren Wind und Regen in Ulster ansieht – von den etwa hundert gefährlichen Jahren seit Erfindung des Rasenmähers gar nicht zu sprechen.
Dies ist ein besonderer Ort. Wie jeder Friedhof ist es ein heiliger Ort, ein Ort voller Vergangenheit. Jeder Grabstein erzählt seine eigene Geschichte, in jedem Grab liegt ein Verwandter, ein geliebter Mensch, jemand, den Gott liebt. Ich nehme mir Zeit, gehe respektvoll an den Gräbern, an den Kreuzen und Grabsteinen vorbei und bleibe stehen, um einige der alten englischen Inschriften auf den verwitterten Steinplatten zu entziffern. Einer der Verse berührt mich. Er steht auf dem Grabstein eines jungen Seemanns, der im Jahr 1829 im Alter von fünfundzwanzig Jahren vor der Küste Jamaikas ertrunken ist:
Doch da war Hoffnung in des lieben Seemanns Tod;
In seiner Jugend lernt’ er den Erlöser lieben.
Ihn rief er an in seines letzten Atemzuges Not,
Dass er ihn aufnehm’ in des Vaters Haus in Frieden.
Dieser Vers, den die Eltern des jungen Mannes ausgesucht haben, spricht von der Hoffnung im Angesicht des Todes – eine zentrale und kraftvolle Lehre des Christentums. Als Pastor habe ich selbst viele Beerdigungen gehalten und weiß, wie tröstlich solche Worte für gläubige Menschen sind. Sie können im wahrsten Sinne des Wortes den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Die Tatsache, dass sich die Christen im Irland des 6. Jahrhunderts dessen bewusst waren, zeugt davon, dass immer mehr hungrige Seelen zum Glauben an den auferstandenen Christus fanden und ein neues Leben begannen. Eine dieser hungrigen Seelen war ein Soldat aus Magheramourne im County Antrim, der sich zum Christentum bekehrte und später ein ordinierter Diakon und Priester wurde. Sein Name war Comgall, Gründungsabt von Bangor Abbey.
Comgall scharte in Bangor eine Gruppe von Mönchen um sich, deren vorbildliches Leben und wissenschaftliche Errungenschaften in die Geschichte eingehen sollten. Als Comgall starb, war er Abt über mehr als 3000 Mönche. Bangor Mór, »das Große Bangor«, war einer der Fixsterne für das keltische Christentum. Fast dreihundert Jahre lang war Bangor eine der wichtigsten Klosterschulen in Europa.
Das klösterliche Leben unter Comgall war hart, geprägt durch strenge Regeln für das Gebet und das Fasten. Während seiner Zeit in Bangor müssen allerdings entweder die Gebete wirksamer oder das Fasten weniger extrem gewesen sein als zuvor, denn niemand starb dort. In Comgalls voriger klösterlicher Gemeinschaft am Lough Erne war das anders gewesen: Sieben Mönche waren dort wegen der Strenge seiner klösterlichen Disziplin verstorben! Dennoch war die Nahrung der Mönche in Bangor karg und einfach, selbst Milch wurde als Luxus angesehen. Es gab am Tag nur eine Mahlzeit, die am Abend und schweigend eingenommen wurde. Wenn man es sich recht überlegt: Hätte es damals schon Fish and Chips und frittierte Zwiebelringe gegeben, hätten sie Bangor womöglich nie verlassen.
Die Gottesdienste waren ein zentraler Bestandteil der Gemeinschaft. Es gab fünf am Tag und drei in der Nacht, und bei allen wurde die Teilnahme peinlich genau überwacht. Das wirft ein ganz neues Licht auf die frühen Gottesdienstzeiten in Deutschland. Als ich meinen Dienst in Deutschland gerade begonnen hatte, hielt eine meiner Gemeinden ihren sonntäglichen Gottesdienst um 8:30 Uhr ab. Aus Irland war ich daran gewöhnt, dass die Kirche um 11 Uhr oder 11:30 Uhr begann. Deshalb bezeichnete ich diesen Gottesdienst – nur halb im Scherz – als Nachtschicht.
Ich weiß, dass es viele Frühaufsteher gibt, die vom ersten Morgengrauen an hellwach und vergnügt sind. Aber ich gehöre nicht dazu. Meine Stimme ist vor 10 Uhr normalerweise nicht als menschlich zu erkennen, deshalb bin ich immer wieder erstaunt darüber, wie gut wir in der Gemeinde singen – auch im 8:30-Uhr-Gottesdienst.
Vielleicht ist eine Erklärung dafür, dass Deutsche, ganz besonders Ostdeutsche, den Tag einfach wesentlich früher beginnen als wir Nordiren. Ich lernte das in meiner allerersten Woche in Deutschland, als ich um 6:30 Uhr geweckt wurde, weil jemand an unserer Wohnungstür klingelte. Ich war mir sicher, dass es ein Notfall sein musste. Bestimmt war gerade ein Unfall passiert und ich wurde im Krankenhaus gebraucht; oder jemand lag im Sterben und die Familie wünschte, dass der Pastor ans Sterbebett kam. Selbst der Anblick eines Feuerwehrmanns, der das Gebäude evakuiert, hätte mich nicht so sehr überrascht wie das, was als Nächstes passierte. Noch halb schlafend, nur mit Boxershorts und T-Shirt bekleidet, öffnete ich die Tür und wurde von unserem Klempner begrüßt. Er war vorbeigekommen, um unsere Waschmaschine anzuschließen. Morgens um halb sieben! Ich habe ihn angestarrt, als käme er von einem anderen Planeten.
Auch wenn es zu den Aufgaben in meiner neuen deutschen Gemeinde gehörte, um halb neun in der Früh einen Gottesdienst zu halten, hatte ich zumindest – anders als die Mönche von Bangor – keine fünf Gottesdienste am Tag und zusätzliche drei in der Nacht. Mir wird klar, dass alles relativ ist, und deshalb bin ich dankbar und werde mich in Zukunft nicht mehr über meine Nachtschichten beklagen.
Das Leben der Mönche von Bangor war nicht nur geprägt von einer überdurchschnittlich hohen Anzahl täglicher Andachten und Gottesdienste, sondern noch mehr durch deren Qualität und Intensität. Bangor war berühmt für seine Musik und das antiphonische Singen, eine Art abwechselnder Gesang, bei dem einige Mönche ein paar Verse oder einen Abschnitt sangen und andere darauf antworteten. Dieser Gesangsdienst fand rund um die Uhr statt. Die Chöre wechselten einander ohne Unterbrechung ab, so dass der Gesang das ganze Jahr nicht aufhörte.
Einige der Kirchenlieder, Gebete und Choräle, die in Bangor gesungen wurden, sind in einem Psalter festgehalten, einem Gesangbuch, das als Bangor Antiphonary bekannt wurde. Es stammt etwa aus dem Jahr 680. Dieses frühe Feiert Jesus mit Gebeten und Liedern wurde vermutlich im neunten Jahrhundert von Bangor bis nach Bobbio in Italien getragen, um seine Zerstörung durch die Wikinger zu verhindern, die zu dieser Zeit Ulster plünderten. Heute wird es in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand aufbewahrt (Anmerkung für Fußballfans: nicht weit entfernt vom San-Siro-Stadion).
Ich gehe weiter, durch den Haupteingang des Klosters. Dort begegne ich zwei freundlichen und hilfsbereiten älteren Damen, ehrenamtlichen Fremdenführerinnen, die mich begrüßen und bemüht sind, meine vielen Fragen zu beantworten. Das ursprüngliche Kloster aus der Zeit Comgalls steht leider nicht mehr, da es im achten und neunten Jahrhundert mehrmals durch Wikinger geplündert wurde. Im Jahr 1617 wurde das heutige Kloster restauriert. Teile des Gebäudes gehen aber bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Im Foyer hängt eine vollständige Aufzeichnung sämtlicher Äbte und Rektoren, die dem Kloster bis ins Jahr 1960 dienten. Das ist wirklich bemerkenswert – von den Gründungstagen Comgalls über die Zeiten, in denen es als Augustiner- und Franziskanerkloster genutzt wurde, bis hin zur Reformation, während der das Kloster zu einer protestantischen Kirche wurde.
Ich stehe im hinteren Teil der Kirche und schaue über das Chorgestühl hinweg in den Altarraum. Zum ersten Mal kann ich einen Blick auf die Heiligen von Bangor werfen, die auf der Ostwand aufgemalt sind (in Kirchen ist das immer die Wand hinter dem Altarraum, auch wenn sie nicht nach Osten weist, was sie aber, nebenbei bemerkt, in Bangor Abbey tut). Das dramatische Gemälde stellt die Himmelfahrt Christi dar, die von Comgall, Columban und Gallus bezeugt wird, den drei Dienern Christi, deren missionarischer Geist den Kurs der europäischen Geschichte so drastisch veränderte.
Genau dieser missionarische Geist von Bangor ist es, der mich interessiert. Columban und Gallus wurden im sechsten Jahrhundert von Bangor als Missionare ausgesandt und brachten das Evangelium und Gottes Liebe unter anderem den Alemannen, den Deutschen. Heute, vierzehnhundert Jahre später, arbeitet im deutschen Missionsfeld ein anderer Missionar oder, wie es in der methodistischen Kirche etwas genauer heißt, ein Missionspartner. Ich bin ein Partner in Sachen Mission. Das Wort »Partner« betont den gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe. Es ist eine wechselseitige Beziehung, ein Geben und Empfangen in beiden Richtungen, bei dem beide Seiten die jeweils andere brauchen, um sich gegenseitig zu bereichern. Das Konzept des »Partners« versucht, die Fehler der kolonialen Vergangenheit zu vermeiden, in der eine überhebliche westliche Kirche oftmals ahnungslosen Völkern ihre Kultur und Lebensweise aufzwang.
Heute arbeite ich als Missionspartner für die Evangelisch-methodistische Kirche in der Stadt Chemnitz, in einem Teil Deutschlands, der früher zur Deutschen Demokratischen Republik gehörte. Während der vierzigjährigen Herrschaft des Sozialismus in der DDR, die mit dem Mauerfall (1989) und der Wiedervereinigung Deutschlands (1990) endete, hatte die christliche Kirche es nicht leicht. Bis heute ist das Erbe des DDR-Regimes spürbar. Fast 90% der Bevölkerung haben in diesem Teil Deutschlands nicht nur keinerlei Interesse an Gott oder der Kirche, sie sind sogar überzeugte und bekennende Atheisten.
In diesen geistlichen und religiösen Kontext, der ganz anders war als in meiner Heimat Nordirland, kam ich 1998, als Gott mich berief, in Deutschland zu dienen. Ich stelle mir vor, dass es für die anderen Missionare, Columban und seine zwölf Gefährten, die Bangor im frühen Mittelalter verließen, ähnlich gewesen sein muss. Auch sie verließen ein bequemes, vertrautes geistliches Umfeld und machten sich auf den Weg in das Unbekannte, in eine Welt, die größtenteils atheistisch und desinteressiert war, wenn nicht sogar feindselig.
Ich gehe um das Kloster herum und mir fällt die bronzene Gedenktafel in der Nähe des Haupteingangs auf. Sie erinnert an die missionarische Reise des Columban und seiner Mönche von Bangor. Drei Worte stehen auf der Plakette: Bangor, Luxeuil, Bobbio. Es sind die Namen der drei Städte, in denen Columban wichtige Klöster gründete, die im frühmittelalterlichen Europa so einflussreich werden sollten. Bis vor kurzem war mir von diesen drei Städten nur eine ein Begriff: Bangor. Aber durch meine vorbereitende Lektüre weiß ich, dass Luxeuil in Frankreich liegt und Bobbio in Italien. Ich weiß auch, dass meine Reise mich zu identischen bronzenen Gedenktafeln führen wird, die an den Eingängen der heutigen Klöster dieser Städte angebracht sind.
Im für den Sommer von Ulster so typischen Nieselregen mache ich noch ein letztes Foto des historischen Klosters, von seinen Steinmauern, deren ganz unterschiedliche Abschnitte jeweils ein eigenes Kapitel der jahrhundertealten Geschichte Bangors erzählen. Die große Uhr am Glockenturm erinnert mich an die Gegenwart und an die Reise, die vor mir liegt – dieselbe Reise, die andere mehr als vierzehnhundert Jahre vor mir unternommen haben. Auf dem Weg nach draußen gehe ich über den faszinierenden alten Friedhof des Klosters mit den sterblichen Überresten Heiliger und Sünder vergangener Zeiten. Mir fallen die Worte des Apostels Paulus ein: »Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt!« (Hebräer 12,1, Gute Nachricht Bibel).
Die nächste Station des vor mir liegenden Wettlaufs wird Saint-Coulomb sein, ein kleines Dorf an der Küste Nordfrankreichs, an dessen Strand vor vierzehnhundert Jahren eine kleine Gruppe Mönche aus Bangor ihre lederbezogenen Boote an Land zog, um zum ersten Mal den Fuß auf europäisches Festland zu setzen.