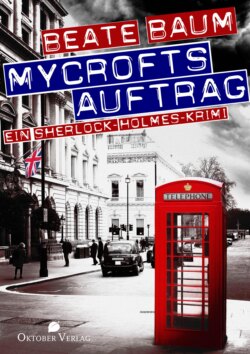Читать книгу Mycrofts Auftrag - Beate Baum - Страница 5
Оглавление1. Kapitel
Den hageren Mann mit dem seltsamen Hut, der Pelerine und der Pfeife hatte er vermisst! Absichtlich hatte John den Hauptausgang des U-Bahnhofs gewählt, obwohl der seitliche ihn schneller zu seinem Ziel geführt hätte. Aber er wollte einen Blick auf die geschäftige Marylebone Road werfen – und auf dieses Denkmal.
Um das ausladende Gebäude herum ging es rechts in die Baker Street hinein; bis zur Nummer 221 B waren es nur gut 100 Meter. Wie oft war er früher dieses Stück gelaufen! Immer dann, wenn er allein unterwegs war, auf dem Weg zu einem Vertretungsjob in einer Klinik oder Arztpraxis, einem Einkauf im Supermarkt, einer Verabredung. Mit Sherlock war das Verkehrsmittel der Wahl nahezu immer das Taxi gewesen. Sherlock war zu ungeduldig für die gute alte Tube. Eine Anzeige wie »Metropolitan Linie 5 Minuten« konnte ihn in den Wahnsinn treiben, auch wenn er bei logischer Überlegung häufig zugeben musste, dass es schneller gegangen wäre, als sich mit einem Taxi in den Londoner Stau zu begeben. Auch der genialste Detektiv aller Zeiten war eben kein durch und durch rationales Wesen.
Seit dem unverhofften Wiederauftauchen des Freundes vor drei Wochen war John erst einmal wieder in der Wohnung gewesen. Nach wie vor tat er sich schwer mit der Art und Weise, wie Sherlock in sein Gespräch mit dem Church-Street-Buchhändler hineingeplatzt war: überzeugt, dass John ihm um den Hals fallen würde vor Freude – nein, das doch eher nicht, Sherlock Holmes mochte keine Berührungen und in den zwei Jahren ihres Zusammenlebens hatte es niemals so etwas wie eine Umarmung gegeben – und ihm das Vortäuschen seines Todes auf der Stelle vergeben würde. Als wenn er die drei Jahre Trauer einfach vergessen könnte, vor allem aber es akzeptieren, dass Sherlock andere Menschen eingeweiht hatte, ihm jedoch in all diesen Tagen, Wochen und Monaten kein einziges Zeichen hatte zukommen lassen, dass er noch unter den Lebenden weilte. Keinen noch so winzigen Hinweis.
Wieder fühlte John die Wut in sich aufsteigen, als er den bronzenen Türklopfer betätigte. Es war spät, bereits kurz vor elf, nach dem hellen Sommertag war die Dunkelheit hereingebrochen, und die kleine, zierliche Mrs Hudson kam in einem Bademantel an die Tür.
»John!« Der misstrauische Ausdruck verschwand aus dem Gesicht der Hausbesitzerin, sobald sie ihn erkannte. »Das ist ja eine nette Überraschung. Sind Sie mit Sherlock verabredet? Ich hätte gedacht, er schläft schon, ich habe seit einiger Zeit keine Geräusche von oben gehört.«
»Nein, wir …«, er räusperte sich. »Das ist wirklich so etwas wie ein Überraschungsbesuch. Mary, also meine Verlobte, wurde von einer Freundin angerufen, der es schlecht geht, und da dachte ich …« Es war eine blöde Idee gewesen. Nun tat auch er so, als könnte er nach all der Zeit einfach wieder in das alte Leben eintauchen.
»Da dachten Sie, Sie könnten auch einen Freund besuchen. Natürlich!« Die alte Dame öffnete die Haustür noch ein Stück weiter. »Kommen Sie.«
John war froh, dass sie ihm die Erklärung ersparte, wie absurd lange die Fahrt von Hounslow, wo er seit einigen Monaten mit Mary lebte, bis in die Innenstadt dauerte. Es war schön gewesen, hier in Marylebone zu wohnen, dachte er, während er die steile Treppe hochstieg. Mittendrin in der pulsierenden Stadt.
In dem großen Wohnraum, den man direkt vom Hausflur aus betrat, war kein Licht eingeschaltet. Vermutlich hatte Mrs Hudson recht und Sherlock schlief bereits. Bei ihm wusste man nie, in welchem Rhythmus er gerade lebte. Als sie zusammenwohnten, war er manchmal schon vor den Zehn-Uhr-Nachrichten zu Bett gegangen, dann wieder erst im Morgengrauen. Wie auch immer, John würde nicht an seine Schlafzimmertür klopfen. Wenn Sherlock nicht hier oder in der angrenzenden Küche war, würde er sich wieder auf den Rückweg in den Vorort begeben.
Erst als seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah er, dass der Detektiv in seinem gewohnten Sessel saß. Nein, hing. Die langen, dünnen Beine in Pyjamahosen ausgestreckt, der Oberkörper verdreht auf der Seitenlehne liegend, der Kopf vornübergesackt, sodass nur die dunklen Haare zu sehen waren. Der linke Ärmel seines burgunderroten Hausmantels war hochgeschoben und in der Armbeuge steckte eine Spritze.
Mit zwei großen Schritten erreichte John den Sessel. »Sherlock!« Vorsichtig zog er die Nadel aus der Vene, registrierte trotz des schwachen Lichts die vielen Einstichstellen, hob den Kopf des Freundes an.
Der gab ein Geräusch von sich und öffnete die Augen einen Spalt weit. »John?«, murmelte er.
Er war bei Bewusstsein. John schaltete in den Arzt-Modus. Zwei Jahre hatte er in der Notaufnahme gearbeitet, er wusste, was zu tun war. Der Puls war sehr schwach, aber tastbar. Die Augen reagierten auf das Licht, das er mit Hilfe der Standleuchte in der Ecke in sie hineinfallen ließ, wenn auch die Pupillen kaum sichtbar waren.
Es war nicht lebensbedrohlich, sie brauchten keinen Krankenwagen, aber professionelle Unterstützung.
»Hoch mir dir.« Ohne einen Gedanken an Kleidung oder Schuhe zu verschwenden, schleifte er den jüngeren Mann aus der Wohnung und an der erschrocken im Flur auftauchenden Mrs Hudson vorbei auf die Straße.
*
»Wo sind wir?« Erst in der Pathologie des St Bartholomew’s Hospitals schien Sherlock seine Umwelt wieder wahrzunehmen.
»Da, wo Sie eines Tages als Leiche auf meinem Tisch liegen werden, wenn Sie so weitermachen«, sagte Ethel Schafter, deren deutscher Akzent in der Erregung stärker zu hören war als sonst. »Hier!« Mit einer brüsken Bewegung hielt sie Sherlock einen Plastikbecher hin. »Urinprobe.«
Der erste heftige Rausch war vorbei und John konnte förmlich sehen, wie Sherlocks gewohntes Selbstbewusstsein zurückkehrte, als er sich mit einem noch etwas gezwungen charmanten Lächeln an ihn wandte. »Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich leide unter Schlafstörungen, deswegen die Selbstmedikation.«
John verkniff sich eine Bemerkung. Er würde dem Freund jetzt keinen Vortrag halten; nichts davon würde bei ihm ankommen. »Keine Diskussion«, sagte er und deutete auf den Becher. Er war froh, dass die attraktive Kollegin in der Abgeschiedenheit der Pathologie die Untersuchung vornahm. Im Charing Cross Hospital, wo er arbeitete, hätte sein Auftauchen mit Sherlock Holmes in diesem Zustand bestimmt für Aufsehen gesorgt.
Sherlock seufzte pathetisch auf, nahm Ethel das Gefäß ab und verschwand in Richtung WC. Nach einem kurzen Moment folgte John ihm. Wenngleich es äußerst unwahrscheinlich war, dass Sherlock eine Möglichkeit fand, in der Pathologie-Toilette des Barts seinen Urin auszutauschen oder zu verändern, wollte er lieber auf Nummer sicher gehen.
Sherlocks ironisches Grinsen, als er ihn bemerkte, zeigte, dass er seine Gedankengänge nachvollzogen hatte.
»Und der Ausbau des Dachstuhls gestaltet sich also schwieriger als erwartet?«, fragte er in lockerem Plauderton, während Ethel die Urinprobe einem ersten Test unterzog.
»Das Spiel spielen wir jetzt nicht!«, gab John zurück, auch wenn er gern gewusst hätte, woher diese Schlussfolgerung kam. Er war sich sicher, dass auch Mary Sherlock nichts von ihren Plänen erzählt hatte, das winzige Reihenhaus auszubauen.
»Gut, womit wollen wir uns dann die Zeit vertreiben?« Der Freund lehnte an einer der Arbeitsflächen, einen bloßen Fuß an der Wade des anderen Beins hochgezogen.
Auf den Fliesen war es zu kalt, dachte John. Laut sagte er: »Also das ist es wieder, die Langeweile? Verdammt, warum hast du mich nicht angerufen?« Er wusste, dass sich der Detektiv früher in Phasen ohne interessante Fälle durch Drogen abgelenkt hatte. Er hatte damit aufgehört, als sie zusammenwohnten und er sich die spannendsten Verbrechen zur Aufklärung aussuchen konnte.
Mit einer mühelosen Bewegung, als sei er wieder völlig hergestellt, drückte Sherlock sich auf die Arbeitsplatte hoch, saß dort mit baumelnden Beinen. »Nicht die Langeweile. Schlafstörungen, das habe ich doch gerade gesagt. Heroin ist nun einmal das beste Schlafmittel, das es gibt, das wird dir jeder Pharmazeut bestätigen.«
Nicht darauf eingehen, hielt John sich zurück. Er will dich provozieren. Dich und Ettie. Die Pathologin, die mit dem Schnelltest fertig war, schaffte es ebenfalls, mit kalter Ruhe zu reagieren, obwohl John ihr ansah, dass sie Sherlock am liebsten geohrfeigt hätte: »Reines Heroin vielleicht. Aber diese Cocktails, die Sie auf der Straße kriegen, ganz bestimmt nicht.«
Touché, dachte John, als Ethel sich an ihn wandte: »Vorwiegend Ketamin. Das war ohne aufwändigere Verfahren herauszufiltern.«
John nickte. Genau das hatte er von der Kollegin wissen wollen: Welche Drogen noch im Körper des Freundes zirkulierten. »Können Sie ein Bett hier auf der Entgiftungsstation bekommen?«
Sie hatten es geschafft, Sherlock Holmes aus der Fassung zu bringen. Er gab nur ein empörtes Geräusch von sich, während Ethel schon auf der entsprechenden Station anrief und um einen Gefallen bat.
*
Er war todmüde. Die Digitaluhr in Sherlocks Schlafzimmer zeigte 01.59 Uhr. Bereits im Taxi zurück in die Baker Street hatte John Mary angerufen und ihr erklärt, dass er in dieser Nacht nicht nach Hause kommen würde. Sie hatte voller Verständnis und Liebe reagiert, besorgt um Sherlock und um ihn. Manchmal fragte er sich wirklich, wie er es geschafft hatte, diese wunderbare Frau zu finden und womit er sie verdiente.
Aber er konnte noch nicht schlafen gehen. Die Kollegen im Barts würden Sherlock nicht länger als eine Nacht dort behalten. Er war eigentlich nicht zugedröhnt genug für die Entgiftungsstation und Suizidgefahr schien nicht gegeben. Wenn überhaupt, dann Gefahr für andere. John verzog den Mund zu einem bitteren Grinsen. Wie ein sprungbereiter Tiger hatte Sherlock vor ihm gestanden, als er ihn zu der Station führen wollte. John hatte ihm angesehen, welche Selbstbeherrschung es ihn kostete, ihn nicht körperlich anzugreifen. Die Wirkung des Heroin-Anteils an dem Drogen-Cocktail war verpufft und damit setzte bereits ein Entzugszustand ein. Die Folge: erhöhte Aggressionsbereitschaft. John hatte der diensthabenden Schwester versichert, vor dem Schichtwechsel um sieben Uhr wieder dort zu sein und den Patienten, dessen Namen nach Möglichkeit niemand erfahren sollte, mitzunehmen. Also musste er jetzt die Wohnung durchsuchen.
Bereits der erste Griff in die Sockenschublade ließ ihn frustriert aufseufzen. Vielleicht sollte er doch besser schnell noch ein Telefonat führen.
»John. Was ist mit Sherlock?« Trotz der späten – oder frühen – Stunde klang Mycroft Holmes wie immer: komplett ruhig, beherrscht und wissend.
Tief im Inneren war John auf Sherlocks Bruder fast noch wütender als auf seinen Freund selbst, weil er die ganze Zeit eingeweiht gewesen war und Sherlock unterstützt hatte. Aber seine eigenen Gefühle musste er nun hintenan stellen. Er gab dem älteren Holmes einen kurzen Bericht über Sherlocks Verfassung.
»Vielen Dank für die Benachrichtigung«, lautete die Reaktion. »Ich schlage vor, wir treffen uns um kurz vor sieben im St Bartholomew’s. Ich bringe eine Liste von in Frage kommenden Einrichtungen mit. Ich würde es dann Ihnen als Arzt überlassen, eine auszuwählen. Dieses Mal.«
Bevor John noch etwas entgegnen konnte, hatte Mycroft Holmes das Gespräch beendet.
»Dieses Mal«, schwirrte es in Johns Kopf herum, während er sich zugleich aufregte, wie der nächste Angehörige so ruhig bleiben konnte bei solch einer Nachricht.
Um kurz vor drei, nachdem er in etwa den Wochenvorrat eines hochgradig süchtigen Junkies in der Wohnung geborgen hatte – wobei Sherlock sich nicht einmal große Mühe mit den Verstecken gegeben hatte –, stellte er den Wecker auf sechs Uhr, zog sich aus und kroch in Sherlocks Bett. Er war zu erschlagen, es noch in sein ehemaliges Zimmer zu schaffen und dort das Bett zu beziehen.
*
Trotz der frühen Stunde und obwohl auch er nicht viel Schlaf bekommen haben konnte, sah Mycroft Holmes aus wie immer: Jedes einzelne der dünnen, kurzgeschnittenen Haare lag perfekt an seinem Platz, das rundliche Kinn war makellos rasiert und an dem maßgeschneiderten dreiteiligen Nadelstreifenanzug gab es keine falsch sitzende Falte, auf den handgenähten Lederschuhen kein Staubkorn. Eine Hand ruhte auf dem Griff des Stockschirms, ohne den er – selbst an einem strahlenden Sommertag – nicht das Haus verließ.
Er stand im Flur und überreichte John, der verschlafen heranstolperte, zwei bedruckte DIN-A4-Seiten, schaute dann fragend zur Zimmertür. John nickte und räusperte sich kurz; Mycroft hob seinen Schirm an, klopfte damit gegen das Holz und öffnete die Tür.
Zum Glück lagen in dem Raum, der Platz für acht Betten bot, nur zwei weitere Männer. Hinter den jeweiligen Vorhängen konnte man leise, gequälte Geräusche erahnen.
Die Luft war stickig, der Geruch eine unappetitliche Mischung aus kaltem Rauch, Desinfektionsmitteln, Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten.
Der Vorhang an Sherlocks Bett war zurückgezogen und seine grauen Augen funkelten ihnen aus dem bleichen Gesicht mit den mehr denn je hervorstehenden Wangenknochen entgegen. Er war hellwach und wirkte äußerst aufgebracht. Auf dem Nachttisch sah John ein Tablett mit einem unberührten Frühstück. Unbehaglich warf er einen Blick auf die Blätter in seiner Hand. Es schien sich um Kurzbeschreibungen exklusiver Privatkliniken zu handeln.
»Reicht es nicht, dass du mich nötigst, die Nacht hier zu verbringen?«, fuhr Sherlock ihn mit schneidender Stimme an. »Musst du auch noch meinen Bruder anschleppen?«
»Guten Morgen, Sherlock«, schaltete Mycroft sich ein und wieder einmal fragte sich John, wie der Mann es schaffte, seine Stimme gleichzeitig aufrichtig freundlich und komplett herablassend klingen zu lassen. »Ja, ich denke, das musste er. Immerhin habe ich ein wenig Erfahrung mit deinen Drogen-Eskapaden.«
»Drogen-Eskapaden! Wer von uns ist jetzt theatralisch?«, schnappte Sherlock zurück. »Ich habe kein Drogen-Problem. Ich behandele meine Schlafbeschwerden.«
»Mit deiner ganz eigenen Therapie, die du aus Afghanistan mitgebracht hast, ich weiß«, entgegnete Mycroft.
Sherlock biss sich auf die Unterlippe.
»Ich habe mir das seit deiner Rückkehr angeschaut, aber anscheinend hast du es nicht im Griff, Bruderherz. Also scheint doch wieder eine Intervention angeraten.«
Während Sherlock Mycroft stumm und finster anstarrte, stellte John fest, dass sein Freund unter keinen schlimmen Entzugserscheinungen litt. Die Pupillen waren vergrößert, das war eine normale Reaktion des Körpers auf das ausbleibende Gift, und auf der Stirn glänzte ein leichter Schweißfilm. Er schien jedoch nicht zu frieren und auch die Hände zitterten nicht.
Aber da war dieser riesige Drogenvorrat, den er gefunden hatte. Wieder einmal räusperte er sich, um etwas zu sagen, Mycroft kam ihm jedoch zuvor.
»Ich überlasse das dieses Mal John, Sherlock. Er wird die Einrichtung auswählen, in die du dich unverzüglich begeben wirst. Ich erwarte vollständige Kooperation von deiner Seite, ist das klar?«
»Sonst?«, zischte der Jüngere. »Ich bin keine 15 mehr, du kannst mir nicht mehr drohen. Außerdem soll ich für dich einen Fall aufklären, erinnere dich.«
Mycroft wandte sich bereits zum Gehen. »Davon, mein lieber Bruder, bist du selbstverständlich auf der Stelle entbunden. In der Angelegenheit kann ich es nun wahrhaftig nicht brauchen, dass du benebelt oder mit den Gedanken bei dem nächsten Schuss, den du brauchst, durch die Gegend stolperst. Von Detective Inspector Lestrade wirst du auch keine Fälle bekommen, solange du nicht wieder längere Zeit anhaltend clean bist.«
Er nickte John zu. »Tun Sie, was Sie für richtig halten. Sämtliche Rechnungen gehen natürlich an mich.«
Während er den Raum verließ, dachte John, dass der Entzug jeglicher Fälle als Drohung, als erzieherische Maßnahme, vermutlich wirkungsvoller war als alles andere. Gleichzeitig packte ihn die nackte Angst: Es gab keinen Weg, den Freund zur Rehabilitation zu zwingen, und ein Sherlock Holmes ohne Arbeit, ohne zu lösende Fälle, würde vollkommen hemmungslos Drogen konsumieren.