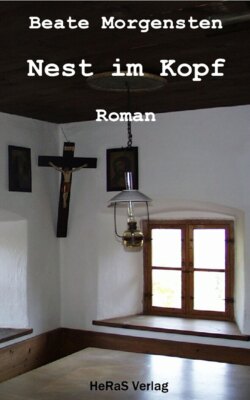Читать книгу Nest im Kopf - Beate Morgenstern - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеHalb acht hatten sich die Mutter und Anna verabredet. Im Durchgangszimmer duftete es nach Kaffee. Annas Blick traf auf eine Farbfotografie in einem kleinen Eichenregal. Die Großmutter. Eine ähnliche Fotografie hatte die Großmutter Anna geschenkt: vor einem bräunlichen Kunstlichthintergrund in aufrechter Haltung, kaum die ovale Stuhllehne berührend, in einem glänzenden, graublau geblümten Seidenkleid mit breitem Kragen. Um den Hals eine silberne Kette, blaue Halbedelsteine wie in einen Spitzenbesatz eingefasst. Mit kaum wahrnehmbarem Lächeln sah die Großmutter in die Kamera. Die eng beieinanderstehenden blauen Augen stark vergrößert durch die Starbrille, der Blick gerade. Die grauweißen vollen Haare locker nach hinten gekämmt, die Gesichtsfarbe bräunlich, die durch das Lächeln stärker gerundeten Wangen von frischem Rot, dichter Flaum über der Oberlippe und am Kinn, die Lippen sichtbar, ein recht junger Mund. Die Gesichtshaut glatt gespannt. Eine strenge, jugendlich erscheinende alte Frau.
Unwillkürlich nahm Anna das Bild aus dem Regal. So hatte sie die Großmutter unter dem Kirschbaum gesehen, nur war sie da milder gewesen. Überhastet stellte sie das Foto zurück. Die Mutter sollte sie jetzt nicht auf die Großmutter ansprechen. Noch war sie ihr durch den Traum zu nahe.
In der Küche hatte die Mutter den Frühstückskorb bereitet. Sie schaute auf die Uhr: pünktlich auf die Minute.
Anna lächelte müde. Wie einfach es heute war, die Mutter zufriedenzustellen. Ich bin sowieso ein Frühaufsteher, sagte sie und verschwieg, dass sie schon über eine halbe Stunde in der Bodenkammer herumgesessen und auf die Uhr gesehen hatte.
Morgenfrisch der Garten, dieses Zimmer unter freiem Himmel, betaut die Gräser und Blätter. Mit einem Mal fielen die eisernen Reifen der Müdigkeit und Konvention von Anna ab. Sie hätte wie als Kind in den Tag hineinspringen mögen. Guten Morgen, sagte sie, nickte nach allen Seiten und lachte.
Wen begrüßt du? Warum lachst du?
Entschuldige. Es kam so über mich.
Himmelhochjauchzend ...
Zu Tode betrübt, ergänzte Anna und legte die Hand auf den Mund, weil sie sich selbst albern fand. So hast du früher immer gesagt.
Aus dir soll einer klug werden.
Hast du früher auch immer gesagt. (Das war jedes Mal ein Friedensschluss gewesen, ein Angebot, wenn die Mutter resignierte.) Ich hab unheimlich gute Laune.
Das ist ja dann schön.
Während des Frühstücks wurde Anna von der Mutter bedient. Die Mutter genoss offensichtlich die Anwesenheit der Gasttochter in ihrem Sommerzimmer. Oft hatte sie Anna auf die Ähnlichkeit ihres Charakters mit ihrem Geburtsmonat hingewiesen. April, April, der weiß nicht, was er will. Nun fiel Anna die Ähnlichkeit der Mutter mit deren Geburtsmonat auf. Sie schien ihr aus genau dem kühlen, leicht zerreißbaren Stoff dieses Sommermorgens gemacht zu sein. Wenn Anna sich die Mutter vorstellte, dann meist in dünnen, blumigen Sommerkleidern und ganz jung wie auf frühen Fotografien.
Ich hab von Omi geträumt. Sie lag im Liegestuhl hier unter dem Kirschbaum.
So etwas. Hier ist sie doch nie gewesen. Die Mutter tat, als könne man nur wahrscheinliche Begebenheiten träumen.
Ich hab's halt so geträumt.
Was man so träumt. Die Mutter fand Gefallen daran, dass sie mit der Großmutter in einen von Annas Träumen hineingeraten war, erzählte ihrerseits Träume. Anna erinnerte sich, wie der Vater bei einem solchen Gespräch die Mutter und Anna sehr unwillig unterbrochen hatte. Nun konnten sie ihr Gespräch über Träume endlos ausdehnen.
Und was hast du heute für ein Programm? Routiniert kehrte die Mutter in die Alltagswelt zurück.
Programm, sagte Anna. Wie's kommt. Im Grunde war sie ratlos, wie sie die Woche durchstehen wollte. Ich hab mir Bücher mitgenommen, die ich unbedingt lesen möchte.
Einen Tag solltest du wenigstens ins Gebirge fahren.
Bloß nicht. Mich da tottrampeln lassen.
Du musst es wissen.
Du hast jedenfalls dein Programm. Anna stand auf und schichtete das Geschirr in den Korb. Um meins mach dir keine Gedanken. Und den Abwasch erledige natürlich ich.
Sehr lieb von dir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was vor mir liegt.
Doch. Ist ja nicht das erste Mal.
Aber jetzt müssen wir uns so verkleinern, klagte die Mutter.
Einmal muss es sein, sagte Anna.
Hast du auch wieder recht. Geh wenigstens spazieren. Ein bisschen Bewegung schadet dir nicht.
Hast du eigentlich schon die Alben und Familienpapiere weggepackt?
So ziemlich. Ich finde immer noch mal was.
Und wohin hast du die Sachen getan?
Erst mal in die alte Truhe neben der Tür zur Gästekammer.
Nehmt ihr alles mit?
Ja, weiß noch nicht. Das bespreche ich mit Vater.
Wenn nicht ...
Ja. Du hast es mir oft genug gesagt. Die Mutter wurde gereizt.
Anna verstand sie nicht. Schon so vieles aus dem Nachlass des Urgroßvaters war verschwunden, ohne dass die Mutter sich aufregte. Aber freiwillig gab sie nichts aus der Hand. Sorgte sich die Mutter um ihr Alter, wollte sie dann, vom Vater allein gelassen, einen Blick zurück tun? Sie sicherte sich ab, hielt sich alle Möglichkeiten offen, das war es wohl. Noch lebte sie mit dem Vater dessen Leben. Wie das ihre danach aussehen würde, Annas Großmutter hatte es Anna gegenüber einmal sehr nüchtern formuliert: Danach wird ihre eigentliche Prüfung kommen.
Ich werde erst mal zum Altan raufgehen, sagte Anna. Wo habt ihr den Schlüssel?
Wir haben keinen mehr. Die Mutter verzog ihren Mund zu einem vieldeutigen Lächeln.
Ach so. Anna schnaubte verächtlich. Sobald sie von einer Kränkung erfuhr, die den Eltern in ihrer langen Amtszeit zugefügt wurde, erklärte sie sich mit ihnen solidarisch. Das fiel ihr um so leichter, als sie meist nicht die Gründe dafür kannte. Natürlich wusste sie, dass sich die Eltern den größten Teil Schuld selbst zuzuschreiben hatten. Aber sie ignorierte absichtlich, gestand sich zu, ungerecht zu sein, wenn es um ihre Familie ging. Wie sie als Kind ihre Geschwister verteidigt hatte, so war sie auch heute noch bereit, ihre Familie vor Angriffen zu schützen. Warum hatte der Vater den Schlüssel zum Altan, dem Gottshuter Aussichtsturm, abgeben müssen? Alle Alteingesessenen besaßen einen Schlüssel. Solange die Eltern ihn noch hatten, war etwas von der ursprünglichen Schlüsselgewalt des Vaters übrig.
Der zweite Ortspfarrer hatte seine Wohnung auf demselben Flur wie die Eltern. Seine Frau wandte, nachdem sie Anna erkannt hatte, ihren Kopf zur Seite. Dass diese schmächtige, dunkelhaarige Frau, die Menschenblicke nicht ertragen konnte, vier Kinder geboren hatte, glaubte man kaum.
Ich hätte gern den Schlüssel zum Altan.
O ja, o ja. Die Frau lief in die Wohnung, als hätte sie etwas versäumt, das nun eilig nachzuholen sei.
Anna hatte behutsam mit ihr geredet und sehr artikuliert wie mit einer Kranken, denn die Frau hatte ihr sofort ein Gefühl von Überlegenheit aufgedrängt, das Anna oft im Umgang mit fremden Menschen an sich erlebte. Offensichtlich strahlte sie eine Gelassenheit aus, die ihr selbst nicht bewusst war. Wobei es darauf ankam, wie die Menschen ihr begegneten, welches Verhalten sie voraussetzten. Anna ließ sich auch schnell einschüchtern.
Immer noch den Blick zur Seite gerichtet, kam die Frau des zweiten Ortspfarrers mit dem Schlüssel zurück.
Zum Aussichtsturm, den die Gottshuter auf dem Berg errichtet hatten, an dem sie ihren Gottesacker anlegten, war es nicht weit. Denn die Gärten, die Gottshut auf dieser Seite wie ein Saum umgaben, lagen am Fuß des Berges. Anna hakte das Gatter der Umzäunung auf und schaute über das Kornfeld. Es reichte bis über den Rücken des Hutberges hinunter zum nächsten Dorf. Niemals wurde auf dem Feld neben dem Gottshuter Totenacker etwas anderes als Getreide angebaut. Der Bruderbund bestimmte es. Ihm gehörte das Land. Die Nachbarschaft eines Getreidefeldes war sinnreich, denn das Bild vom Weizenkorn, das in der Erde aufging, um vielfältig Frucht zu bringen, war eines der Zentralen im Leben der Gemeinschaft.
Anna ging den Weg am Feld entlang, der an einer Bruchsteinmauer endete. Eine Querstraße lief hier aus. Ein Pfad führte über den Berg. Bald begannen die hohen Buchenhecken des Gottesackers, die einige Durchschlupfe hatten. Die Gottshuter nahmen es mit den Ein- und Ausgängen nicht so genau. An der Bergkuppe bog Anna ab, lief an einem kleinen vertümpelten Steinbruch vorbei. Der Weg, zuletzt mit Kies bestreut, umrundete den Gipfel. Dann stand Anna vor dem Altan. Ihr gefiel die klangliche Ähnlichkeit mit dem Wort Altar, und sie dachte an ihn immer wie an einen antiken Tempelbau auf einer Bergeshöhe. Der steinerne Innenturm war von einem hölzernen Rundturm umkleidet, die Hölzer weiß gestrichen, die Rundbogen trugen eine Aussichtsplattform. Das durchbrochene Geländer bildete den Reif auf dem Haupt des Gottesberges. Dieser Tempel musste von Geweihten aufgeschlossen werden, die andächtige Besucher führten, oder von ganz jungen Liebespaaren, die hier ungestört ihre Abende verträumten.
Anna wog den einfachen, großen Schlüssel in der Hand. Viel schwerer waren die Kirchenschlüssel des Vaters gewesen, schön geschmiedet. Von den Geschwistern hatte nur sie Zugang zu ihnen gehabt, weil sie von einem bestimmten Alter an täglich an der Orgel übte.
Anna schloss die Tür zum Altan auf, tastete sich im Dunkel die Wendeltreppe hinauf, stieß die obere Tür auf und musste sich erst an das helle Licht gewöhnen. Sie lehnte sich an die Brüstung und schaute auf die Baumkronen hinab und die breite, von Buchenhecken abgeschirmte Treppe hinunter zum Gottesacker, über die Alleen gestutzter Bäume hinweg zum Städtchen hin, das im Grün versank, eingebettet war von Misch- und Laubwäldern. Wie ein Krönchen darüber der kleine Barockturm des Kirchsaals. Golden leuchteten Wetterfahne, Kugel und Uhrzeiger. In der Ferne zeichneten sich Berge ab. Die Vorderen kräftig. Schau, das ist der Czorneboh und das der Bieleboh, hatte der Vater gesagt und Anna auf die Berge seiner Kindheit hingewiesen. Der schwarze und der weiße Gott in der Sprache der Sorben. Wurden nicht bei vielen Völkern Berge als Gottheiten verehrt? Die Bergketten am Horizont schwach im Dunst der Atmosphäre. Auf der mit Blech ausgeschlagenen Brüstung waren Namen und Höhe der Berge verzeichnet. Herthelsdorf im Osten. Da begann der Lauf der Sonne. Im Südosten Polen, im Süden das tschechische Isergebirge. Die Nachbarn waren an Gottshut herangerückt, umschlossen nahezu das kleine Stück Erde, auf dem böhmische und mährische Exulanten einstmals Zuflucht gefunden hatten. Und hinter dem Kretzschmar ging die Sonne unter. Oft hatte Anna als Kind aus dem Küchenfenster auf den Kretzschmar geschaut und den Sonnenuntergang beobachtet. Und die Mutter und die Großmutter traten auch mal ans Fenster, wenn es Abend wurde.
Die Kirchenglocken schlugen. Neun Uhr. Anna ging hinunter in den Ort.
Die kleine Straße, die auf die Rückseite des Kirchsaals zuführte, war vom Kriegsbrand unversehrt geblieben, ebenso der Witwenhof, der den kleinen Platz mit seinem Heckenwandelgang und den bei den kegelförmig verschnittenen hohen Zypressen rechter Hand abgrenzte. Auch die vom Witwenhof abgehende Nebenstraße unbeschädigt. Wiedererbaut nach dem Brand der Kirchsaal. Hier, zwischen Kirchsaal und Witwenhof, verharrte Anna. Sie hatte das Bild vom alten Gottshut vor Augen. In einem einheitlichen Stil die Gebäude: Fenster in den zweigeteilten Dächern, die obere Reihe lidförmig, sogenannte Kuhaugen, die Zweite spitzgiebelig. Die Treppen an den Seiten abgerundet, gusseiserne Haltebögen. Von den Hausmauern abgesetzte Blenden um die in kleine Quadrate geteilten Fenster, diese für gewöhnliche Wohnhäuser klein. Die des Kirchsaals reichten über zwei Stockwerke, der aber sonst sehr einem gewöhnlichen Haus glich mit seinem zweigeteilten Dach und den Erkerfenstern in beiden Dachgeschossen. Nur in der Mitte des Dachs ein Turm aufgesetzt, ein Dachreiter. Und in seiner Größe übertraf der Kirchsaal die übrigen Gebäude. Gottshut, eine Kommune aus dem Geist der Urchristenheit entstanden, großzügig geplant und in einem Atemzug erbaut. Wohnhöfe, meist im Geviert errichtete Komplexe, für die ledigen Brüder, die ledigen Schwestern, die Pilger. Eine Mädchenanstalt, eine Knabenanstalt. Häuser für Witwen, ein Altenheim. Das Krankenhaus, die Apotheke, die Gemeinbäckerei, die Wäscherei, alles von den Brüdern verwaltet. Selbst die Fabriken des Fabrikanten Abraham Haslinger waren in den Besitz der Brüder übergegangen, ebenso die Ländereien des Grafen, auf dessen Grund sich die Böhmen und Mähren niedergelassen hatten. Nach dem Vorbild der Muttergemeinde entstanden im Land und in Missionsgebieten andere Gottshuter Siedlungen.
Im Witwenhof war Anna oft gewesen. All die alten Damen, ledig, verwitwet, die Anna vom Sehen her kannte und grüßte, sie lebten in den Wohnungen der verschiedenen Aufgänge, lebten hier, solange sie selbständig einen Haushalt führen konnten. Zwei Frauen teilten sich eine Wohnung, benutzten eine Küche. Die Religionslehrerin fiel Anna ein, die Buchhändlerin, die Schwester von Tante Leonie, die beiden Freundinnen von Tante Leonie. Zu dritt und eifersüchtig sich gegenseitig beaufsichtigend, hatten sie Tante Leonie gepflegt, die auch einmal die Freundin von Annas Mutter gewesen war und dann Annas mütterliche Freundin. Ausgezogen, weggegangen war Annas Schwester Mechthild, die hier gewohnt hatte. Ausgezogen auch Tante Leonie, um in eine der himmlischen Wohnungen einzuziehen.
Anna ging in einen der breiten Hauseingänge, die dem Kirchsaal zu lagen. Eine klappende Glastür, die den Vorflur vom Flur trennte. Der eigentümliche Geruch von frischem Bohnerwachs, Kräutern und süßen Äpfeln, vermischt mit dem strengen Geruch von Kloake. Eine Treppe, die sich zwei Stockwerke hinaufwand. Weiß lackiert das Geländer, schwarz die Griffstangen. Unauffällig in Ecken und zwischen Flurtüren Kleiderschränke verteilt, die in den kleinen Wohnungen keinen Platz mehr fanden. Schöne Stücke darunter. Die Treppenabsätze schmückten weiße altertümliche Blumenständer. Blattpflanzen auch in den tiefen abgerundeten Fensternischen, aus denen viel Licht kam, das von dem 'Weiß der Wände reflektiert wurde. Eine Stille, von argwöhnischen Ohren der Schwestern hinter den Türen belauscht. In einem solchen Haus konnte einfach nichts Schlimmes geschehen. Manchmal nahm wohl ein leiser Tod eine Bewohnerin mit sich. Doch ohne auf der spiegelblanken Treppe eine Spur zu hinterlassen, und nur im Gedächtnis der übrigen Bewohnerinnen haftete eine wehmütige Erinnerung.
Anna schaute nun auch in den Hof, der über den vielen hundert Gesichtern, die er im Laufe der Jahrhunderte gesehen hatte, erblindet war, setzte sich auf eine schmale Bank. Ein quadratischer Wäscheplan füllte den Hof aus, nur am Rand ein gepflasterter Gang. Ein kleiner, nützlicher Hof, auf der vierten Seite im Quadrat ein niedriger hölzerner Schuppen. In den Verschlägen lagerten die Bewohnerinnen Holz und Kohle und bewahrten die Geräte für die Bearbeitung der Beete im Gemeinschaftsgarten hinter dem Hof.
Eine Frau trat aus einem der Eingänge mit einem Korb nasser Wäsche. Ein kurzer Blick zu Anna, die stumm nickte. Die Frau hängte die Wäsche auf und kümmerte sich nicht um Anna. Man war es hier gewohnt, die Arbeit unter den Blicken anderer zu verrichten. Ging Anna in ihrer Kindheit vom Pfarrgrundstück hinaus ins Dorf, hatte sie immer heimliche Augen gespürt. Und selbst in der Großstadt wurde Anna manchmal die Vorstellung nicht los, man beobachte sie. Hier nun in Gottshut waren die heimlichen Augen allgegenwärtig.
Anna sah auf die mit Weinlaub bedeckten Hauswände, sah hinauf in all die Dachfenster mit den spitzen Giebeln ringsum, überlegte, welche Fenster zu der Wohnung gehörten, die Tante Leonie mit ihrer Schwester bewohnt hatte.
Es war schon einige Jahre her, im Winter, kurz vor Weihnachten, da hatte Anna Tante Leonie zum letzten Mal besucht.
Erschrick nicht, hatte Annas Bruder gesagt. Tante Leonie ist sehr alt geworden.
Wie sollte sich Anna auf das Schlimmste vorbereiten?
Beklommen war sie das Treppenhaus hinaufgegangen, hatte an Tante Leonies Tür geklingelt, geklopft. Man konnte gleich vom Hausflur in ihr Zimmer, brauchte nicht den Umweg über die Wohnung. Sie hörte keine Antwort und hatte beide Türen geöffnet.
Tante Leonie hatte in einem hohen Sessel gesessen. Das große Gesicht mit den vollen Wangen nicht mehr aufgedunsen und rot wie im Sommer. Sicher, das kurze Haar brüchig und weiß, und unter der Strickjacke trug sie einen Schlafanzug. Tante Leonie hatte sich immer gepflegt, war immer zum Friseur gegangen. Aber ihr Aussehen verwirrte Anna weit weniger als ihren Bruder, der Tante Leonies Patensohn war. Anna konnte unbefangen und herzlich lächeln, wie sie es sich auf jeden Fall vorgenommen hatte. Sie ging zu Tante Leonie, die sie mit einem Aufleuchten der Augen begrüßt hatte, und küsste sie auf die Wange. Die Haut war mit einer weichen Flaumschicht kleiner, heller Haare überzogen.
Tante Leonie hob die langen Arme, zog Anna ein wenig zu sich herab und küsste sie ebenfalls. Guten Tag, Anna. Sie hatte eine dunkle singende Stimme. Ihr Gruß hörte sich wie ein Lied an.
Eine Dame, die neben Tante Leonie auf einem leichten Hocker mit geflochtenem Sitz Platz genommen hatte, war aufgestanden und sah Anna strahlend an, als hätten sie und Tante Leonie soeben über Anna gesprochen.
Nachdem der Besuch gegangen war, zog Anna den Hocker etwas zu Tante Leonie heran. Diese fasste nach Annas Hand und streichelte sie. Anna nahm eine aus mehreren Holzstreben bestehende, in den Sessel von Tante Leonie eingebaute Rückenstütze wahr. Du siehst gut aus, sagte sie.
Ja, nicht wahr? Damals im Sommer war ich ein richtiger Pfannkuchen. Sie blies die Wangen auf und lachte kläglich.
Ich hab dir ja gesagt, das kam vom Medikament.
Denk dir, Anna, es geht mir wirklich sehr viel besser.
Tante Leonie drückte Annas Hand und schüttelte sie. Ich war manchmal so verzweifelt.
Anna sah Tante Leonie aufmerksam an. Selbst im Sommer hatte die Tante hartnäckig über ihren Zustand geschwiegen.
Ich hatte solche Schmerzen, Anna, gestand sie. Aber jetzt geht es mir wirklich sehr viel besser. Du wirst sehen, eines Tages schaffe ich's bis zum Goldtschmidtel die Treppe runter. Wieder schüttelte Tante Leonie Annas Hand, die sie mit beiden Händen noch immer umfasst hielt. Das Skelett kommt ja nicht mehr in Ordnung. Aber du weißt gar nicht, was für Fortschritte ich schon gemacht habe. Sie schniefte einmal schwach, dann stärker, eine Eigenart der Tante, die bei steigender Erregung zunahm.
Wie meist bei ihren Besuchen berichtete Anna zunächst von ihrem Leben, ihrer Arbeit in der Großstadt. Dann kam die Sprache auf die Religion. Kaum jemals wurde dieses Thema ausgelassen.
Annas wütende Ausfälle gegen das Christentum beantwortete die Tante mit entwaffnender Nachsicht. Du bist noch nicht fertig damit Anna, sagte sie und lächelte wissend.
An der Mutter hätte Anna dieses Lächeln aufgebracht, Tante Leonie verzieh sie es.
Ich weiß, die Lauen spuckt Gott aus, zitierte Anna einen Bibelspruch, den der Vater häufig verwendete. Sie ärgerte sich selbst über den Eifer, der der Tante recht gab. Außerdem passt es mir nicht, jemandem die Verantwortung für mein Leben zu überlassen, sei es Gott oder sonst wem. Da käme ich mir einfach feige vor.
So darfst du's auch nicht sehen! Die Tante erregte sich. Wir sind wohl noch verantwortlich für unser Leben.
Schau doch auf die Eltern. Alles legen sie in Gottes Hand. Er wird's wohl machen.
Du darfst nicht nur deine Eltern als Beispiel nehmen.
Wen denn sonst? An ihnen sehe ich, wie's laufen kann, und das genügt mir. Und dass sie die absolute Ausnahme sind, wirst du auch nicht sagen.
Ach, Anna.
Ist ja gut, Tante Leonie. Anna lenkte ein, denn die Tante ermüdete sichtlich. Wir haben immer so miteinander gesprochen, erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich deutlich. Du warst von jeher ein unruhiger Geist, Anna. Gerade deshalb denke ich, Gott hat etwas Besonderes mit dir vor.
Tante Leonie!
Ich weiß, du willst es nicht hören. Aber du bist mir nun mal besonders ans Herz gewachsen ... Früher war dein Vater aufgeschlossen. Die Tante seufzte. Man konnte so gute Gespräche mit ihm haben.
Reden konnte man mit ihm, das stimmt schon. Aber täusch dich nicht. Er war schon immer ein Eiferer.
Für Gottes Wort zu eifern ist ja auch richtig. Die Tante nahm den Vater in Schutz. Doch dann brach der Unmut über Annas Eltern aus ihr heraus. Sie hatte sich einmal gegen einen massiven Erweckungsversuch wehren müssen. Du, das Schlimmste an deinen Eltern ist ihre schreckliche Intoleranz, sagte sie. Deine Eltern lassen keinen anderen Weg gelten als ihren. Ich finde das einfach furchtbar. Wo wir doch alle Christen sind.
Ich bin es nicht. Anna konnte es nicht lassen, der Tante zu widersprechen.
So darfst du nicht reden. Du versündigst dich. Gott ist für dich da und liebt dich.
Ach, Tante Leonie.
Nein, nein, glaub mir, Anna, er gibt dich nicht verloren! Tante Leonies dunkle Stimme brach in der Erregung. Deine Eltern haben dich von Gott weggetrieben. Oh, ich kann dich so gut verstehen. Auch ich habe ihretwegen gelitten und bin lange nicht zur Ruhe gekommen.
Sie haben Angst um deine Seele und dürfen deshalb auf den Menschen nicht die geringste Rücksicht nehmen. Aus reiner Liebe. Übrigens, wenn man schwach ist, muss man sie besonders fürchten. Sie ahnen es förmlich und nutzen es aus.
Jedenfalls habe auch ich meinen Glauben, und den habe ich mir schwer erkämpft. Weißt du, etwas hat mich doch geärgert. Ich bekomme ja nun wirklich viel Besuch, mehr, als mir lieb ist. Und Mechthild, auch deine Mutter, konnten es nicht lassen, mich zu fragen, ob auch jemand mit mir betet. Die Tante schniefte heftig.
Anna schüttelte den Kopf. Sie können nicht anders. Jetzt war es Anna, die die Eltern entschuldigte. Aber das gehörte zu den Spielregeln von Gesprächen, wie Anna sie gelernt hatte. Immer die Aussage des anderen einzuschränken.
Du bist in einer schwierigen Lage, sagte die Tante, lächelte und streichelte Annas Hände. Ich freu mich, dass du gekommen bist.
Und ich, dass ich dich so wohl antreffe. Es klopfte.
So ist es immer, flüsterte Tante Leonie und deutete in ihrem Gesicht eine kleine Verzweiflung an. Und gerade jetzt, wo du da bist. Sie drückte Annas Hand.
Wie ein Wallfahrtsort, dachte Anna. Niemand möchte etwas versäumen. Der Glaube an die Gesundung, der sich von der Tante auf Anna übertragen hatte, kam ins Wanken. Sie hatte von der Euphorie Kranker im letzten Stadium gehört.
Die Tante und Anna lauschten.
Ein zweites Mal wurde stärker geklopft. Dann traten ein weißhaariger Mann und eine jüngere Frau ein.
Ach, Geschwister Mirtsching, ihr seid es. Tante Leonies Gesicht hellte sich auf.
Anna wartete auf ein Zeichen der Tante und machte sich zum Gehen bereit.
Bleib, Anna, bleib, gurrte Tante Leonie aufgeregt.
Wir wollen nicht stören, Schwester Fendel, sagte die Frau. Ihre starke Fröhlichkeit irritierte Anna.
Ihr stört überhaupt nicht, sagte Tante Leonie überzeugend. Ihr kennt euch doch? Fragend sah Anna die Frau an.
O ja, sicher.
Anna hob die Schultern. Ich weiß im Augenblick nicht so recht.
Wir sind einmal zusammen spazieren gegangen, als du zu Besuch in Gottshut warst.
Anna tat der Einfachheit halber, als erinnere sie sich schwach. Sie überließ dem alten Mann den Besucherhocker und setzte sich auf das harte, breite Bett neben dem Ofen.
Der alte Mann gefiel Anna. Er wirkte wie jemand, der sich eine für seinen Stand nicht selbstverständliche Bildung erworben hatte, aber weiter mit seiner Hände Arbeit sein Brot verdiente. Er entsprach Annas Vorstellung von den Gottshuter Gründern.
Während sich Vater und Tochter Mirtsching mit Tante Leonie unterhielten, hatte Anna Muße, sich im Zimmer umzuschauen und die Farben der Erinnerung aufzufrischen für den Fall, dass sie eines Tages nur auf ihr Gedächtnis angewiesen wäre.
Ein massiver, mit Messingbeschlägen versehener Mittelfußtisch aus Birnbaum. Durch die Platte ging ein Sprung. Ebenfalls aus dem gelben Holz der alte Sekretär am Fenster. In der Ecke zwischen Eingangstür und Nachbarkammer ein Kirschholzschrank. Darin das hauchzarte, rot bemalte chinesische Teeservice, in dem die Tante früher Anna in immer gleicher Zeremonie Tee servierte. Danach tranken sie Eierlikör aus kleinen Kristallgläsern. Gelbrote indonesische Schals auf den Schränken. An den Wänden Kunstgewerbearbeiten aus Übersee. Die Reproduktionen der Michelangelopietà und des schlafenden Adam gaben Anna viel von den Schmerzen und Sehnsüchten der Tante preis. Adam, noch nicht angerührt vom Finger Gottes, kurz vor dem Erwachen. Hätte Gott wie der Maler auf Adam geschaut, ihm wäre keine Eva mehr in den Sinn gekommen, dachte Anna spöttisch.
Im Gespräch mit Mirtschings erzählte Tante Leonie, wie sie Annas Mutter kennengelernt hatte. Beide arbeiteten sie nach dem Krieg in der Gottshuter Erwerbshilfe, die der Bruderbund für die Frauen einrichtete. Soweit Anna bekannt war, wurden amerikanische Kleiderspenden ausgebessert und verschickt. Auch der alte Mann erinnerte sich an Annas Familie, an den Urgroßvater Schlemmin, den Superintendenten. Noch nie hatte Anna einen Gottshuter von ihm sprechen hören. Sie sah den alten Mann ungläubig an.
Dann erkundigte sich die Tante nach dem Ergehen ihrer Besucher. Fühlst du dich in deiner neuen Stelle wohl, Schwester Mirtsching? fragte sie.
Oh, mir geht es sehr gut. Die Alten sind ja so dankbar. Und man hat wirklich das Gefühl, gebraucht zu werden.
Arbeiten Sie in Nischwitz?
Ja. In den Anstalten. Aber du kannst ruhig du zu mir sagen, Schwester Herrlich. Und wie geht es dir, Schwester Fendel?
Oh, ich habe Anna schon erzählt. Ich mache große Fortschritte. Aufgeregt tat Tante Leonie ihre Wolldecke von den Knien. Ich werde es euch zeigen. Sie erhob sich.
Anna fiel wieder auf, wie groß die Tante war.
Die Jacke hing locker und flach über dem Schlafanzug der Tante. Als Schwerkranke verzichtete sie auf Vortäuschung weiblicher Formen. Mühsam ging sie kleine Schritte bis zur Mitte des Zimmers, Vater und Tochter standen rechts und links bereit, um sie bei einem möglichen Fall aufzufangen. Doch Tante Leonie schwankte nicht, auch nicht, als sie stehen blieb. So, sagte sie. Jetzt zeige ich es euch. Sie deutete mit dem Zeigefinger auf die Füße und drehte sich. Ich kann sie wieder bewegen, ohne dass es mir Schmerzen macht. Und das hat vorher schrecklich wehgetan. In Erinnerung an die Schmerzen verkrampfte sich das Gesicht der Tante.
Was für Qualen muss sie ausgestanden haben, dachte Anna. Sonst würde sie nie darüber sprechen.
Immer weiter drehte sich die Tante. Dann ging sie auf ihr Bett zu, klopfte mit der Hand darauf. Ist es nicht gut? sagte sie zu Anna. Extra für mich angefertigt.
Ja, schön hart, sagte Anna.
Und auch dahin kann ich wieder allein gehen. Tante Leonie deutete verschämt auf einen mit einem Sitzpolster abgedeckten Stuhl neben dem Bett.
Alle verstanden, was sie meinte.
Die Tante legte in kleinen Schritten den Weg zu ihrem Sessel zurück. Erst nachdem sie sich gesetzt hatte, wich die Spannung von Anna und den Mirtschings.
Das ist wirklich sehr schön, lobte Schwester Mirtsching. Wir freuen uns so für dich! Sie nahm ein kleines Seidenpapierpäckchen aus ihrem Beutel und legte es auf den Tisch. Nur eine Kleinigkeit, Schwester Fendel.
Aber das war doch nicht nötig. Die Tante hatte wieder ihre volle singende Stimme, die ihr zwischendurch abhandengekommen war.
O doch. Schwester Mirtsching lächelte.
Die Tante ergriff mit einiger Mühe das Päckchen und streifte das Band ab.
Anna tat es weh, wie schwer der Tante diese einfachen Handgriffe wurden.
Damit machst du mir aber eine Freude, sagte die Tante, nachdem sie einen von Lochmustern durchbrochenen gelben Papierstern ausgewickelt hatte. Er ist sehr, sehr hübsch.
Wo werden wir ihn hinhängen? fragte Schwester Mirtsching.
An den Sekretär, dort kann ich ihn gut sehen, schlug Tante Leonie vor.
Ans Fenster, beschloss Schwester Mirtsching.
An den Sekretär, sagte Anna und wunderte sich selbst über ihren befehlenden Ton. Der guten Schwester war offensichtlich entgangen, dass Tante Leonie mit dem Rücken zum Fenster saß, immer mit dem Blick auf die Tür, auf den unvermeidlich nächsten Besucher.
Widerstrebend gehorchte Schwester Mirtsching.
Aus einer Seitentür der gemeinsamen Wohnung trat Tante Magda, Tante Leonies Schwester, leise grüßend, ohne jemanden anzusehen.
Anna hörte auf den Klang der völlig gleichen dunklen singenden Stimmen dieser im Wesen wie im Äußeren so unähnlichen Schwestern, die sich nie besonders gut verstanden hatten. Nun war die kleine, kränkliche der großen und starken überlegen. Doch schien sie sich dieser Überlegenheit sehr unsicher zu sein.
Die Mirtschings gingen. Die Tochter verabschiedete sich mit überschwänglicher Freundlichkeit, der Vater förmlich, wie Anna es von ihrem eigenen Vater kannte, nur zwang sich Bruder Mirtsching zu keinem Lächeln.
Anna wurde noch von Tante Leonie zurückgehalten.
Die Tante bezeichnete ihr den Ort, wo sich ihr Geld befand. Anna musste sich einen Fünfzigmarkschein herausnehmen als Fahrgeld. Zwar genoss Anna, dass die Tante sie auf diese Weise verwöhnte, aber es war ihr peinlich, das Geld anzufassen, und noch peinlicher, die Geldbörse selbst zu prüfen und zu leeren. Doch die Tante war nicht imstande dazu, und es war wichtig für sie, Anna etwas zu geben.
Ich verbrauch ja nichts, sagte sie. Und außerdem, ich hab doch keine eigene Tochter. Sie warf Anna einen verschwörerischen Blick zu. Muss niemand was wissen, flüsterte sie.
Anna lachte und versprach es. Sie küsste die Tante auf die Wange und fühlte wieder den weichen Flaum. Auf Wiedersehen! sagte Anna leichthin, als wäre es nicht ihr dringendster Wunsch.
Mehrere Male sah sie sich nach Tante Leonie um, die ihr unentwegt nachschaute.
Anna hatte die Tür hinter sich zugezogen, die Innentür, die Außentür, und war seitdem aus Tante Leonies Leben und auch Sterben heraus gewesen. Die Tante hatte sie trotz Annas ausdrücklicher Bitte nicht mehr gerufen. Ihre letzten Wochen verbrachte sie in rätselhafter Einsamkeit im Gottshuter Krankenhaus, ließ niemanden mehr zu sich, nicht ihre beiden Freundinnen, nicht ihre Schwester. Nur ihren Seelsorger und ihre Nichte, die angereist kam.
Viel später war noch eine Nachricht zu Anna gedrungen. Der Bischof, der als Seelsorger die Tante in den Tod geleitet hatte, erkannte Anna auf der Straße und begrüßte sie. Eine Weile hatte er Anna freundlich angesehen und dann gesagt: Von Ihnen hat Schwester Fendel oft gesprochen.
Wie hatte sich Anna noch im letzten Gespräch mit der Tante ereifert. Jetzt berührten sie die Fragen der Religion nicht mehr. Die Ablösung war Schritt um Schritt erfolgt. Sie hatte nichts forciert, hatte sich weder in die eine noch in die andere Richtung drängen lassen und konnte nicht einmal den Zeitpunkt nennen, an dem sie zu glauben aufgehört hatte. Wurde sie nach der Religion befragt, sagte sie, Gott wäre ihr abhandengekommen.
Sicher hatte hinter den Fenstern die eine oder andere Schwester Anna in Augenschein genommen, eine Fremde, die sich so lange auf ihrem Hof aufhielt, die sich auf einer Bank niederließ und ihren Gedanken nachhing, wie sie es selbst taten, wenn ihnen nicht nach einem Spaziergang war, sie aber auch nicht in der Wohnung hocken wollten. Anna stand auf. Der erste Vormittag in Gottshut dehnte sich, und in ihr war noch die Unruhe der Großstadt. Noch musste sie sich beschäftigen. Nach und nach gäbe sich das. Sie würde sich Fotoalben ansehen und in den Familienpapieren kramen. Eine gute Gelegenheit, denn sonst lagen die Papiere in Fächern verstreut und waren kaum zugänglich.
Die Truhe neben der Tür zur Gästekammer hatte Anna bei bisherigen Besuchen übersehen. Sie gehörte zum üblichen Bodengerümpel, das sich von Umzug zu Umzug neu ansammelte. Wie oft sich die Mutter auch trennte und dies lautstark verkündete, es wurde nie weniger.
Als Anna die Truhe jetzt sah, erinnerte sie sich, dass die Mutter früher Federbetten darin verstaut hatte. Sie öffnete die Truhe, stapelte die Alben auf den Dielenbrettern. Die meisten hatte Anna selbst angelegt. Die Mutter hatte keinen Sinn dafür und der Vater keine Zeit. Andere Alben stammten von Jugendfreundinnen der Mutter, von Annas Großmutter und aus dem Nachlass von Annas Urgroßvater Schlemmin. Anna schob die Papiere auseinander.
Zuunterst Lesebücher für höhere Knaben und höhere Töchter. In Schichten darüber Briefe, lose, in Briefumschlägen, abgeheftet in Heftern, in einem Ordner die aus den ersten Ehejahren der Eltern. Schwarze Wachstuchhefte, die nach dem Tod des Großvaters Kröger als Rundbriefe zwischen den zerstreuten Familienmitgliedern kursierten, vervielfältigte Weihnachtsbriefe des Vaters, die seine umfangreiche Korrespondenz vereinfachten, Kopien von Briefen, verfasst vom Bruder der Mutter an der Kriegsfront, doch rein geistlichen Inhalts. Auf Empfehlung der Mutter hatte sie Anna als Mädchen einmal durchgearbeitet. Ausgeschnittene Zeitungsartikel, die Anna geschrieben hatte. Sie zog ein großes Heft unter den Papieren hervor. Lebenslauf Großmutter Kröger in der Anna so bekannten lateinischen Schrift, zu der die Großmutter später übergegangen war. Große, gut lesbare Buchstaben mit gotischen Spitzbogenausläufen. Anna hatte dieses Heft der Großmutter noch nie in den Händen gehalten.
Anna las. An manchen Stellen hörte sie die knarrende Altfrauenstimme der Großmutter heraus, die sich in bewegenden Augenblicken ähnlich wie bei Tante Leonie bis ins Emphatische steigerte. Manchmal schien die Großmutter Anna so nahe, als brauche sie sich bloß nach ihr umzusehen. Dennoch erfasste Anna auch das Groteske dieses Berichts. Die Großmutter nahm ihre Familie ganz aus der Geschichte heraus und ordnete den Bericht konsequent einem Leitgedanken unter, nämlich: Seine Gnade zu bezeugen. Offensichtlich unterschied sie diesen Krieg nicht von früheren, vielleicht weil sie einen Weltkrieg schon erlebt hatte. Kriegswirren wie notvolle Zeiten des Hungerns und Frierens und vielfältiger Unfreundlichkeiten hatte es in der zweitausendjährigen Geschichte der Christenheit immer gegeben. In ihnen taten die Gläubigen ihre Pflicht, wo auch immer der für sie bestimmte Platz war, auf dem Feld oder in der Heimat. In altertümlichen, befremdlich anmutenden Wendungen gedachte die Großmutter Seiner Führung, Seiner Gnade. Der Herr geleitete die Seinen durch finstere Täler. Während des Lesens hatte Anna ein anderes Bild aus dem 23. Psalm vor Augen, wie der Herr den Seinen einen Tisch im Angesicht seiner Feinde bereitete, und es wunderte sie nicht, dass die Großmutter zum Ende ihres Lebenslaufs gerade aus diesem Psalm des Königs David zitierte, den Anna als Kind mit zwiespältigen Gefühlen gelernt hatte. Durfte man essen, sich im Angesicht der Feinde ein Mahl bereiten lassen, während die Feinde hungerten?
Ravensburg, Ende 1967
Ob es mir gelingen wird, in meinem 85. Lebensjahr mit abnehmenden Sinnen und Gedächtnis noch einmal ein Stück Vergangenheit lebendig zu machen? Im ersten Teil meines Lebenslaufs wollte ich berichten, was Gott in meinem und meiner Familie Leben getan hat. Nur seine Gnade zu bezeugen und Euch nicht vorzuenthalten bewegt mich zu dem Versuch zu erzählen, wie es weiterging.
Lange war uns der Aufenthalt meines zweiten Sohnes Friedemann bei Kriegsbeginn unbekannt, bis die Nachricht kam: Westwall, nicht Polen. Noch einmal geschenktes Leben.
Mein ältester Sohn Johannes wurde erst im Januar 1940 nach Hamburg eingezogen. Er war durch kurze Übungen schon Feldwebel geworden und nun Offiziersanwärter. Kurz zuvor war Friedemann als Unteroffizier vom Westwall nach Hamburg versetzt worden. Das war für die so innig verbundenen Brüder noch einmal kostbare Gemeinschaft. Ein gleichgesinnter kleiner Freundeskreis bildete sich um sie. Beide Brüder hatten es vorgezogen, sich nicht von ihren Kameraden zu unterscheiden, als gewöhnliche Soldaten in den Krieg zu ziehen und sich nicht als Feldgeistliche zu bewerben. Mein Ältester besuchte uns zu Ostern 1940 und hörte zu seiner Freude eine Osterpredigt von Magister Frey, dessen Werke er besaß und verehrte. Bei einem Gespräch über den Krieg sagte Johannes zu mir: Mutter, ich komme wieder, denn Gott hat mich ja zum Prediger berufen! Unwillkürlich antwortete ich: Johannes, wir sehen ja hier nur den Anfang! Später erfuhr ich, dass ihm dieses Wort nachgegangen sei und er sich auf die Möglichkeit des Soldatentodes vorbereitet habe. Einmal noch hielt er bei einem befreundeten Pfarrer eine nach dessen Urteil gesegnete Predigt. Dann kam er nach Aachen und schrieb mir von dort noch einen Abschiedsgruß, welcher schloss: In tiefem Frieden, Dein Johannes. Es kam noch eine Nachricht, die Feuertaufe meldete, und dann, bei der ersten direkten Feindbegegnung erhielt er den tödlichen Schuss als Zugführer beim Sturm auf einen Bahnübergang am 24. Mai 1940 in Frankreich. Bald erfuhr ich Näheres über den Abschluss seines Lebens. Aus drei verschiedenen Kameradenberichten ging hervor, dass er laut betend schnell verschieden sei und dass ihm bei der erst nach Tagen stattgefundenen Bestattung die Bibel in der erstarrten Hand mitgegeben worden sei. Und dann kamen Briefe über Briefe, die von dem Segen seines kurzen Lebens und Wirkens Zeugnis gaben, so wussten wir: Der Herr hatte ihn reifen lassen und ihn vollendet und berufen zum Dienst in seinem Reich in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit.
Ende Oktober 1940 wurde in Hannover (wo Elisabeth wieder in der Nähe ihrer Eltern wohnte) Friedemann und Elisabeth ihr erstes Töchterlein geboren. Zweimal im Urlaub hat er sich noch an diesem seinem Rosenknösplein erfreuen dürfen. Er war in Belgien und kam später nach Rumänien, aber noch nicht zum Fronteinsatz. Im Sommer 1941 besuchte uns Elisabeth mit ihrer kleinen Tochter, die zu ihrem blinden Urgroßvater ein ganz persönliches Verhältnis gewann. Er fühlte, hörte und sprach mit ihr, später diktierte er mir auch Briefe und kleine Gedichte für sie. Elisabeth schrieb täglich an ihren Mann. Das Echo kam unregelmäßig (Feldpost), aber wir erlebten doch viele Briefe mit. Eine liebliche Zeit. Elisabeth, die im Dezember ein zweites Kindlein erwartete, kehrte mit ihrem Töchterlein wieder nach Hannover zurück. Im Herbst kam Friedemann, der lange Zeit nur Geräte zu warten hatte, wieder zu seiner Truppe auf die Krim, von wo aus er frohe Briefe schrieb. Der Freundeskreis hatte ihn freudig begrüßt, und seine kleine Familie beglückte ihn in der Ferne. Mit einem Kameraden - er wollte mit ihm ungestört über Jesus sprechen - stieg er im freiwilligen Einsatz auf die schneebedeckten Höhen des Jalta-Gebirges (Patrouillengang, Jalta, 9. November 1941). Man fand die beiden am nächsten Morgen mit Kopfschüssen tot im Schnee. Verwaist die kleine Familie. - Das zweite Töchterlein wurde am 3. Dezember geboren. Erst acht Tage danach erfuhr Elisabeth, dass sie Witwe sei. Man hatte den Tod nicht ihr, sondern mir zuerst mitgeteilt wegen ihrer Hoffnung. Dadurch kam auch diesmal das Echo in großer Fülle zu uns nach Gottshut. Wieder waren es überwältigende Zeugnisse von dem Segen dieses früh vollendeten Lebens.
Aber die kleine Familie ...
Mein jüngster Sohn Armin, der nach dem Arbeitsdienst als Fahnenjunker in den Krieg zog, war an der Front in Frankreich und dann in Russland, wo er Leutnant wurde und durch eine schwere Verwundung - er verlor durch Granatsplitter die halbe rechte Hand - wieder in die Heimat kam. Als Genesender war er im Winter 1942 längere Zeit bei uns in Gottshut. In diesen Winter fällt auch meine Erkrankung an einer schweren Lungenentzündung, mein Vater war gleichzeitig erkrankt, und wir wurden beide von lieben Bruderbundschwestern vorbildlich gepflegt. Ich erholte mich nur langsam, aber hinterher wirkte sich die Krankheit als Regeneration aus. Auch der Vater wurde wieder gesund. Wir nahmen die täglichen Spaziergänge wieder auf, das Vorlesen (gut organisiert mit viel freundlicher Hilfe), besuchten alle Gottesdienste: auf der vordersten Bank der Bruderseite, dicht vor dem Liturgustisch, saßen wir. Mit dem Hörrohr konnte der Vater noch folgen.
Hilde war nach Beendigung ihrer Ausbildung in Dresden tätig und häufig unser Gast. Zuletzt arbeitete sie in Stettin und wurde im Winter 1943 ausgebombt. Sie kam daraufhin ganz zu uns und fand Arbeit in Gottshut. Das führte zu ihrer Verlobung mit Heiner Herrlich, aus einer Familie stammend, mit der Armin eng befreundet war. Am 5. Oktober 1943 erfolgte ihre Kriegstrauung. Der Großvater nahm lebhaften und freudigen Anteil. Am Polterabend erzählte er aus seinem Leben, und zum Schluss segnete er das Brautpaar mit Handauflegung. Dann zogen die Männer wieder in den Krieg. Heiner war als Obermaat aktiv bei der Marine, kam aber eines Knieschadens wegen nicht auf See. Armin kam nach seiner Ausheilung an die Unteroffiziersschule in Ettlingen bei Karlsruhe und erst im Winter 1944/45 mit der Kriegsschule noch einmal zum Einsatz.
Weihnachten 1943 feierten wir drei, Vater, Hilde und ich, friedlich vereint. Wie jedes Jahr hatte der Vater mir seine Weihnachtspredigt diktiert für die große Verwandtschaft. Wir besuchten die schönen Gottesdienste und waren ohne Sorge an Allernächste friedlich beieinander. Es wurde in der Woche recht kalt. Ich riet deshalb dem Vater dringend ab, in den Silvestergottesdienst mit dem Jahresbericht zu gehen, weil der Saal nach der Pause erst angeheizt wurde. Er erklärte aber: Da gehe ich immer hin, und ich war gewohnt zu gehorchen. Nach dem Gottesdienst hatte er stark geschwollene Füße und konnte sich nicht selbständig ausziehen und zu Bett legen. Am 1. Januar früh fragte ich ihn zaghaft: Wie geht es dir? - Schlecht, du hast mich nicht gut versorgt, war seine Antwort. Er hatte eben nicht alles gefunden. Die Füße waren in Ordnung. Vater stand auf, tat alles wie immer, und wir gingen in den Neujahrsgottesdienst. Wir speisten sogar noch im Gasthof zu Mittag, wie wir es an Sonn- und Feiertagen zu tun pflegten. Erst nachmittags bekam Vater Fieber und musste sich legen. Die Krankheit wurde aber nicht heftig und quälend. Wieder wurde ich gleichzeitig krank und bekam Fieber. Am 4. Januar abends versorgte ich Vater für die Nacht. Er schien nicht zu leiden, war aber schwach und antwortete kaum. Aber als ich fragte: Soll ich dir noch die Andacht vorlesen? kam ein deutliches Ja. Wir lasen Andachten, die er selbst verfasst hatte unter Zugrundelegung aller Sonntagsperikopen. An der Reihe war der Text Römer 8, 28-32. Danach schien er friedlich einzuschlafen, während ich nebenan auf dem Sofa bei offener Tür schlief Weil ich selber nicht wohl war, kam Hilde frühmorgens, um uns Feuer zu machen. Sie schloss leise die Tür zum Zimmer des Großvaters. Ich ging dann bald hinein und fand ihn genauso daliegend, wie ich ihn am Abend verlassen hatte, entschlafen: Er sah wunderschön aus, sodass ich nur sagte: Hilde, Großvater ist daheim. Seinen Freunden gibt es der Herr schlafend. Das war einer von Vaters Lieblingssprüchen.
Im März 1944 habe ich mich als Mitglied des Bruderbundes aufnehmen lassen, weil ich mit den nun frei gewordenen Kräften in der Gemeinde dienen wollte, durch deren gottesdienstliches Leben ich schon so lange gesegnet worden war. Man blieb auch Mitglied der Lutherkirche. Wir lebten in Gottshut sehr gnädig behütet. Hilde machte wohl im Januar 1945 Gebrauch von der Erlaubnis für Ehefrauen, am Standort ihres Mannes eine Arbeit zu übernehmen, in Bremerhaven, wodurch sie dort ein Zimmer bekam. Erst in den ersten Maitagen wurden die Einwohner Gottshuts aufgefordert, den Ort zu verlassen, um den vordringenden Russen auszuweichen. Mit schwerbepackten Leiterwagen zog ein langer Treck bei großer Wärme auf das Gebirge zu, eigentlich ohne Ziel. Gruppen hatten sich gebildet, und nicht alle konnten Schritt halten, auch in meiner Gruppe. Deshalb zweigten wir uns an einem mir wohlbekannten Scheideweg ab, der nach Kretzschmarsdorf führte, wo meine liebe Cousine und Freundin im eigenen Haus wohnte. Sie nimmt alles auf, was zu ihr kommt, und wenn man auch dort nicht bleiben kann, geht man gemeinsam weiter. Zu neun Personen fanden wir bei Elli Heiland Unterkunft. Der Krieg ließ uns aus. Nur Geschosse flogen über das Dorf und trafen auch ein Gebäude in der Nacht, die wir im Kellergebäude zubrachten. Der große Treck ist von Tieffliegern beschossen worden. Das war am 7. Mai. Es waren noch andere Gottshuter nach Kretzschmarsdorf gekommen, wo überall mit weißen Laken geflaggt war. In der Frühe des 8. Mai klopften Russen an unsere Tür: Frau Urrr! Bei uns war eine junge Baltin, die russisch antworten konnte, und mit zwei Taschenuhren begnügten sie sich. Am frühen Morgen des 9. Mai hieß es: Gottshut brennt. Als die Russen in den Ort kamen, waren Schüsse gefallen, und dafür wurde Vergeltung geübt. Einige treue ältere Gottshuter wagten den Rückweg und konnten noch löschen und einiges retten. So verbrannte die Mitte Gottshuts: Kirche, Schwesternhof, Herrschaftshof, Bruderhof, Apotheke und anderes. Erhalten blieben das Krankenhaus und die Witwenhöfe und was mehr außen herum lag. Drei Tage durfte der Ort straffrei geplündert werden. Langsam kehrten die Einwohner zurück. Wie dankbar war ich, dass mein alter Vater diese Flucht und Heimkehr der Alten und Kranken in Leiterwäglein nicht mehr miterlebte. Es folgte eine wunderbare Zeit (das selten so dauerhaft schöne Frühsommerwetter trug dazu bei), wo unter bewährter geistlicher Führung (die leitenden Brüder legten überall vorbildlich mit Hand an) die äußere Ordnung leidlich wiederhergestellt wurde. Jeder Tag begann mit einer Morgenandacht und einem Arbeitsappell im Garten der stehen gebliebenen bisherigen Mädchenanstalt, die Schwesternhof wurde. In der bisherigen Aula fanden auch Gottesdienste statt. Einer half nach Kräften dem anderen. In den Wohnungen sah es wüst aus. Ich fand aber bei Sichtung der aufgetürmten Haufen so ziemlich den Haushalt wieder. Es war nichts zertrümmert, sogar das Silber da geblieben. Infolge der gestörten Postverbindung wusste ich lange Zeit nicht, wo meine Kinder geblieben seien, bis schließlich ein dicker Brief ankam aus Hannover. Im Hause von Johannes treuer Braut hatten sich alle getroffen und berichteten. Elisabeth wohnte weiterhin bei Hannover. Armin war nach Verlegung der Unteroffiziersschule nach Leslau noch zweimal in großer Lebensgefahr, aber mit einigen Kameraden war ihm das Absetzen von Pommern, dann Blankenburg und schließlich nach Bayern gelungen. Dort war er sechs Wochen in amerikanischer Gefangenschaft und suchte jetzt nach neuer Existenz. Also gnädig behütet. Heiner und Hilde Herrlich wohnten noch in einem Zimmer in Bremerhaven. Sie schrieben, dass sie sich entschlossen hätten, fortan ihr Leben unter Gottes Führung zu stellen. Das war gegen ihre frühere Einstellung eine radikale Wendung zu Gott hin. Das hat mich erschüttert und meinen Kleinglauben tief beschämt. Es war die notvolle Zeit des Hungerns und Frierens und vielfacher Unfreundlichkeiten. Hilde erwartete ihr erstes Kind und verlebte die Wintermonate 45/46 bei Johannes' Braut. Am 16. April 1946 wurde ihr Töchterchen Anna in Bremerhaven geboren. Dort hatte Heiner eine Anstellung bei der Stadt gefunden. Bremerhaven blieb unwirtlich, und sie waren einsam. Als meine Untermieter auszogen, lud ich sie darum ein, deren Platz einzunehmen. Es fand sich eine Anstellung am Amtsgericht, und sie entschlossen sich zur Heimkehr nach Gottshut. Mein Sohn Armin hat stark abgeraten, zu den Russen zu gehen. Wir haben es für unsere Führung gehalten. So kamen Herrlichs zu mir, im Herbst 1946, mit ihrer kleinen Anna. Sie haben sich bald in der christlichen Gemeinschaft wohl und geborgen gefühlt. Ich hatte wieder eine neue Lebensaufgabe.
Kein Wort von Schuld, dachte Anna. Frühe Vollendung der Gerechten. Gnädiges Behüten und Führung der Getreuen und der noch Ungetreuen. Immerhin war in Annas Kindheit noch von Schuld die Rede gewesen, Schuld, die ein ganzes Volk auf sich geladen hatte und an der Anna beteiligt war. Gern hätte sie Schuld abgetragen, denn Schuld auf sich zu nehmen und zu tragen, war ja ein Teil der christlichen Lehre. Die Großmutter hatte das Leben einer bisweilen Kleingläubigen geführt, einer, die im Alltag einmal versagte. Doch von mehr Schuld wusste sie nicht. Wie ähnlich war diese Haltung der neuen Lebenseinstellung der Eltern, die sich als Erwählte Gottes von der Welt abschlossen und allein ihrem Gott lebten.
Ich greife zurück, um zu berichten, dass ich bald nach Mutters Heimgang (August 1937) in Gottshut gebeten wurde, die erkrankte Kreismutter des dortigen großen Kreises des Deutschen-Frauen-Missions-Gebetsbundes (DFMGB) abzulösen, weil ich in Hannover so stark in diese Arbeit hineingewachsen war. Es handelte sich um eine Monatsstunde des Missionsgebets-Bundes. Durch diesen Kreis wurde mir Gottshut zur Heimat. Hier gab es keine Enge. Veranstaltungen fremder Reichsgottesarbeiten, sofern sie klar biblisch ausgerichtet waren, wurden freudig begrüßt, guter Raum zur Verfügung gestellt, auch Gäste zum Übernachten großzügig untergebracht. So durfte auch unser Kreis Besuch haben von unseren Missionarinnen (aus China, Palästina, Afrika) und von den Führerinnen: Gertrud und Maria von Bülow, Bezirksmutter Gräfin von der Recke. Das war eine große Bereicherung. Der DFMGB steht auf Allianzboden, deshalb kamen zu unserer Gebetsstunde auch freikirchliche Mitglieder, die allen zum Segen wurden. Auch während der schweren Nachkriegsjahre hat es solche Höhepunkte gegeben.
Das Alltagsleben war ausgefüllt durch Beschaffung der täglichen Nahrung: Ährenlesen, Kartoffeln- und Rübenstoppeln und dergleichen. Das Ährenlesen habe ich in schöner Erinnerung: bei strahlend blauem Himmel, in der lieblichen Landschaft auf weiten Feldern noch einzelne Ähren zu entdecken. Durch die Schrotmühle gemahlen, ergaben diese Körner ein sehr geschätztes Frühstück. Unsere kleine Anna gedieh trotzdem. Es wurde auf den Gütern viel Kohl gezogen, nicht gerade für unsere Ernährung. Lastwagen holten ihn fort. Aber die äußeren Blätter wurden vorher entfernt, und wir durften sie verwenden. Ich erinnere mich, die kleine Anna mit durchgeschlagenen Kohlblättern, die mit geriebenem Leinsamenkuchen angedickt wurden, gefüttert zu haben. Den letzteren wie auch den beliebten Mohnsamenkuchen lieferte uns die Ölmühle als begehrten Ernährungszusatz. Des weiteren verwendeten wir viel Molke, was Heiner, meinen Schwiegersohn, zu dem scherzhaften Gedicht: Molken, Molken, Molken, Molken, Mutter (ich) schwebt in tausend Wolken veranlasste. Etwas eigener Schrebergarten hat auch geholfen.
Anna hatte am 9. Oktober 47 ein sehr zartes Schwesterlein, Mechthild, bekommen.
Ich habe noch kaum die Herzensfreundin erwähnt, die mir für die Gottshuter Jahre geschenkt wurde als ein Licht auf meinem Wege. Ich war doch zunächst dort einsam, aus dem reichen Familienleben in Hannover und all der schönen Gemeinschaft da kommend. Diese meine zehn Jahre jüngere Elli lebte in Kretzschmarsdorf am Kretzschmar im eigenen Haus und Garten mit ihrem über 90 jährigen Vater bis zu dessen Heimgang, später allein. Sie hatte ihren Mann, meinen Vetter, im ersten Weltkrieg verloren. (August 1914 fiel er vor Paris.) Sie war mit ihm acht Jahre verlobt und nur ein Vierteljahr verheiratet und war zu lebendigem Glauben gekommen. Wir waren also in ähnlicher Lage und haben in diesen siebzehn Jahren Leid und Freude miteinander geteilt. Den schönen Waldberg Kretzschmar, 600 m hoch, sahen wir immer vom Fenster unserer Wohnküche aus, dahinter die Kette des Gebirges, 900-1000 m hoch. Wie oft habe ich den Enkelkindern den Berg gezeigt, hinter dem Tante Ellis Haus stand. Wir wanderten durch schönen Wald eineinhalb Stunden auf den Kretzschmar und wieder hinab noch eine gute halbe Stunde. Wie oft haben wir uns gegenseitig besucht und ausgetauscht. In den anstrengenden Jahren mit den kleinen Enkelkindern bin ich auch ab und zu für ein Wochenende zu ihr geflüchtet. Sie war körperlich nicht sehr stabil, aber wenn es um Liebesdienste ging, erstaunlich leistungsfähig. Ich bin jetzt noch dankbar, dass sie mich später noch zweimal bei meinem Sohn besuchen und sich pflegen lassen konnte. Und als der Herr sie unerwartet schnell heimrief, hatte sie wieder gerade die Genehmigung zu einem Besuch erhalten.
Mit dem Januar 1949 hatte ein ereignisreiches Jahr begonnen. Zwei kleine Mädchen, Schwierigkeiten der Nahrungsbeschaffung u. a. In diesem Sommer bin ich wieder schwer krank geworden. Es war die Zeit des Bohnenerntens und -einmachens. - In unserem geistlichen Erleben hatte auch das Gebiet der Gebetsheilung eine Rolle gespielt. Wir hatten eine Gebetserhörung erlebt bei der schweren Mittelohrentzündung unserer kleinen Anna, durch welche die schon vorgesehene Aufmeißelung vermieden wurde. jetzt nun befiel mich hohes Fieber. (Ich kämpfte dabei weiter mit den Bohnen.) Es hielt acht Tage an. Der Arzt konnte keinen Grund erkennen und fasste Typhusverdacht und wollte mich in das Infektionskrankenhaus in G. zur Untersuchung einweisen, das von der Hitlerzeit her einen schlechten Ruf hatte. Ich schlug meinem Schwiegersohn vor, vorher doch mit mir nach Jakobus 5 zu handeln. Der Arzt ging darauf ein. Mir war in meinem Fieber das Wort über Petri Schwiegermutter im Sinn: Sie stand auf und diente ihnen. Heiner bat um Besuch der Ältesten. Es kamen zu mir Bruder Siegfried Borchert (der Bischof), Bruder Gregor (der Prediger) und die Witwenpflegerin Schwester Möller. Sie beteten unter Handauflegung. Es geschah zunächst nichts. Ich wurde mit dem Krankenauto nach G. gebracht. Dort hielt das Fieber noch vierzehn Tage an, mit großer Schwäche und völliger Appetitlosigkeit, aber dann trat langsam Besserung ein. Ich bin sehr gut gepflegt worden. Das Vorurteil (das Haus gehörte zur Landes-Heil- und Pflegeanstalt) war unbegründet.
Euthanasie, dachte Anna. Das Wort war der Großmutter nicht in die Feder gekommen. Alles in ihr hatte sich dagegen gesträubt, diese schrecklichen Dinge auszusprechen und sie damit nicht nur für wahrscheinlich, sondern für wahr zu halten. Wie gern befreite sich die Großmutter von einem schlimmen Verdacht.
Ebenso der Typhusverdacht meines Arztes. Aber ich musste sieben Wochen nach Vorschrift dort bleiben. Herrliches Sommerwetter! Bald konnte ich tagsüber im schönen Garten liegen. Die Verpflegung war viel besser als zu Haus und nur wenige Patienten im Haus zur Beobachtung. Ich bekam dort die Erholung, die ich nach anstrengenden Jahren dringend brauchte, die ich mir aber nie hätte leisten können bei DM 90 Rente. Der Segen des Gebets umgab mich fühlbar, eine wunderbare Zeit der Stille,
Stille ja, dachte Anna, denn wo waren die Pfleglinge geblieben, die Irren, die Verrückten?
in der ich auch große Teile der Bibel fortlaufend gelesen habe. Ich kam langsam wieder zu Kräften, war aber doch etwas schwankend auf den Füßen bei der Entlassung. Diese wunderbar geschenkte Erholung hat gereicht, bis ich dann, auch unerwartet, 1953 in den Feierabend versetzt wurde.
Von jetzt ab ist mir der zeitliche Verlauf nicht mehr ganz klar. Heiner war wohl noch Angestellter am Amtsgericht, wo er u. a. das Grundbuch zu führen hatte. Eines Tages erhielt er aus Gesinnungsgründen eine Kündigung. Aber mit einem Vierteljahr Frist. Durch alles Erleben und die geschwisterliche Gemeinschaft hatte sich sein Glauben vertieft und Berufung zum Zeugendienst mit dem Wort war ihm deutlich geworden. Wir hatten in Gottshut eine gläubige Freundin, die der Pfingstbewegung nahestand. Diese riet zum Fortgehen über Berlin und Beginn mit dem Zeugnis auf der Straße. Dazu entschloss sich Heiner nicht. Er erbat vom Herrn einen geordneten Ausbildungsweg und schrieb viele Bewerbungsbriefe ohne greifbaren Erfolg. In diesen entscheidenden Wochen folgte Hilde einer Einladung der Bundesmutter zu einer DFMGB-Konferenz nach Magdeburg. (Ich hatte um Einladung gebeten.) Dort sagte man ihr von der Predigerschule in Wittenberq, einer neueren Ausbildungsstätte der Landeskirche. Heiner hatte sich zuerst an die Direktion in Gottshut gewendet, die aber damals kein Stipendium gewähren konnte. Er meldete sich in Wittenberg und erhielt sofort bejahende Antwort: Kostenlose Ausbildung dreieinhalb Jahre unter Verpflichtung zum kirchlichen Dienst in der ehemaligen Provinz Sachsen, meiner Kindheitsheimat. Das Programm der Schule erfüllte mich mit Freude: Wir wollen nicht halbe Theologen, sondern schlichte Prediger des Evangeliums ausbilden. Heiner ging freudig darauf ein, und er überließ dem Herrn die Versorgung seiner Familie, wozu mein bescheidenes Einkommen und meine Arbeitshilfe wesentlich beitrugen. Hilde bekam Arbeit und Verdienst bei der Erwerbshilfe, die Bischof Borchert aufgebaut hatte und die vielen Frauen geholfen hat. Die Kinder (ab Januar 1950 waren es drei, Erdmuthe war dazugekommen) konnten durch mich versorgt werden. Für Heiner hatten wir die Wäsche zu besorgen und ein Taschengeld aufzubringen. Es hat uns in den drei Jahren nie am Notwendigsten gemangelt. Geholfen haben die Gebetsdienst-Geschwister durch eine monatliche Sammlung bei lauter bescheidenen Einkünften.
Die Eltern haben sich also von Anfang an so verhalten, dachte Anna und war verblüfft, dass die große Sorglosigkeit, mit der ihre Eltern den Dingen des Alltags begegneten, nicht etwas war, was sich erst in den letzten Jahren ausgeprägt hatte. Sie überließen Gott und damit ihrer Umwelt nicht nur die großen Dinge, sondern oft auch die kleinen. In dem sie alle Sorge auf Ihn warfen, durften sie friedlich und aller Verantwortung ledig in den Tag hineinleben. Er war es, der gab, der nahm.
Im Mai 1953 bekam Heiner sein erstes Pfarramt in Syhlen im Mansfelder Raum. Wir lösten den elterlichen Haushalt auf, mit dessen Hausrat das große alte Pfarrhaus notdürftig eingerichtet werden konnte. Ich bekam ein Zimmer im Witwenhof und gemeinsame Küche mit einer sehr lieben Schwester. Ich hatte unsere Wohnung nach vielen Jahren zu räumen und richtete mich nun im Witwenhof ein, während Elli Heiland die zwei kleinen Mädchen, Mechthild und Erdmuthe, zu sich nach Kretzschmarsdorf einlud. - Mit den Enkelinnen reiste ich dann im August nach Syhlen, erlebte Heiners Einführung (Ordination erfolgte 1955) mit und den nicht ganz leichten Anfang. Die Einrichtung war notdürftig und das Einkommen gering. Das Pfarrhaus hatte ein großes Anwesen mit einer Art Park, großem Hof mit Ställen und Taubenschlag und Obstgärten. Diese erbrachten eine kaum zu bewältigende Pflaumenernte, mir unvergesslich. Al1e Kräfte waren angespannt. In diese Lage hinein kam ein Brief meines Jüngsten, Armin, in dem er mich aufforderte, sobald als möglich mit Besuchspass zu ihm zu kommen, weil ich jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit auf Erfolg meine Witwenpension beantragen konnte. Dies erschien mir als die Erhörung unserer Gebete um Durchhilfe und als neue Weisung für mich. Also Trennung vom geliebten Gottshut.
Ich hatte dort den Pass zu beantragen und vier Wochen darauf zu warten, Zeit zum Abschiednehmen und besonders auch vom DFMGB-Kreis, dem ich seit 1937 als Kreismutter dienen durfte.
Ich kam nach Rechtesheim zu Armin. Er konnte soeben seine Familie selbst ernähren und arbeitete in Karlsruhe als Assistenzarzt. Es dauerte einige Monate, aber die Pension wurde dann vom August 1953 ab gezahlt. Damit kam ich in die Lage, dem Pfarrhaus in Syhlen wesentlich zu helfen. In Armins Haus wuchsen die vier Töchter mit großem Altersunterschied heran, sodass sie getrennte Zimmer brauchten. Als dies deutlich wurde, begab es sich, dass unsere Gemeindeschwester Elise wusste, in Ravensburg sei bei ihren Hensoldshöher Schwestern ein Zimmer mit Ganzversorgung zu vermieten. Das war für mich wieder eine Weisung, bedeutete aber meinen Übergang zum endgültigen Feierabend im Alter von 82 Jahren. Mit einem Wort aus dem 23. Psalm möchte ich schließen:
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Anna legte das Heft beiseite. Auch der Aufenthalt bei den Hensoldshöher Schwestern war noch nicht die letzte Station der Großmutter gewesen. Die letzten Jahre verbrachte sie wieder bei ihrem Sohn Armin und ihrer Schwiegertochter.
Anna war sicher, dass ein erster Teil des Lebenslaufes der Großmutter existierte. Dunkel erinnerte sie sich an einige Bilder aus der Kindheit der Großmutter. Der Lebenslauf war lange verschollen, dann nach einigen Umzügen wieder aufgetaucht. Doch bevor die Mutter ihn Anna aushändigte, hatte sie ihn wieder verlegt. Anna durchwühlte den Truheninhalt, fand aber nichts.
Statt dessen stieß sie auf ein ihr bisher unbekanntes, von Kinderhand umstochenes Heftehen. blätterte in ihm und lächelte. Die Mutter, zuweilen auch der Vater, hatten einige Zeit ein Tagebuch über ihren Erstling Anna geführt. Die genaue Geburtsstunde war vermerkt. Nie kommen die Kinder bei Ebbe, immer bei Flut, hatte die Mutter den Vater einmal belehrt. Gewicht, Größe, Kopfumfang notiert. Schwierigkeiten der ersten vier Wochen, nicht verheilende Geschwüre an den Beinen. Anna schreit Tag und Nacht. Eine Eintragung zum Tauftag:
16. Juni. Trinitatis-Sonntag. Großvater Krögers 10. Todestag. Unvergesslich schöner Tag, trotz ungewisser Witterung. Tante H. W. der einzige Gast. Bruder Pastor B. tauft über der Geburtstagslosung. Nur Mückelchen (Wurm!) schreit, schreit. Mutter will versinken vor Scham. Während Tante H. singt: Geh aus mein Herz! wird sie plötzlich still.
Jede Entwicklungsstufe war sorgfältig eingetragen. Die Mahlzeitenfolge. 3 x Brust und 1 x Brei. Um 18 Uhr zuletzt. Das freie Sitzen. Über die Reise von Bremerhaven nach Gottshut schrieb der Vater: Schwer bepackt, unser Kleinchen in einer Art selbst gefertigten großen Einkaufstasche, reisten wir am 17.10.46 ab. Bremerhaven - Friedland - Halle. In Halle, wo wir stundenlang standen, ereilte uns alle ein großer Schreck. Das Stellwerk hatte versehentlich einen Güterwagen in voller Fahrt auf unseren Zug, in dessen letztem Wagen wir saßen, auffahren lassen. Alles Gepäck stürzte herunter. Eine Zentnerkiste war auf die Bank gefallen, auf der ich sonst saß und zeitweilig Mückelchen stand. Ich aber hatte mich gerade aus irgendeinem Grund erhoben, und unser Kleinchen war auf der gegenüberliegenden Bank abgestellt. Nur Anna blieb bester Laune. Sie hat die Reise am besten überstanden und war während der ganzen Fahrt von einer fast rührenden Bravheit, lachte jeden an, krakelte immerzu stillvergnügt vor sich hin und amüsierte sich prächtig.
Weihnachten in Gottshut. Wann sie zum ersten Mal das Wort Mutter sagte. Ihre beliebteste Schlafhaltung: Mit angezogenen Beinen lag sie auf Brust, Bauch und Unterschenkeln. Freihändiges Stehen. Selbständiges Laufen. Töpfchenerfolge. Im März 1948, kurz vor ihrem zweiten Geburtstag, wurde sie in den Kindergarten gegeben. Überrascht las Anna diese letzte Notiz im Heftchen. Sicher auch für Gottshuter Verhältnisse damals ungewöhnlich, ein zweijähriges Kind der Obhut des Kindergartens zu überlassen. Ein erster Hinweis dafür, dass Anna nach der Geburt ihrer Schwester Mechthild zu anstrengend wurde?
Anna nahm den Ordner mit den Briefen aus den ersten Ehejahren der Eltern zur Hand. In den Briefen an Verwandte, Paten schrieben die Eltern von Annas Geschicklichkeit und erfreulicher Intelligenz, einem nicht zu sättigenden Zärtlichkeitsbedürfnis. Durch Küsse sei sie rasch zu beschwichtigen. Immer wieder erwähnt wurde ihr Eigensinn (Weder gutes Zureden noch schlimmste Prügel helfen.), ihre Stimmungslabilität.
Ein Stimmungsmensch, schrieb der Vater, sehr bewusst, versteht fast alles. Im Spielen und Wesen sehr originell und beliebt bei groß und klein. Aber sie bleibt sich gleich. Erziehungserfolge sind leider keine anzumelden.
Wie der Vater an Anna hing, ging aus einem Brief hervor, den er an die im Westen zur Kur weilende Mutter schrieb. Er nannte sie ein Sonnenscheinchen, mein kleiner, drolliger Kamerad. Die letzten Briefe vom Sommer 1949. Dann begann die Ausbildung des Vaters im Predigerseminar. Das Familienleben rückte in den Hintergrund.
Wahrscheinlich hat es den Eltern nicht an Liebe gefehlt, dachte Anna. Nur an Kraft und Vermögen, sie umzusetzen. Sie haben viele Reaktionen falsch gedeutet, zu schnell waren sie in ihrem Urteil. Anna bewahrte viele glückliche Augenblicke ihrer Kindheit im Gedächtnis. Doch überwiegend war das Gefühl von Kränkung, dass ihr unrecht getan worden sei.
Anna suchte unter den Fotoalben das heraus, das sie am liebsten anschaute. Sie hatte darin ein paar Jugendfotos der Eltern eingeklebt, die ihr in die Hand gekommen waren, und alle Fotos aus der Zeit in Bremerhaven und Gottshut. Auf dem ersten Foto mochte der Vater achtzehn, neunzehn Jahre sein. Der Typ eines nordischen Eroberers: helläugig, braun gebrannt, die blonden, leicht gewellten Haare nach hinten gekämmt, die Augenbrauenbögen traten hervor, schmale Hakennase, starke Kinnbacken, die Lippen locker aufliegend und geschwungen. So einen Jungen konnte man formen. Anna war unbehaglich, nicht nur des glänzenden Symbols wegen auf der Uniformbluse: auffliegender Adler, in seinen Krallen den mit einem Hakenkreuz gezeichneten Erdball.
Vier, fünf Jahre später die Eltern kurz vor oder nach ihrer Trauung 1943: Der Vater, blass, kindlich staunend, neigte den Kopf seiner jungen Frau zu. Die Mutter blond wie der Vater, die langen, gekrausten Haare gaben die schöne Stirn frei, offene helle Augen, eine lange, gerade Nase, der breite Mund leicht geöffnet, ausgeformte Jochbögen, schmales Kinn. Der mädchenhaft schlanke Körper, im selbst gestrickten eng anliegenden Rollkragenpullover gut sichtbar, schmiegte sich an die feste Matrosenjacke an. Unglaubwürdig, dass sie fünfeinhalb Jahre älter als Annas Vater war.
Anna kam kaum von diesem Foto los. Zum ersten Mal entdeckte sie sich nicht nur in der Mutter, sondern auch in diesem jugendlichen Vater.
Chronologisch geordnet Fotos vom weiteren Verlauf der Ehe. Fasching. Aufnahmen am Strand. Elegant, an einen schönen alten Kachelofen gelehnt, die Mutter. Der Vater pfeiferauchend auf einem Sofa. Der kindliche Ausdruck war einem männlich-ironischen gewichen. Wieder ein Strandfoto: 14. Juli 1946 stand darunter. Zwei Ehepaare, eines davon die Eltern, mit ihren Kindern. Die Mutter hatte nur einen Blick für ihren Säugling, das winzige Etwas, das sie im Arm hielt: Anna.
In Gottshut angekommen, ging die Mutter Ende November 1946 sogleich mit ihrer halbjährigen Tochter zum Gottshuter Fotografen Holan, der sämtliche wichtigen Ereignisse nicht nur im Leben der Eltern, sondern aller Gottshuter festhielt.
Drei Varianten vom dicken Baby Anna mit und ohne Mützchen. Die Mutter trug ein zum Turban gebundenes Kopftuch.
Ab 1947 kam Annas Schwester Mechthild mit ins Bild. 1950 erschien Erdmuthe als Täufling auf einem Foto mit den Eltern. Der Vater ernst, müde. Die Mutter dagegen völlig ihrem erneuten Mutterglück hingegeben.
Ein Foto vom Sommer 1950: Auf einem Wäscheplan hinter dem Haus. Ein dickes, halbjähriges Baby ruhte auf Annas Schultern. Die Vierjährige stand wie Christophorus unter der Last gebeugt, tapfer lächelnd, den Blick vor Anstrengung auf den Rasen zu ihren Füßen gerichtet. Über ihrem Kleid baumelte ein runder, gehäkelter Taschentuchbehälter. Die Mutter hinter Anna hatte das Baby unter den Achseln fest im Griff, prüfte Annas Belastbarkeit, hielt ihr Gesicht an das des Babys. Neben der Mutter der Vater, die Haare glatt zurückgekämmt, müde das Gesicht, abgehärmt. Mit der einen Hand berührte er die Schulter der mittleren der drei Schwestern. Mechthild stand X-beinig, pummlig vor ihm, griff dem Vater ans Hosenbein, die andere Hand reichte sie vertrauensvoll zu ihm herauf und sah zu dem Baby auf Annas Schultern.
Im Januar 1951 wanderte die Familie noch einmal zum Fotografen Holan. Es war das vorläufig letzte Foto, das Anna mit ihren Eltern und Schwestern zeigte. Ihre Abreise nach Rosenstetten im Schwarzwald, wo eine Cousine der Mutter ein Kinderheim führte, wahrscheinlich schon beschlossene Sache.
Links im Bild der Vater mit Mechthild, erholter und jünger aussehend als auf dem Sommerfoto. Mechthild eine große Schleife im Haar, ein Porzellanpüppchengesicht, rund, kleines Näschen, kleiner Mund. Man hatte ihr einen Stoffmatrosen in die Hand gedrückt. Sie überließ sich der Hand des Vaters, die unter ihrem Arm im Stoff des bestickten Feiertagskleidchens verschwand. In der Mitte des Bildes zwischen den Eltern die soeben ein Jahr alt gewordene Jüngste. Der hellblonde Flaum zum Scheitel gebürstet, weit aufgerissen die Augen, im Kussmäulchen blinkte die untere Zahnreihe. Die Mutter wandte sich ihr mit ganzer Hingabe zu. Im rechten Bildrand Anna, die eine Hand der Mutter hing kraftlos neben Annas Arm. Doch Anna erkämpfte sich Zuneigung, schmiegte sich an die Schulter der Mutter, stützte einen Arm besitzergreifend auf deren Schenkel, renommierte lächelnd mit ihrem kostbar wirkenden geriehenem Kleidchen aus stark glänzendem, weichem Stoff.
Das rosa Kleid. Anna schloss das Album. Niemals war sie in ein anderes so verliebt gewesen. Es begleitete sie auf ihre Reise in den Westen und war im Kinderheim der Traum von Schönheit, wie sie nur unter den Händen ihrer schönen Mutter entstehen konnte.
Sie hatte in ihrer Kindheit nie danach gefragt, warum die Eltern sie, knapp fünfjährig, für 16 Monate in ein Heim gegeben hatten. Es war damals wie eine Naturkatastrophe über sie hereingebrochen, für die niemanden eine Schuld traf. Nun, da Anna die Zusammenhänge kannte, lagen die Gründe auf der Hand: Der Vater befand sich in einer Ausbildung und war kaum in Gottshut. Die Mutter ging arbeiten, und die Großmutter wurde mit der Erziehung und Versorgung der drei Enkeltöchter nur schwer fertig. Es war nicht ungewöhnlich, sowohl nicht in der Beamtenschicht, aus der die Mutter stammte, als auch erst recht in Gottshut nicht, Kinder in Heimen, in Internaten unterzubringen. Wir hielten dich für so gut aufgehoben bei Tante Ines, hatte die Mutter Anna erklärt. Die herrliche Schwarzwaldluft. Und Tante Ines eine pädagogisch geschulte Kraft! Das Vertrauen der Mutter in geschulte Kräfte war bis heute grenzenlos. Obwohl sich die Mutter zu keiner Zeit den Anforderungen gewachsen fühlte, die eine große Familie stellte, hatte sie immer viele Kinder haben wollen. Sechs Kinder, hatte sie Anna gesagt. War sie mit dem Wunsch nach Kinderreichtum unbewusst vielleicht doch dem faschistischen Ideal von der Frau als Mutter und Versorgerin der Familie gefolgt? Die Mutter wies die Vermutung weit von sich. Sie war dagegen gewesen, gegen die Nazipropaganda, gegen den Bund Deutscher Mädchen. Sie wusste von der Judenvernichtung. Tante Wolff, die Freundin der Familie, war eines der Opfer. Wieweit konnte sich eine begeisterte Pfadfinderin und Sportsmaid, ein Mädchen, das sich nur zu wohl in der Gemeinschaft gleichaltriger Mädchen fühlte, den Einflüssen entziehen, die von der verkündeten Volksgemeinschaft ausgingen?
Als Anna vom Schwarzwald heimkehrte, war nichts mehr so wie vorher. Ihre Gottshuter Kindheitserinnerungen teilten sich streng in die vor Rosenstetten im Schwarzwald und danach. Da musste sie in die Schule gehen statt in den Kindergarten, und die Mutter hatte keine Zeit mehr.
Immer ist es dunkel, wenn Anna aufstehen muss. Dunkel und kalt. Ein nasser Lappen streicht über ihr Gesicht, hält sich bei der Nase auf und klemmt sie ein. Anna biegt den Kopf zur Seite. Der Lappen kommt unerbittlich nach. Dann hat sie das Gesicht wieder frei, der Lappen geht über Arme und Hände und erschreckt ihren Bauch.
Die Schuhe will Anna nicht anziehen. Es sind Schnürschuhe. Schwarze hohe Schnürschuhe. Das Leder so fest, so hart, wie keine Haut von einem Tier sein kann. Die Zehen stoßen sich wund. Aber dem Leder tut es nichts. Die Fersen reiben sich. Dem Leder tut es nichts. Solche Schuhe haben schon sehr viele Kinder getragen. Die Kinder haben kaputte Füße davon gekriegt. Aber die Schuhe gehen nie, nie kaputt. Deshalb werden die Schuhe uralt und quälen nun auch Anna.
Jeden Morgen brüllt Anna, läuft der Großmutter weg, die die Füße in diese schwarzen Schnürschuhe hineinstoßen will. Es ist entsetzlich mit dir, Kind, sagt die Großmutter. Oder nur ihre Augen sagen es. Anna weiß schon, dass es entsetzlich mit ihr ist. Aber schuld sind die geerbten Schuhe.
Einmal kommt der Vater aus dem Schlafzimmer. Anna ist widersetzlich, aber der Vater schimpft nicht. Er spricht ganz freundlich mit Anna. Er sagt, dass die Schuhe sich grämen, weil Anna sie nicht anziehen will. Anna kennt es zwar schon, dass alle Welt ein Recht hat, mit ihr böse zu sein. Aber dass sich auch noch die Schuhe grämen, gefällt ihr nicht. Der Vater erklärt weiter, die Schuhe können nichts dafür, dass der Schuster ihnen so hartes Leder gegeben hat. Sie sind eben arme Schuhe. Und nun will Anna diese armen Schuhe nicht anziehen. Wie traurig müssen da diese armen Schuhe sein. Anna ist beeindruckt. Sie hat nicht gewusst, dass Schuhe traurig sein können. Sie sind wohl etwas Ähnliches wie Tiere. Weil sie stumm sind, können sie sich nicht beklagen.
Und nun will der Vater die Schuhe taufen. Welchen Namen sollen sie bekommen? Der Vater weiß zwei gute Namen, die zu den alten Schuhen passen: Max soll der rechte heißen, Erich der linke.
Anna muss Max und Erich gleich beweisen, dass sie nun ihre Freunde sind und schlüpft in sie hinein. Ganz unerwartet hat sie zwei Freunde bekommen, die viel älter als Anna sind und noch in ihrem hohen Alter die aller niedrigsten Dienste auf dem Boden im Staub verrichten müssen. Anna wird sie achten und mit ihnen sprechen, damit sie sich in ihrem Großvateralter nicht grämen.
Zu dritt trampeln sie durch den dunklen, kalten Morgen. Max, der rechte Schuh, Erich, der linke Schuh, und in der Mitte von beiden Anna. Max und Erich werden Annas Freundschaft nicht vergelten können und Annas Füße deformieren. Es sind ja nur Schuhe. Man hat Anna nicht die Wahrheit gesagt, dass die Schuhe schlecht sind. Aber noch schlechter ist es, barfuß durch den Winter zu gehen.