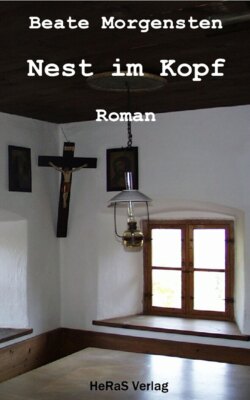Читать книгу Nest im Kopf - Beate Morgenstern - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеWohin Max und Erich jeden Morgen mit Anna laufen: den schmalen Bürgersteig der Hauptstraße entlang, um die gefährliche Ecke bei Abraham Haslinger herum, wo die Menschen manchmal von den Autos an der Wand totgequetscht werden. Von der Ecke träumt Anna zuweilen. Dann in der kleinen Straße ist Anna in Sicherheit. An ihrem Ende befindet sich der Kindergarten des Bruderbundes. Schaut Anna mal zurück, ganz am anderen Ende über zwei Kreuzungen hinweg ist der kommunale Kindergarten. Es sind arme Kinder, die in den Kindergarten da oben müssen. Die kleine Straße zum Hauptkindergarten ist sehr nett. Es duftet warm nach Mohnkuchen von der Ölmühle. Die hölzernen Schiebetüren hoch über dem Boden sind noch geschlossen. Am Tag dürfen sich die Kinder von den Männern die dicken Fladen holen. Sie brauchen bloß hinzugehen und zu fragen. Schon kriegen sie welche. Über dem Ölmühlendach ist am Himmel ein Feuer angezündet. Anna schaut auf die lange Mauer, in die ein winziges Häuschen eingelassen ist. Sie versteht nicht, warum dort eine Mauer ist und erst recht nicht, was das Häuschen soll. Dahinter sind doch bloß Ruinen. Eine Mauer gehört um einen Hof, und in einem so kleinen Häuschen ohne Fenster kann sowieso niemand wohnen. Sie stehen da ohne Sinn in der Gegend. Dann interessiert Anna noch der schwarze Löschteich neben dem Kindergarten. Immer muss sie am Zaun stehen bleiben und in den Pfuhl sehen. Wenn es wirklich einmal etwas zu löschen gäbe, würde das Schlammwasser die Schläuche verstopfen. Dass die Erwachsenen so dumm sind und nicht dran denken.
Das Kindergartenhaus ist von außen zum Fürchten hässlich, ein großes graues Kastenhaus. Aber drinnen sind ein Haufen Kinder, ein Haufen Spielsachen und ein paar nette Tanten, von denen Anna eine besonders mag, weil sie immer lacht. In ihren schwarzen Lockendutthaaren sind schon ein paar silberne Fäden, und ihre Augen kriegen beim Lachen Strahlen ringsum wie die Sonne, die Anna malt. Am meisten freut sich Anna auf Paulchen Weinreich. Der hat auch braun-gelbe Sonnenstrahlaugen.
Eine Tante steht im Flur und wartet, bis alle Kinder gekommen sind. Sie hilft beim Ausziehen. Dann sucht Anna nach Paulchen. Haben sie sich gesehen, ist es gut. Sie können auch mal mit anderen Kindern spielen. Paulchen hat noch zwei Freunde. Der eine ist fast richtig Annas Freund, ein langer Junge, vor dem anderen hat sie ein bisschen Angst, weil er zu schön ist und etwas fremd, als käme er gar nicht aus Gottshut. Anna hat noch eine Freundin im Kindergarten. Aber meistens spielt sie mit ihr, wenn der Kindergarten aus ist. Sie wohnt im Nachbarhaus von Anna und ist die Tochter vom Friseur. Die Friseurfamilie sind nur Leute. Sie gehören nicht zum Bruderbund. Anna macht das nichts aus.
Jeden Tag außer im Winter und bei Regen gehen sie mit dem Kindergarten spazieren. Anna mag das Zuzweit-und-zwei-Spazierengehen, sich bei den Händen fassen und laut sein. Gleich vom Kindergarten aus laufen die Füße wie von selbst die kurze Allee an der Brüderwiese hinunter zum Ebersbach. Der rauscht gewaltig in der Tiefe. Man hört ihn schon von weitem. Und er stinkt wunderbar nach den Bleichteichen. Im Sommer dürfen sie an einer Stelle die Böschung hinunterklettern und mit den Füßen hinein. Dann saugen sich die Blutegel fest, und man muss aufpassen, dass man auf den glatten Felssteinen nicht ausrutscht. Wenn kein Sommer ist, schauen sie nur durch die Bäume hinunter und erlaben sich an seinem Rauschen und Stinken. Meistens gehen sie den Langsamen Tod hinauf wieder in den Ort und zeigen sich. Die Leute sollen nur sehen, wie viele Kinder sie sind. Oder sie stromern auf dem Berg herum, auf dem im Herbst die Bäume ihre Bucheckern herunterfallen lassen. Die knacken sie auf und essen sie. Anna tut es leid, dass sie nicht auch noch die Eicheln aufessen oder einfach wie ein Schwein mit dem Rüssel auf dem Boden entlangschnorcheln kann. Im Wald sammeln sie auch allerhand zum Basteln, die glatten Kastanien, Eicheln, Kienäpfel, Tannenzapfen. Die Tanten wissen, was man draus machen kann. Man braucht fast nur Streichhölzer, dann hat man eine ganze Tiergesellschaft zusammen, die mit den Kindern überwintert.
Nach dem Kindergarten holen Anna und Paulchen ihre Mütter von der Arbeit ab. Sie gehen zum Ebersbach hinunter, hören sein Rauschen und riechen sein Stinken, biegen ab und bleiben unter dem ersten riesigen Bogen des Viadukts stehen. Je länger sie stehen, um so winziger werden sie. Es schwindelt ihnen von der Höhe des Viadukts und kitzelt sie angenehm, so zusammenzuschrumpfen zu beinahe gar nichts. Sie warten auf einen Zug. Dann wird es donnern, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Wenn ihnen das Warten zu lang dauert, beginnen sie, gegen den Viadukt zu rufen. Ha, wie hohl die Geisterstimmen des Viadukts antworten. Sie rufen noch mal und noch mal, die Geisterstimmen antworten wie aus einer großen Halle. Mehrere Male reizen sie den Viadukt. Aber dann rennen sie, von Angst gepackt davon, den Weg hinauf, an Felsen und einem dunklen Teich vorbei. Sie trotten die Landstraße entlang. Da hören sie: Die Sirene heult. Feierabend. Aus dem Fabriktor kommen viele Leute.
Es ist aufregend, immerfort zu gucken, bis sie unter den vielen Menschen plötzlich ihre Mütter sehen. Die kriegen ganz fröhliche Gesichter, und Anna und Paulchen sind stolz auf sich selbst und darauf, dass die Mütter arbeiten gehen, und auf das Sirenen-Heulen, auf die Fabrik und was nicht sonst alles. Die Fabrik heißt Erwerbshilfe. In der Erwerbshilfe arbeiten nur Frauen.
Es ist Herbst. Die Kinder gehen in den Kleiberwald. Auf einmal sehen sie: Ein Wunder ist geschehen. Ringsum hängen durchsichtige Perlen an den Blättern und Zweigen und funkeln. Anna hebt ein braun-rötliches Eichenblatt vom Waldboden auf und hält es in der Hand. Das Blatt schimmert und ist von winzigen Glasperlen überzogen. In der Mitte ist eine ganz große. Vorsichtig trägt sie das Blatt zur Tante. Die nickt und versteht, dass etwas ganz Wunderbares mit dem Wald geschehen ist. Langsam rollt die große Perle vom Blatt hinunter. Anna sieht zur Tante. Die nickt wieder. Also muss das so sein. Die Perlen müssen zu Tränen werden. Wirkliche Wunder dauern nur ganz kurz. Anna prägt sich genau ein, wie der Wald in der großen Verzauberung aussieht. Die Sonne kommt durch die Bäume auf die bunten perlenübersäten Blätter. Die anderen Kinder schlagen gegen die Zweige, sodass die Perlen herunterspringen, und schreien vor Übermut. Auch das merkt sich Anna, die Freude der anderen Kinder.
Am Sonntag scheint immer die Sonne. Deswegen heißt er Sonntag. Anna bekommt ihr weißes Kleidchen an. Es ist so leicht, dass der Wind es aufheben und in der Luft festhalten könnte. Jemand bindet die große rosa Schleife ihres Kinderhäubchens. Jetzt ist sie bestimmt das schönste kleine Mädchen von Gottshut. Das schönste kleine Mädchen von Gottshut läuft in den Kindergarten und hört mit den anderen Kindern dem Bruder mit den lieben Augen zu, der Jesusgeschichten erzählt. Nachher steht der Bruder neben dem Missionsneger. Der bunte Missionsneger nickt und bedankt sich für jeden Groschen einzeln. Dann gibt es noch eine Freude nach dem Kindergottesdienst: bunte Bildchen mit Jesusgeschichten, die man sammeln kann.
Vor der Dunkelheit fürchtet sich Anna. Die Eltern singen ihr Lieder, damit Gott seine weichen Flügel über sie breitet und sie vor Satans Schlingen beschützt.
In den Träumen kommt der Teufel doch:
Anna sitzt auf der hölzernen Brille des Toilettenbeckens. Auf einmal spürt sie, dass von innen Hände nach ihr greifen. Sie weiß, es sind die vom Teufel. Sie springt vom Becken und schaut in das dunkle kreisrunde Loch in der Mitte, das sonst mit einer Klappe verschlossen ist. Unten sitzt der Teufel, feurig rot, und noch tiefer ist das Flammenmeer der Hölle. Der Teufel lacht, klimmt die dicken Tonröhren herauf, und seine haarigen Hände sind nun schon über dem Beckenrand. Anna presst sich an die Wand. Ganz aus dem Loch raus kann der Teufel nicht. Er muss Anna überraschen und dann hinunterziehen. Aber Anna hat es meist schon im Gefühl, wenn er kommt, und springt rechtzeitig weg, ohne dass der Teufel sie anfassen kann.
Oft hat sie noch einen anderen Traum:
Sie geht auf dem schmalen Bürgersteig der Hauptstraße den Weg zum Kindergarten oder Bäcker. Wenn sie kurz vor der gefährlichen Kreuzung ist, taucht oben auf der Höhe des Berges plötzlich ein gewaltiger Laster auf und rast den Berg herunter. Nur wenige Schritte noch, und Anna befände sich in der kleinen Straße vom Kindergarten. Aber der Laster ist schneller als sie. An seiner Schnelligkeit merkt sie, dass es kein gewöhnlicher Laster ist, sondern der, der sie seit vielen Nächten totquetschen will. Erst drängt sich Anna ganz dicht an die Hauswand. Doch der Laster kann, was kein Auto sonst fertigbringt: Er überrollt einfach die Bordsteinkante. Seine runden Augen leuchten unheimlich, und sein Motor blubbert. Tuck, tuck-tuck-tuck. Tuck, tuck-tuck-tuck. Anna weiß, es hat keinen Sinn, Sich in einem Hausflur zu verstecken. Das Automonster käme ihr doch nach und hätte sie wie in einer Mausefalle gefangen und würde sie an die Wand drücken. Sie kann nur eins tun: rennen, rennen, immer neue Auswege suchen. Einmal entkommt sie dem Monster für kurze Zeit in ihren Hof. Die enge Toreinfahrt versperrt ihm den Weg. Anna hört das Blubbern des Motors. Das Monster hat Zeit. Es wartet auf Anna. Sie sieht voraus, dass die Wände der Einfahrt dieses Geräusch und das Strahlen der runden Augen nicht aushalten und nachgeben werden. Schon erweitert sich die Einfahrt. Langsam fährt das Monster auf den Zaun zu, zu dem Anna flüchtet. Anna klettert über den Zaun, verhakt sich, zerreißt ihre Sachen, rennt. Das Monster walzt den Zaun nieder und streift Anna, ehe sie den Bahndamm, ihre Rettung, erreicht hat. Anna erwacht schreiend. Allmählich beruhigt sie sich mit dem Gedanken, dass in Wirklichkeit kein Auto über die Bordsteinkanten fahren kann.
Anna läuft neben ihrem Vater her. Ihre Hand liegt in seiner. Wenn sie so miteinander gehen, ist Anna immer feierlich zumute. Manchmal nimmt der Vater Anna in die große Kirche mit. Zu Weihnachten. Oder zum Liebesmahl, wo Schwestern in weißen Umhängen große Rosinenbrötchen austeilen und man in der Kirche Tee trinkt und Rosinenbrötchen isst und zuhört und singt. Aber jetzt ist kein Liebesmahl. Der junge Bruder Borchert und seine Verlobte möchten Anna kennenlernen, denn sie sollen zusammen eine große Reise machen. Lang ist die Hauptstraße bis zum Davidshof. Auf dem Gras des kleinen Parks liegt etwas Schnee. Die großen Kugelbüsche und die langen, spitzen Bäume und das gelbe Schloss, in dem der Bischof mit seiner Familie wohnt, machen Eindruck auf Anna, aber sie wird auch ängstlich. Sie geht mit dem Vater in einen der Hauseingänge. Das Licht ist schon eingeschaltet.
In der großen Wohnung sind einige Erwachsene. Eine junge Frau sitzt auf dem Sofa und lächelt Anna zu. Das ist die Verlobte, der Mann mit den blonden Haaren ist Bruder Borchert. Zwei blonde schöne Mädchen führen Anna in ihr Zimmer und zeigen ihr ein großes Puppenhaus. Die eine Schwester schaltet das große Licht aus. Mit einem Mal erstrahlt das Puppenhaus im Dunkel. In jedem der kleinen Zimmer brennt eine Lampe. Im Wohnzimmer eine Stehlampe. Die Eltern sitzen und unterhalten sich. Im Kinderzimmer die Deckenlampe. Die beiden Kinder liegen unter kleinen Deckbetten. Kupferne Wärmflaschen wärmen ihre kalten Füße. In der Küche blitzen kleine Töpfe auf dem Herd. Die Schwestern erklären Anna, dass ihr großer Bruder das Licht als Weihnachtsgeschenk in das Puppenhaus gelegt hat. Anna erkundigt sich, ob es auch geht, nur eine Lampe einzuschalten. Das geht nicht. Aber vielleicht baut ihnen der Bruder zum nächsten Weihnachten etwas, damit man in jedem Zimmer das Licht extra ein- und ausknipsen kann. Anna hat auch ein Puppenhaus, mit dem sie gern spielt. Jetzt weiß sie, was sie sich wünscht: Einmal sollen auch in ihrem Puppenhaus die Lampen brennen. Dann kann sie noch lange nach Weihnachten so tun, als wäre das Fest eben vergangen, genau wie die beiden großen Mädchen.
Anna bekommt von der Mutter einen weißen Muff umgehängt. Sie kann die bloßen Hände hineinstecken, und drinnen begegnen sie sich und sagen sich guten Tag. Das dicke Baby steht in seinem Kinderbett und guckt mit seinen blauen Kulleraugen. Es kapiert gar nicht, dass Anna wegfahren soll. Anna kann sich kaum von dem dicken Baby trennen. Nicht einmal der weiße Muff tröstet sie. Die Erwachsenen reden und tun mit Anna. Sie merkt, dass sie sich über ein fröhliches Gesicht freuen würden.
Sie fahren die ganze Nacht über. Anna sitzt neben der Verlobten, der junge Bruder Borchert gegenüber in der Ecke. Dass sie Anna an der Grenze als ihr Kind angeben werden, weiß Anna nicht. Sie weiß auch nicht, dass sie eine noch viel längere Fahrt als Anna vorhaben, eine Reise nach Übersee zu einer Missionsstation. Eine Deckenlampe verbreitet ein düster-gelbliches Licht. Anna schläft manchmal. Wenn sie aufwacht, ist immer noch alles genauso. Vielleicht reisen sie schon mehrere Nächte. Manchmal spricht die Verlobte mit Anna, manchmal auch Bruder Borchert. An der Zonengrenze wird Anna geweckt. Die Leute reden laut miteinander. Sie freuen sich und sagen, nun seien sie im Westen. Jemand gibt Anna Schokolade. Sie steckt die Schokolade in ihren weißen Muff und freut sich nun auch, dass sie im Westen sind. Jemand sagt, jetzt kriegst du eine Banane. Alle lachen, weil Anna nicht weiß, was eine Banane ist. Man zeigt ihr eine gebogene gelbe Frucht und schält eine Spitze heraus. Anna soll kosten. Die Banane schmeckt widerlich süß und breiig. Die Leute lachen wieder und sagen: Na, du kriegst noch Geschmack daran. Man stopft ihr noch mehrere Bananen in den Muff. Die Leute denken wirklich, Anna würde sie noch essen. Dann schlafen alle wieder ein. Auch Anna. Sie hört dabei das Geräusch, das die Räder machen, wenn sie an die Schienen stoßen. Tata-tata-tata-tata. Wie Musik ohne Töne. Sie streichelt das Fell vom weißen Muffhasen. Nachher kann man schon Bahnhöfe und Städte vom freien Feld draußen unterscheiden. Vor allem sieht Anna viele Strommasten. Bruder Borchert nimmt Anna mit auf den Gang und sagt ihr die Namen von Bahnhöfen. Es ist nur ein Spiel. Denn wie kann Anna so viele Namen behalten. Anna rechnet es Bruder Borchert hoch an, dass er sich mit ihr beschäftigt. Er ist ein ernsthafter Mann, vor dem Anna großen Respekt hat. Einmal geht die Verlobte mit Anna auf die Toilette. Das Geruckel ist vielleicht komisch. Man fällt beinahe um.
Auf einem Bahnhof steigen sie aus. Bruder Borchert und seine Verlobte bringen Anna in eine Villa zu Verwandten. Sie verabschieden sich von Anna. Nun ist sie ganz allein. Sie fragt einen dicken kleinen Jungen, der ihr Vetter ist, ob er vielleicht die Bananen haben will. Er isst gleich alle auf.
Wieder ist Anna unterwegs, steht auf Bahnhöfen. Sie hat keine Angst. Wenn die Frau, die auf sie aufpasst, auch nicht mehr da wäre, irgendwelche Leute geben ihr schon zu essen und nehmen sie zum Schlafen mit. Dann laufen auch überall Schwestern von der Bahnhofsmission herum. Die Mutter hat gesagt, sie soll zu den Schwestern gehen, die helfen immer. Anna hat sich auf Abenteuer eingerichtet. Sie möchte gar nicht mehr so gern ankommen.
Anna sieht die Villa an einer Bergwiese. Da soll sie nun wohnen. Das ist das Kinderheim.
Nun lebt Anna im Kinderheim.
Anna trägt ein Püppchen vor sich her. Sie umgreift es mit beiden Händen und schaut es immerzu an. Sie selbst weiß später nichts mehr davon, man erzählt es ihr. Das Püppchen hat sie aus Gottshut mitgebracht. Es ist das einzige bekannte Gesicht. Sie muss sich in der fremden Welt zurechtfinden. Deshalb sieht sie es wohl so oft an und hält Zwiesprache mit ihm. So kann sie sich selbst nicht verloren gehen.
In der Nacht schlafen die Kinder, und sie träumen und nässen ein, auch die größeren Mädchen. Anna vergisst, dass die Tante das Laken unter ihr wegzieht, und schläft gleich weiter.
In der Nacht geht die Tante in die Waschküche und wäscht das Bettzeug der Kinder, damit es schnell wieder trocknet, denn viel besitzt sie nicht. Die Laken hat sie von schmalen Stoffballen genommen und zusammengenäht. Die Stoffballen stammen von einem Verwandten aus Amerika.
Frühmorgens streiten sich die älteren Mädchen, wer Anna die Haare kämmen darf, sie sind ganz verliebt in Annas Haare. Deswegen ist Anna auch in ihre Haare verliebt. Sie hält ganz still, wenn die Mädchen sie kämmen. Die Sonne scheint durch die Fenster. Im Schlafraum und überall in der Villa ist es sehr hell. Zu Hause in Gottshut war es im Wohnzimmer und im Schlafzimmer dunkel. Aber hier wandert die Sonne den ganzen Tag durch die Villa. Anna weiß nicht, ob sie das mag.
Zum Frühstück sind alle Mädchen da. Sie streuen Zucker auf das Brot, aber nicht zu dick. Das letzte ist das Butterränftle. Die Butter wird auch nur dünn gestrichen, aber sie hält gut den Zucker.
Auf einmal sind alle Mädchen weg. Niemand sagt Anna, dass sie zur Schule gehen. Manchmal fährt auch noch die Tante nach Rosenstetten hinunter, und der einzige kleine Junge steckt sonst wo. Dann ist niemand mehr in der Villa. Nur Anna.
Anna hat sich ein Spiel ausgedacht für wenn sie allein ist. Es ist ein unheimliches Spiel. Sie reißt Papier in kleine Schnipsel und häuft sie zu einem Berg. Auf ein Schnipsel malt sie den Teufel. Schon beim Malen bekommt sie eine Gänsehaut. Sie mischt den Teufel unter die anderen Schnipsel und wartet eine Weile, bis sie genug Mut hat. Dann breitet sie die Schnipsel wieder auseinander. Sie entdeckt den Teufel und kann sich nicht mehr rühren. Schließlich steht sie auf, das Gesicht immer zum Teufel hin, damit er sie nicht hinterrücks überfallen kann. Sie geht zur Tür und wartet, was sich aus dem Erscheinen des Teufels ergeben wird. Er lauert auf dem Tisch und kann jeden Augenblick aus seinem Schnipsel herausspringen. Eine Weile später rennt Anna schnell zum Tisch zurück und versteckt das Schnipsel unter die anderen. Wenn das Teufelsbild zugedeckt ist, kann nichts mehr passieren.
Anna versucht den Teufel immer wieder. Ihre Angst ist immer gleich stark.
Tante Ines nimmt Anna mit nach Rosenstetten. Streck die Beine weit aus, sagt die Tante, als Anna auf den Gepäckträger des Rades steigt. Sie fahren. Anna streckt die Beine weit aus. Die Beine werden mit der Zeit müde. Plötzlich sind sie in die Speichen verwickelt. Sie stürzen. Anna kann es nicht verstehen. Alles ging so schnell. Die Tante schilt Anna nicht. Die Tante schimpft nie und schlägt nie. Immer ist sie freundlich. Freundlich und gerecht. Und noch viel weiter oben bei der Sonne am Tag und den Sternen in der Nacht ist Gott. Auch er ist freundlich. Freundlich und gerecht. Aber er kennt Anna kaum noch. Oder er hat sie ganz vergessen. Denn sie besucht nicht mehr seinen Kindergottesdienst. Dafür kennt der Teufel Anna sehr gut. Er kraucht unten auf der Erde herum, Tag und Nacht lässt er Anna nicht aus den Augen. Der Teufel und Anna sind sich ganz nahe. Kein Mensch achtet so auf Anna wie der Teufel. Er hat auch ihre Beine in die Speichen gedrückt.
Tante Ines nimmt Anna wieder mit nach Rosenstetten auf den Markt. Dieses Mal weißt du es, sagt sie. Anna steigt auf den Gepäckträger. Es gelingt ihr, bis hinein in die Stadt die Beine steif zu halten und auch auf dem Rückweg. Na, siehst du, sagt Tante Ines, es geht.
Auf einer späteren Fahrt stürzen sie wieder. Anna heult und heult. Der Teufel hat die Beine in die Speichen gedrückt, um sie darin kaputt zu machen. Er ist hinterlistig und nutzt jede Gelegenheit, bei der man nicht auf ihn achtgibt. Einmal wird er sie zwischen den Speichen ganz zerquetschen. Niemand kann Anna helfen. Tante Ines weiß noch nicht einmal etwas von dem Teufel. Anna läuft neben dem Rad her und wundert sich, dass ihre Beine noch nicht vielfach gebrochen sind und rund und schlabbrig wie Gummi.
Erneut fahren Tante Ines und Anna nach Rosenstetten. Lange Zeit geht alles gut. Dann stürzen sie zum dritten und letzten Mal. Anna kennt schon das Sichüberschlagen. Es läuft so schnell ab, dass es der Kopf nicht begreift. Eine Zeit lang sieht Anna nur sich rasch drehende Speichen vor den Augen, und ihr ist ganz schwindlig. Als sie aufsteht, sind ihre Beine heil geblieben.
Annas Beine werden kräftiger. Sie kann dem Teufel widerstehen.
Warst du schon einmal bei einem Bauern? fragt Tante Ines.
Nein.
Du kannst eine Kuh sehen und woher die Milch kommt.
Süßlich und warm dampft es aus der Stallöffnung.
Anna nimmt es den Atem. Allmählich erkennt sie ein Tier in der Dunkelheit. Eine Kuh steht in ihrem eigenen Schmutz. Sogar im Fell hängen Dreckklunkern. Von einem winzigen Fenster kommt etwas Licht in den Stall. Ein dünnes, scharfes Singen beginnt. Anna wagt sich näher zur Bäuerin, die ihren Schemel unter die Kuh gerückt hat. Aus ihren Fäusten kommt ein harter Strahl und trifft auf den Blecheimer. Das macht das Singen. Wie mühevoll so eine große Kuh ihre Milch hergibt. Die Bäuerin stellt den Eimer vor die Tür und schöpft Milch in die Kanne der Tante. Sie ist dick und gelblich, anders als die bläuliche Magermilch daheim. Frische, gute Kuhmilch, noch nicht einmal entrahmt, sagt die Tante.
Als beim Abendbrot ein Becher Milch vor Anna steht, will sie ihn wie jeden Abend austrinken. Da steigt ihr aus der Milch der süßliche Kuhstallgeruch in die Nase. Sie beginnt zu würgen und setzt den Becher ab. Sie probiert es noch einmal. Das gleiche. Es würgt sie. Kaum hat sie den Geruch in der Nase, sieht sie das nasse, von brauner Soße triefende Stroh und die wie von getrocknetem Schlamm überzogene Kuh. Ich kann nicht trinken, sagt Anna.
Tante Ines versteht Anna nicht. Aber sie merkt, dass Anna wirklich nicht trinken kann, und lässt sie.
Wenn alle aus dem Haus sind, bleibt manchmal ein kleiner Junge zurück. Fritzchen. Und wenn die Mädchen am Nachmittag ihre Ruhe für die Schulaufgaben brauchen, dann ist Fritzchen mit Anna draußen auf der Wiese. Sie reihen kleine, durchsichtige Geleedosen auf einer Bank auf. Das ist ihr gemeinsamer Besitz. Die Tante hat neue Geleeproben aus der Stadt für sie mitgebracht. Erst einmal essen sie noch nicht. Sie sehen sich an, wie die Sonne durch das Gelee scheint. Kennst du vögeln? fragt Fritzchen.
Zuerst hat sich Anna Vogelzwitschern vorgestellt.
Aber nun weiß sie, es ist etwas, was Mann und Frau miteinander machen mit dem, was man sonst versteckt. Und vielleicht machen es auch schon Jungen und Mädchen. Eine dunkle Sache. Fritzchen ist ein schmutziger, gemeiner kleiner Junge und quält Anna gern. Gerade, wenn sie gut miteinander spielen und sie das Wort vergessen hat, sagt er es wieder. Kennst du vögeln? Ich möchte vögeln, vögeln ist schön. Seine Augen werden klein vor Freude, Anna mit dem schmutzigen Wort zu erschrecken.
Sonntags, ganz in der Frühe, sammeln Tante Ines, ihr Verlobter und die Mädchen Ackersalat. Kleine, glänzende Blätter, die zwischen anderen Pflanzen auf dem hoch gelegenen Feld wachsen. Niemand hat sie gesät. Niemand braucht sie zu ernten. Sie wachsen wild auf den Feldern. Sie kommen von selbst und gehen von selbst und schmecken deshalb so wild, nach Bucheckern oder aus Mohn gepresstem Öl. Wenn die Kirchenglocken läuten, gehen alle vom Kinderheim nach Hause. In ihren Alltagskleidern. Solche sind sie. Kleine und große Gottlose, die den Sonntag nicht achten, die in Alltagssachen vom Feld kommen, wenn die anderen zum Gottesdienst gehen. Es ist etwas Schlimmes und Wildes daran, den Kirchenglocken zu trotzen.
Am Sonntagnachmittag beginnt ihr Heidensonntag.
Sie ziehen sich um. Manche Mädchen sind zu ihren Eltern gefahren. Fritzchens Mutter kommt zu Besuch. Sie hat lange, schwarze Locken, eine braune Haut und sehr vornehme, weite Sachen.
Anna verkriecht sich.
Die schöne Frau ruft Anna und erkundigt sich, ob Fritzchen brav gewesen ist. Fritzchen ist so fein angezogen und schaut mit seinen braunen großen Augen so unschuldig, dass Anna nicht mehr glauben kann, was er in der Woche tut. Sie gibt der schönen Frau die Antwort, die sie und Fritzchen haben wollen, und ist froh, dass sie wieder verschwinden kann in ihrer Ecke.
Die schöne Frau schenkt Fritzchen einen Mäckie. Er hat ein kurzes, nach vorn gebürstetes Fell auf dem Kopf, das igelgrau ist, und guckt mit einem lustigen braunen Gesicht und roten Backen zu Anna. Das Gesicht kann man drücken. Er lacht oder ist traurig. Nur die Augen lachen immer. Auf der Brust hat er auch Fell. Einmal auf den schwarzen Punkt von Mäckies Nase stupsen. das ist das Höchste, was Fritzchen Anna erlaubt.
Anna hat ein winziges Zelluloidpüppchen, kleiner als ihr Finger, nackt und rosa. Man muss ganz genau hinsehen, um Arme, Beine und Händchen zu erkennen. Manchmal lutscht sie an dem Zelluloid, weil es gut schmeckt. Aber sie muss aufpassen, dass sie das rosa Püppchen nicht verschluckt. Was sie sich noch sehr wünscht: ein Negerpüppchen dazu, wie Fritzchen eins hat.
An einem anderen Sonntagnachmittag besucht die schöne Frau Fritzchen wieder. Aber der Igel hat ja keine roten Backen mehr, sagt sie.
Anna hat sie abgeküßt, sagt Fritzchen.
Die schöne Frau ruft Anna aus ihrer Ecke. Ist das wahr? fragt sie.
Nein.
Aber Fritzchen sagt, du hast es getan.
Ich habe das Rot nicht abgeküsst. Anna hat nun zweimal wahrheitsgemäß geantwortet und denkt, es ist gut.
Sie hat es doch abgeküsst. Fritzchen hat große, blanke Augen. Dass er schwindelt, sieht man nicht.
Also, du lügst, sagt die Frau zu Anna.
Anna schämt sich, als hätte sie wirklich gelogen, und versteht überhaupt nichts mehr. Sie, die die Wahrheit gesagt hat, steht da wie eine Lügnerin, und dem frechen Lügner wird geglaubt. In Rosenstetten ist alles ganz anders als in Gottshut, eine auf den Kopf gestellte Welt, in der hauptsächlich der Teufel regiert, wenn er nicht gerade zu faul und zu müde ist.
Deine Haare sind zu lang, sagt Tante Ines. Anna steigt auf den Gepäckträger auf. Als sie von Rosenstetten zurückkommen, ist Anna ein hässliches Mädchen mit abgehackten Haaren. Jetzt werden die Mädchen sich früh nicht mehr darum streiten, wer ihr die Haare kämmen darf.
Oft kommen Verwandte. Tante-Ines-Anna-Verwandte. Eine sanfte, dünne Frau zum Beispiel. An einem Morgen öffnet Anna die Badezimmertür. Ein nacktgerupfter Vogel mit baumelnden Hülsen an der Brust stößt einen grässlichen Schrei aus und fährt zu Boden. Anna macht erschrocken die Tür zu. Sie hat die dreizehnte Märchentür geöffnet und etwas Schreckliches gehört und gesehen.
Diese Tante hat einen großen Jungen mitgebracht. Einen Vetter. Anna freundet sich mit dem Vetter an. Er verspricht Anna, sie zu heiraten, wenn sie groß ist. Anna ist froh. Wenn sie immer im Westen bleiben müsste, hätte sie einen lieben, guten Jungen als Mann. Falls er sie nicht heiratet, hat er auch noch vier Brüder.
Die Schwester von Tante Ines kommt. Den kleinen dicken Vetter hat sie leider nicht mitgebracht, aber ihren Mann, der schon ziemlich alt ist und ein schweres Motorrad fährt. Der Onkel fragt Anna: Na, willst du mal ein Stück mitfahren? Er fragt so, als ob er schon gewusst hätte, dass Anna wegen des Motorrads ganz verrückt ist. Anna klettert auf den Sitz und kann ihre Füße auf feste Pedale stützen, anders als beim Fahrrad. Immer schneller fahren sie. Die Ähren vom Kornfeld verwischen vor ihren Augen. Anna hat die Beine gespreizt. Sie reitet auf einem Pferd, das schnell ist wie der Wind. Die Geschwindigkeit macht ihr eine kleine Herzangst. Aber die ist grad besonders schön.
Nur noch eins ist besser als das schwere Motorrad: der Lanz Bulldog. Hochrädrig und rot steht er vor einem Bauerngehöft. An seiner tiefen Stimme kann man seine riesige Kraft erkennen. Redet er langsam und gleichmäßig, kann man ruhig dabeistehen und ihm zuhören. Wird er aber aufgeregt und strengt seine Stimme an, muss man schnell beiseite gehen. Eine gewaltige Maschine wie der Lanz Bulldog sieht nicht so genau, ob es ein Huhn ist, das vor ihm herflattert. Oder das Kleid von einem Kind.
Französische Verwandte kommen. Frankreich ist nicht weit weg. Die Verwandten reden schnell und in einer wunderschönen Sprache und sagen auch dies und das zu Anna. Als sie wieder weg sind, muss Tante Ines dauernd die Unterschriften eines Buches in dieser Sprache vorlesen, das die Verwandten Anna geschenkt haben. Es heißt: Barbar, l'elephant, Barbar, der Elefant. Er ist von seiner Familie in die Stadt ausgerissen. Am besten gefällt Anna. wie der große Barbar mit seinem Anzug aus dem Kaufhaus mit der bleistiftdünnen französischen Wuschelkopfdame im rot ausgemalten Auto die Kurven hinuntersaust. Schließlich kriegt Barbar Heimweh nach seinen Brüdern und Schwestern und Eltern. Was die kleine Dame auch tut, nichts hilft. Da endlich findet die Elefantenfamilie ihren Barbar wieder. Sie hat inzwischen überall nach ihm gesucht. So ist eine Elefantenfamilie: Sie gibt keine Ruhe, bis nicht alle wieder zusammen sind. Im Urwald kennt man das nicht anders. Auf dem letzten Bild steht die dünne Wuschelkopfdame auf ihrem Gitterbalkon kerzengerade wie immer und sieht auf der sauberen französischen Allee die Elefantenfamilie mit ihrem Barbar davontraben in den Urwald. Sie bezwingt ihre Traurigkeit und winkt mit dem Taschentuch. Anna bekommt eine genaue Vorstellung von Tapferkeit: Wenn das Glück der anderen das eigene Unglück ist, aber man nicht losheult und den anderen die Freude verdirbt, sondern winkt und seine Traurigkeit aufhebt, bis man ganz für sich allein ist.
Jemand bringt Anna für vier Wochen Sommerferien nach Rechtesheim zu Onkel Armin. Onkel Armin ist der Bruder von Annas Mutter. Dass Onkel Armin als Junge lange Zeit bei seinen Cousinen in der Villa von Rosenstetten lebte und von ihnen so halb als Bruder betrachtet wird, sagt Anna niemand. Überhaupt sagt ihr niemand, dass die Tante Ines auch schon als Kind mit ihrer Schwester und einer Halbschwester in der Villa war. Da könnte sich Anna ein bisschen mehr ausdenken, als die Wörter Villa und Kinderheim hergeben. Dann käme ihr die Villa nicht' so leer vor, und sie könnte vielleicht in Rosenstetten heimisch werden.
Rechtesheim ist ein sehr heißes, sehr staubiges Dorf. Am Tag sind Anna und ihre kleine Base Ille in einem Kindergarten. Oder ist es eine Schule? Mittags werden die Fensterläden zugeklappt. Anna und Ille sitzen nebeneinander auf einer Schulbank und sollen den Kopf auf das Kissen tun, das auf einem Tisch liegt, und eine Stunde Mittagsschlaf halten. Wie soll Anna im Sitzen einschlafen? Sie muss schon im Liegen hin und her schaukeln, damit sie einschlafen kann. Ein paar Mal flüstert sie mit ihrem Bäsle und erkundigt sich, wie lange die Stunde noch dauert. Da kommt eine, von der Anna das Gesicht nicht weiß, und zieht erst Ille, dann Anna eins mit der Rute über den Nacken. Anna versteht, hier wird man geschlagen. Also muss man still sein. Sie ist jeden Mittag still, aber schlafen kann sie nicht.
Wenn endlich auch der Nachmittag vorbei ist, kommen alle vom Feld. Opa-Nägele-Oma-Nägele-Tante-Traudl-Onkel-Siggi-Onkel-Armin. Man trinkt Limonade. Anna mag das süße Zeug nicht. Es steht den ganzen Tag herum, von niemandem gekocht, aus der Fabrik. Sie hätte lieber Tee oder was anderes, was eine Frau kocht. Aber alle trinken Limonade. Manchmal meint Anna, in Wahrheit hätte das Haus keine Türen und Fenster, sondern nur in die Wände eingelassene Löcher, durch die in der Nacht der Wind zieht. Jeder kommt und geht, wie er will, und trinkt Limonade aus der Fabrik und schneidet sich Brot ab.
Onkel Siggi hat ein Luftgewehr. Damit knallt er in der Luft herum. Einmal fällt ein Spatz herunter. Anna läuft zu dem heruntergefallenen Vogel. Er bewegt sich nicht mehr. Sie sieht zu Onkel Siggi. Er lacht. Onkel Siggi ist ein netter junger Onkel und hat Kinder gern. Aber jetzt gruselt es Anna vor ihm. Spatzen muss man totschießen, sagt Onkel Siggi, sie fressen die ganzen Kirschen von den Bäumen. Wenn Onkel Siggi sich wenigstens nicht noch am Spatzen-Totschießen freuen würde.
Oma Nägele ist ein hutzliges Omachen und fromm. Man lacht Oma Nägele aus wegen ihrer Frömmigkeit. Niemand will was von der Kirche wissen, Onkel Armin sowieso nicht, aber auch nicht Tante Traudl und Onkel Siggi.
Dann wird Anna wieder aus Rechtesheim abgeholt.
Tante Ines und Onkel Leo machen mit Anna einen Ausflug in den Schwarzwald. Anna versteht, dass er nicht anders als Schwarzwald heißen kann. Jede Tanne steht für sich, schlank und hoch, höher als ein Kirchturm, und die Wipfel sind blau, fast schwarz. Fährt ein Wind in die Tannen, beginnt der Wald mächtig zu rauschen. Er bläst alles hinaus, sodass im Schwarzwald nur reine Luft ist und nichts Böses sich drinnen festhalten kann. In den Tannen kann man Gott reden hören. Er redet anders als in der Kirche und mit allen Menschen.
Auf einer Bergwiese weiden Kühe. Schwere Glocken hängen an ihren Hälsen. Bewegen sich die Kühe, schlagen die Klöppel gegen das Metall. Jede Kuh hat eine andere Glockenstimme. Sie können niemals verloren gehen.
Die Schwarzwaldhäuser sind ordentlich groß, mit tief nach unten gezogenen Dächern und hölzernen, mit Blumenkästen geschmückten Balustraden. In eines gehen sie hinein, um etwas zu essen. Viel Platz ist darin und alles sehr sauber. Natürlich hängt da auch eine Kuckucksuhr. Zu jeder halben Stunde springt der Kuckuck aus seinem kleinen Schwarzwaldhäuschen und kuckuckt. Bei diesen Uhren ist es wie bei den richtigen Schwarzwaldhäusern: von draußen sehen sie sehr prächtig aus. Aber drinnen ist es beinahe noch schöner.
An einem Holzhäuschen kaufen die Verlobten Anna ein buntes Käpple und zwei erste Anhänger. Einer ist so ein Schwarzwaldhaus, wie Anna sie nun kennt, mit einem Glöckchen. Anna setzt sich das Käpple auf. Pass auf, kriegscht so viele Anhänger, dass das Käpple voll wird, sagt Tante Ines. Anna will fleißig sammeln, damit nachher kein Platz oben mehr frei ist, wenn sie wieder nach Hause kommt. Da werden alle staunen, wenn es bimmelt und klirrt.
Was Anna inzwischen außer der Kappe, den leeren Geleegläsern und ihrem rosa Püppchen besitzt: eine längliche Stofftasche, auf der mit blauem Stoff und Garn ein Bild aufgesetzt ist: ein chinesisches Häuschen und Bäume. Eine grüne, kleine Duftflasche, mit einem Goldkrönchen als Verschluss, halb voll Wasser. Sie duftet immer noch nach Uralt-Lavendel, das Tante Ines benutzt. Einen Stapel großer, blasser Sanella-Bilder, die Tante Ines vom Margarineeinkauf mitgebracht hat. Auf der Rückseite steht viel in kleiner Schrift, die alles erklärt. Aber Anna sieht auch ohne Erklärung: Afrika. Ein von der Sonne ausgetrocknetes Land. Selbst die Löwen haben nur eine bleiche Farbe von dem vielen Sand, der herumfliegt. Lieber als die Sanella-Bilder mag sie die kleinen glänzenden von Knorr. Die sieht sie sich stundenlang an. Solche Farben kann es nur im grünen Urwald geben. Beinahe giftig leuchten die Bilder. Selbstverständlich hat sie auch Salamander-lebe-hoch-Bilder. Den lustigen, gelb-schwarz gesprenkelten Burschen mit seinen großen Stiefeln und der frechen Mütze, der durch die ganze Welt wandert, hat jeder gern. Und ein jeder ruft es noch, Salamander, lebe hoch, sagt Anna, schaut sie sich diese Bilder an.
Annaha. Annaha, hört Anna eine quäkende Stimme in der Ferne. Anna weiß Bescheid, stürzt aus der Villa, läuft über die Wiese bis zum Zaun. Dort steht die Nachbarin, eine dicke, freundliche Frau, die Anna schon die ganzen Wochen über ruft, seitdem es Äpfel in ihrem Garten gibt.
Niemals in ihrem Leben hat Anna ihren Namen so rufen hören, dass es zum Lachen ist. Aber es gefällt ihr sehr, dass nach ihr gerufen wird. Nach ihr und nach niemand anderem sonst. Wenn eines der großen Mädchen angelaufen käme, würde die Frau nicht zufrieden sein. Es muss unbedingt Annaha 'sein, die kommt.
Nun steht Anna am Zaun. No, Mädle, sagt die Frau. Eine Weile stehen sie so. Dann sagt die dicke Frau: Willscht e Epfele. Ja gern, antwortet Anna. Sie bekommt einen großen Apfel, den die Frau vorher noch gründlich blank geputzt hat. Danke, sagt Anna und darf wieder losrennen.
Die dicke Frau meint es gut mit Anna. Deswegen ärgert sich Anna nicht besonders darüber, dass die großen Mädchen sie wegen des Annaha-Gerufes aufziehen. Vielleicht wird die dicke Frau Anna behalten, wenn man Annas schöne Mutter überhaupt nicht mehr über die Grenze ließe, Anna zurückzuholen. Denn immer kann Anna nicht im Heim bleiben, wo niemand der Tante Geld für Anna gibt. Das weiß sie ganz genau, wenn es ihr auch keiner sagt. Die Frau hat keine Kinder und mag Anna, und als Bäuerin braucht sie sich um ihr Essen nicht zu sorgen.
Tante Ines ist immer gut und freundlich zu ihr. Sie nimmt sie sogar nach Freudenstadt mit zum Einkaufen. Wie der Schwarzwald Schwarzwald heißen muss, muss Freudenstadt, Freudenstadt heißen, weil sich die helle Freude hier niedergelassen hat und man nur noch fröhlich sein kann, wenn man die vielen schönen Häuser sieht. Anna war schon in größeren Städten. Karlsruhe bei Rechtesheim. Und Stuttgart, was im Kessel liegt und im Sommer so heiß brodelt, als ob Feuer unter dem Kessel wäre. Aber keine kann sich mit Freudenstadt messen, meint Anna. Sonst hätte sie ja wohl auch nicht den Namen bekommen. Doch Anna lässt sich von dem Namen täuschen und der Freude, die sie bei der Begleitung der Tante empfindet. Freudenstadt wurde ausgebombt, erfährt sie bei dem einzigen Besuch dieser Tante viele Jahre danach. Vielleicht waren wir in einem Außenbezirk, wird die Tante sagen.
Anna geht mit Tante Ines und Onkel Leo zum Jahrmarkt in Rosenstetten. Sie schauen bei den Luftschaukeln zu. Die Leute in den Kähnen holen mit den Knien Schwung. Die Kähne kommen langsam in Fahrt. Immer schneller schwingen sie, immer höher hinauf. Schon liegen die Leute flach in der Luft und müssten eigentlich herausfallen. Aber damit haben sie noch nicht genug. Sie schaukeln immer noch weiter, bis sie ganz oben in der Luft stehen und ihre Köpfe auf die Erde zeigen, als machten sie einen Kopfstand. Gerade noch nimmt die Schaukel sie auf dem Rückschwung mit, sonst müssten die Leute kopfüber abstürzen.
Onkel Leo mietet eine Luftschaukel. Anna will nicht mit hinein. Onkel Leo redet ihr gut zu. So hoch wollen sie nicht schaukeln. Erst schaukeln sie auch nur wenig. Doch dann geht es immer höher hinauf. Anna hält sich an der Stange mit aller Kraft fest. Unter ihr rasen die Erde und die Menschen. Anna kann nicht mehr atmen. Ihre Hände haben keine Kraft mehr. Gleich werden sie auf dem Kopf stehen, und sie wird die Stange loslassen und hinunterstürzen ... -Vielleicht schreit sie. Bevor sie richtig loslässt, greift Onkel Leo nach ihren Händen und presst sie gegen die Eisenstange. Der Kahn verlangsamt seine Fahrt. Die Hand von Onkel Leo hält sie immer noch fest. Man hebt sie aus dem Kahn, weil sie nicht mehr vernünftig laufen kann. Sie ist Onkel Leo nicht böse, weil er sein Versprechen gebrochen hat. Höchstens Tante Ines. Onkel Leo muss immer locken und verführen und macht dann, was er will. Deswegen liebt sie ihn trotzdem. Eine große, schwarze Wolkenwand hat sich vor die Sonne geschoben. Die Ränder glänzen golden. Der Platz und die Menschen sind in einem violetten Gewitterlicht. Still ist es geworden, als ahnten die Menschen, dass Anna beinahe gestorben wäre. Solche Angst hat Anna noch nie gehabt. Nur in ihren Träumen.
Sowie die Dämmerung kommt, wird Anna ganz still. Die Dunkelheit legt sich als etwas sehr Schweres auf ihre Brust.
Bevor Anna einschläft, sagt sie: Ich bin klein, und sie wird sehr klein. Mein Herz mach rein, sagt sie, und ihr Herz wird sauber und hell wie eine Gottshuter Sonntagsstube. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein, sagt sie. Und nun kann der Herr Jesus kommen und in ihre Herzenskammer einziehen. Dann denkt sie an das dicke, glatzköpfige Baby und an ihre Mutter, ein bisschen auch an Mechthild, die Großmutter, den Vater und wer da sonst noch am Abend in der Wohnstube sitzt oder herumläuft. Vielleicht heult sie ein wenig und schlägt mit dem Kopf hin und her. Darüber schläft sie ein.
Einen Traum träumt sie in Rosenstetten immer wieder:
Anna hat ein hohes Gebirge hinter sich gelassen, in dem kein Baum wächst, und kommt nun in eine Ebene. Da beginnt ganz leise das Stampfen. M-ta-ta. M-ta-ta. Noch ist es sehr weit weg. Schon beim ersten Hören ist Anna außer sich. Sie beginnt zu rennen. Das Geräusch wird lauter, je länger sie rennt, und immer drohender: M-ta-ta. M-ta-ta. Schon ist ES dicht hinter ihr. Sie muss laufen, laufen. Keinesfalls darf sie sich umsehen. Ihren Kopf zieht es nach hinten. Mit Mühe richtet sie ihn geradeaus. Nie darf sie erfahren, was hinter ihr ist. Das wäre das Schlimmste, wenn sie IHM ins Angesicht schaute. ES stände plötzlich still, das Stampfen setzte aus. Anna sähe ES einen Augenblick, vielleicht noch nicht mal so lang. Dann fiele das Gebirge auf sie herunter und würde Anna unter sich begraben. Sie rennt weiter. ES bleibt dicht hinter ihr. Sie wird ES nie zu sehen bekommen. ES wird sie nie überholen. ES wird sie nur jagen, immer dicht hinter ihr bleiben, und immer besteht die entsetzliche Gefahr, dass sie sich doch einmal umschaute oder dass ES sie doch einmal überholte und sie zwänge, ES anzuschauen. ES treibt Anna vor sich her. M-ta-ta. M-ta-ta. Ein Maschinentier mit vielen Füßen. Gleichmäßig stampft es auf. Anna ahnt, ES ist unsichtbar trotz seiner gewaltigen körperlichen Kraft. Aber es wäre ebenso schrecklich, wenn Anna sein Angesicht erblickte, als wenn sie sich von seiner Unsichtbarkeit überzeugte. Sie kann nur ahnen. Manchmal ist ES so dicht hinter ihr, dass ES sie berühren müsste. Nur seine Gestaltlosigkeit erklärt, dass sie manchmal seinen Atem, nie aber seinen Körper spürt. Spürte sie einmal seinen Körper, wäre sie verloren. Nichts darf sie von dem ES wissen, das sie jagt, außer diesem gleichmäßigen Aufstampfen, das immer schneller und lauter wird und Anna in den Ohren dröhnt. Einmal bricht Anna zusammen. Sie wirft den Kopf auf die Erde, gräbt sich mit den Armen in den Boden, um ES nicht zu sehen. Jetzt wird ES über sie kommen und sie zerstampfen. Anna versucht zu schreien. Aber sie bekommt keinen Ton heraus. Sie wacht auf. Es ist dunkel um sie. Nacht.
Manchmal versucht sie schon zu schreien, wenn ES nur aus der Ferne zu hören ist, und wacht rechtzeitig auf.
Die Tage sind nun schon viel früher zu Ende, als man ins Bett gehen kann. Anna hockt auf einem Bänkchen im geheizten großen Zimmer bei den Mädchen, die sich mit Handarbeiten beschäftigen oder mit irgendetwas anderem. Anna tut nichts. Sie denkt noch nicht einmal etwas. Sie hockt nur so einfach da. Dann will sie aufstehen. Da hält ihr jemand ein Bein fest. Sie versucht, das Bein wegzuziehen und glaubt an einen Scherz, den sich ihr Bein erlaubt. Doch sie kriegt es nicht von den Dielen, und es sticht mit tausend Nadelspitzen. Mit einem Mal weiß sie: Die Hexe ist gekommen, um Anna zu holen. Sie sitzt unter dem Holzfußboden und zieht an Annas Bein. Anna hält sich an einem Stuhl fest und schreit: die Hexe, die Hexe. Gleich werden die Dielenbretter aufbrechen, und Anna wird mitsamt dem Stuhl von der Hexe hinabgezogen. Die Mädchen gehen auf Anna zu und bilden einen Kreis um sie. Anna greift nach dem Arm von Tante Ines und umklammert ihn. Doch wird das nichts nützen. Wenn die Hexe mitten in das Zimmer zu den Mädchen und der Tante gekommen ist, dann hat sie viel mehr Macht, als Anna wusste. Anna hört nicht auf zu schreien. Sie lässt den Arm von Tante Ines los und springt mit dem gesunden Bein, unter dem die Dielen nicht nachgeben, durch das Zimmer. Die Stiche im kranken Bein lassen nicht nach. Die Hexe hängt unter den Dielen an diesem Bein fest, und Anna schleppt sie durch das ganze Zimmer mit. Anna tobt und schleift die Hexe, bis die Hexe unten gegen einen Balken vom Fußboden schlägt und Annas Bein loslässt. Sofort hören die Nadelstiche auf. Anna kann das Bein anheben. Sie springt auf einen Stuhl, der Vorsicht halber.
Es ist eine schlimme Erfahrung für sie, dass nicht nur der Teufel, sondern auch die Hexe so frech ist, Anna schon vor dem Einschlafen inmitten aller Mädchen zu überfallen. Wie soll sie da noch sicher sein.
Tante Ines hat sich ein Weihnachtsgeschenk für Annas Mutter überlegt. Anna wird einen Kalender malen. Die Tante erlaubt ihr, sich in ihre Stube zu setzen, an ihren Sekretär. Da liegen schon kleine gelbe Blätter aus festem Papier bereit. Noch nie hat Anna an diesem Sekretär gesessen. Eine Zeit lang ist sie ganz benommen von dem Gesumm, das aus dem Sekretär kommt. Alle Gedanken, die die Tante beim Briefeschreiben hatte, sind in den kleinen Fächern mit den hellen Knöpfen aufbewahrt. Das Gesumm regt Anna auf. Sie könnte nicht aufgeregter sein, wenn sie wüsste, dass auch die Gedanken der Großtante mitsummen. Genau an diesem Sekretär saß die Schwester ihres Großvaters Kröger und schrieb aus ihrer Einsamkeit des Schwarzwaldes seitenlange Briefe an ihre Schwägerin, Annas Großmutter. Und nun sitzt Anna an diesem Sekretär und spürt deutlich, dass es eine Besonderheit mit ihm hat. Darüber vergisst sie beinahe ihren Auftrag. Tante Ines setzt sich neben Anna und erklärt ihr, was sie sich ausgedacht hat. Anna soll zwölf Kärtchen malen, für jeden Monat eins. Und immer, was sie sich zu dem Monat vorstellt. Dann sieht die Mutter einen ganzen Monat auf das kleine Bild von Anna, bis der nächste Monat kommt und sie das Blättchen umwendet. Der Januar ist ein kalter Monat. Was wird Anna malen? Einen Schneemann mit Rute. Wenn ein Kärtchen fertig ist, nimmt Tante Ines Annas Hand und schreibt ihr den Monat darunter und erzählt, was im nächsten Monat los ist. Anna zeichnet lauter Vogelmenschen. Sie haben lange Möhrennasen, vielleicht einen Strich als Mund oder überhaupt keinen Mund.
Seitdem Anna an Tante Ines' Sekretär sitzen durfte, ist sie ganz von der Tante eingenommen. Die Tante setzt das Datum, als endlich das Eis zwischen Anna und ihr bricht, etwa zur gleichen Zeit an. Doch bei ihrer Erzählung spielt eine Schokolade eine Rolle, die sie Anna bei einem Einkauf schenkte. Von da an ging es gut mit dir, wird sie sagen. Wahrscheinlich haben dir deine Eltern versprochen, dass du zu einer Tante in den Westen kommst und die dir Schokolade schenkt. Und dann war ich nicht so eine Tante und hab in deinen Augen auch das Versprechen mit der Schokolade nicht gehalten. Ritter Sport Schokolade wird Anna sofort denken und sich erinnern, wie sie eingepackt war, wie sie schmeckte und dass vier Kinderhände, die von Anna und Fritzchen, sich vergeblich mühten, sie kaputt zu kriegen.
Sonst ruft Tante Ines Anna nur in ihre Stube, wenn sie einen Brief an die Mutter unterschreiben soll. Die Tante führt Annas Hand. Was im Brief steht, weiß Anna 'nicht. Von den Briefen der Mutter behält sie, dass sie Geduld haben soll.
Einmal soll Anna ihren rechten nackten Fuß auf ein Blatt Papier stellen. Die Tante malt um ihren Fuß herum und schneidet das Papier aus. So weiß die Mutter, welche Schuhgröße Anna braucht. Es tut Anna sehr leid, dass die Mutter ihr neue Schuhe kaufen muss. Annas Familie ist doch arm. Und Anna mag nicht, wenn für sie Pakete aus dem armen Osten in den reichen Westen kommen, wo es Ritter Sport Schokolade, Mandarinen und alles mögliche gibt. Aber sie ist nun mal ein Halb-und-halb-Kind. Schuhe, Kleider und Eltern hat sie im Osten, Essen, Wohnen und Schlafen im Westen.
Vor dem Weihnachtsfest wird Anna zur Schwester von Tante Ines nach Stuttgart gebracht. Heiligabend schlachtet der Onkel eine Kokosnuss. Etwas Weißes, Hartes ist darin, es soll das Fleisch sein. Anna kaut auf dem angeblichen Fleisch herum. Vielleicht sollte es ein Kokosnussfest werden. Aber die Kokosnuss ist ausgetrocknet und hat keine Milch mehr. Nun sind alle enttäuscht und haben Langeweile. Anna sieht auf den schönen Weihnachtsbaum und wartet auf ihre Freude. Sie weiß noch, in Gottshut haben sich alle am Heiligabend sehr gefreut. Warum bloß? Wegen der Geschenke? Anna hat schon viel vergessen, seitdem sie von Gottshut weg ist.
In Rosenstetten ist der Winter gekommen. Tiefe Gänge müssen geschaufelt werden, damit die Leute zueinanderkommen. Nun ist alles ganz still geworden draußen. Der Schnee liegt wie Watte auf den Ohren. Er ist auch leicht wie Watte. Und doch ist es mühevoll, die Gänge zu graben. Wenn Anna durch die schmalen Gänge geht und die Schneemauern weit über sie hinwegreichen, wünscht sie sich nichts mehr. Sie hat auch keine Angst mehr. Sie läuft nur und läuft und wird irgendwann einen einzigen Menschen treffen. Den wird sie grüßen, und der wird sie grüßen. Manchmal denkt sie beim Laufen durch die Schneemauern an das dicke Baby in Gottshut. Niemand kann so viele Gänge schaufeln bis dahin. Anna macht es glücklich, dass nun alle Menschen vom Schnee eingeschlossen sind in ihren Häusern und Dörfern und nur noch zum nächsten Nachbarn gehen.
Anna lernt fliegen. Es gelingt ihr schlecht. Sie hebt sich vom Boden ab. Schon fällt sie wieder herunter. Wenn sie in die Ebene kommt, jagt sie das Unsichtbare immer noch und treibt sie vor sich her. Deshalb will Anna über die Dächer und Gehöfte in der Ebene fliegen, weil das Unsichtbare mit seinen schweren Füßen auf der Erde trampeln muss und nicht hinauf kann. Aber es ist, als ob die Erde Hände bekäme und mit ihnen nach Anna griffe. Oder der Boden unter Annas Füßen wird zäh wie warmer Teer und klebt an ihren Fußsohlen fest, sodass sie gar nicht erst in die Luft kommt. Doch sie muss fliegen, sonst ist sie verloren. Denn ihre Beine sind vom Teer so schwer, dass sie nicht mehr laufen können. Anna rudert mit den Armen. Auch in der Luft hindern Anna die Beine, weil sie schwer herunterhängen.
Manchmal ist sie schon mit Leichtigkeit über das Gebirge geflogen und brauchte die Arme kaum zu bewegen. Sie segelte einfach so dahin. Die Luft trug sie. Doch mit einem Mal hörte sie das Unsichtbare, die Ebene öffnete sich vor ihr, und sie begann zu sinken, ihre Angst zog sie herunter auf die Erde.
So lustig hat Anna die Mädchen noch nie gesehen. Sie haben sich bemalt, toben durch das Haus und ziehen Anna mit. Eigentlich weiß Anna nicht, warum das geschieht und was das für ein Fest ist, das Fasenacht heißt. Auch zu essen gibt es reichlich. Es steht alles auf einem Tisch. Man kann sich nehmen, soviel man will. Ein schwarzes, süßes Brot heißt Pumpernickel. Davon isst Anna am meisten.
In der Nacht wacht Anna plötzlich auf, weil der Teufel ihr das Essen aus dem Magen herauszieht. Er will Anna inwendig aushöhlen. Erst holt er nur das Essen heraus, dann den Magen, dann kommt alles andere aus Annas Mund heraus, bis nur noch Annas Hülle übrig bleibt. Die wird dann zusammenfallen wie ein leerer Ballon, und Anna ist tot. Anna schreit. Die Mädchen haben Licht angemacht und rufen Tante Ines. Die sieht, was Anna schon aus sich herausgebracht hat, und macht sich trotzdem keine Sorgen. Anna wird nicht sterben. Nur verträgt ihr Magen nicht den schwarzen Pumpernickel. So einfach ist das. Und sie hat an den Teufel geglaubt.
Zu Mittag taut der Schnee. Am Nachmittag friert er schon wieder. Und davon wachsen Eiszapfen von den Dächern. Manche reichen bis zur Erde hinunter und sind dick wie Baumstämme. In der Sonne glänzen sie feucht. Neben ihnen tropft es. Neue Zäpfchen wachsen, ein ganzer Eiszapfenvorhang. Die Kinder schlagen gegen die Eiszapfen, die kleineren klirren und fallen in den Schnee, von den größeren bricht nur ein Stück ab. Man müsste schon die Axt nehmen, um sie ganz herunterzuhauen.
Der Schnee ist weg. Anna hat nur noch Bauchschmerzen und schlechte Laune. Die Tante redet noch mehr als sonst davon, dass die Mutter Anna abholen wird. Sie sagt, glaub nur, ganz bestimmt kommt sie bald. Bald, bald. Immer bald. Das gemeine Fritzchen sagt: Glaub nur nicht. Die kommt nicht. Die besucht dich nicht mal. Die wäre schon längst gekommen, wenn sie gewollt hätte. Und schön ist deine Mutter auch nicht. Das erzählst du nur. Deswegen ist Anna wütend auf Fritzchen, denn das weiß sie ja nun ganz gewiss: Ihre Mutter ist schön. Anna denkt, seine Gemeinheit steckt sie an. Sie kann sich selber schon nicht mehr leiden deswegen. Wie sie ihre Gemeinheit merkt? Sie kann sich nicht mehr freuen. Über gar nichts mehr. Sie hat Bauchschmerzen und will nur noch eins, dass das bald, bald zu Ende ist. Sie hat schon vergessen, wie sie sich früher mal ihre Heimkehr nach Gottshut ausgemalt hat. Damals wollte sie an einem Sonnensonntag unter Schall des Posaunenchors in Gottshut einziehen. Die Leute würden aus den Fenstern schauen und sich wundern und freuen, dass Anna wieder da wäre. Und alle Kinder würden in ihren Sonntagskleidern auf die Straße kommen und Anna begrüßen. Solche Gedanken hat Anna schon lange nicht mehr.
Nun soll Annas Mutter wirklich kommen. Das gemeine Fritzchen ärgert sich. Anna freut sich über seine Wut.
Anna weiß selbst nicht, warum sie sich im Haus versteckt und die Mutter lieber noch nicht sehen will und kein bisschen neugierig ist. Tante Ines muss sie erst suchen und sie bei der Hand nehmen und nach draußen bringen, wo viele Verwandte sind. Eine Frau mit einem spitzen, nackten Gesicht und langen, gekrausten Haaren ist Annas Mutter. Sie läuft auf Anna zu und ruft sie. Anna mag nicht weitergehen. Ja, das ist schon ihre Mutter. Aber wie hässlich sie geworden ist. Sie hat ein spitzes Mausgesicht.
Du hast gelogen, sagt Fritzchen. Deine Mutter ist hässlich. Hässlich, ganz hässlich.
Wie sich Fritzchen freut, weil er nun scheinbar doch recht behalten hat.
Ja, jetzt ist sie hässlich, sagt Anna. Aber früher war sie schön. Das glaubt ihr das gemeine Fritzchen natürlich nicht. Jetzt steht sie vor dem Lügner selbst wie eine Lügnerin da. Und das kränkt Anna sehr. Sie nimmt es der Mutter übel, dass ausgerechnet sie Anna zum Schluss doch noch dem Anschein nach zu einer gemeinen Lügnerin gemacht hat.
Die Mutter sagt zu Anna: Jetzt haben sie mich endlich über die Grenze gelassen. Weißt du warum? Ich habe ihnen einfach gesagt, wenn ich meine Tochter jetzt nicht holen darf, wird sie drüben eingeschult und ist dann für Ihren Staat verloren.
Anna überlegt, was die Mutter gesagt hat. Also wäre sie doch um ein Haar im Westen geblieben. Fast tut es ihr leid, dass sie nun in den Osten soll und ein ganz gewöhnliches Leben beginnt. Im Westen wäre es spannender gewesen. Sie hätte ein interessantes Leben bei den verschiedenen Verwandten geführt und wäre vielleicht sonst wo gelandet. In Amerika oder an der Nordsee.
An einem frühen Morgen gehen die Mutter und Anna aus der Villa. Tante Ines hat Anna einiges versprochen. Anna ist komisch zumute. Sie weiß genau, nie mehr wird sie die Villa wiedersehen. Sie dreht sich um, weil sie hinter der Hecke die Augen vom gemeinen Fritzchen vermutet und die Villa am Berghang in der kalten Morgensonne mit ihren vielen großen Fenstern funkelt. Das arme gemeine Fritzchen bleibt ganz allein da oben in der Villa und kann an niemandem seine Gemeinheit auslassen. Er hat sich noch nicht einmal von Anna verabschiedet. Die Mutter lenkt Anna ab und erzählt von zu Hause.
Dann fahren die Mutter und Anna in den Osten.
Anna schien, die Mittagsstille in Gottshut sei stiller als anderswo. Niemand zeigte sich, als bewohnten diese Stadt nur die Seelen der zu Gott Heimgerufenen. Für die Mittagshexe, die in der Zeit der Glut ihren Stab schwang, gab es kein Herunterkommen von den Dächern. Die auf den Straßen wandelnden Seligen hielten sie zurück und die Gebete und Lieder, die seit vielen Generationen von den Frommen dieses Ortes zum Himmel aufgestiegen waren.
Aus dem Witwenhof trat eine eulenäugige Frau. Die Füße in den hohen Schnürschuhen gaben den schwachen Gelenken Halt. Sie trug einen Blechbehälter.
Tante Magda. Tante Magda, sagte Anna und lief hinter der Frau her.
Die wandte sich um und erkannte Anna. Ein schwaches Lächeln glitt über ihr Gesicht. Du hier? sagte Tante Magda mit ihrer tiefen melodischen Stimme, der Zwillingsstimme von Tante Leonie. Machst Urlaub in Gottshut?
Eine Woche, sagte Anna und wartete ungeduldig darauf, wieder die Stimme ihrer toten Tante Leonie zu hören.
Wie geht es dir? hörte Anna Tante Leonie fragen. Gut, danke. Und dir?
O gut, gut, sang Tante Magda.
Tatsächlich schien die Tante gesünder, kräftiger. Der Rücken hatte sich gestrafft, die Füße setzte sie behutsam, doch fest auf. Ihr Gang hatte etwas Zielbewusstes bekommen. Die ältere der beiden Schwestern, die Anna nie anders als gebrechlich erlebt hatte, untauglich für eine andere Arbeit als zur Pflege der jahrelang siechen Mutter, ging sicher wie nie, als hätte man eine Last, die sie ein Leben lang niederdrückte, von ihr genommen und sie wäre nun endlich frei. Die einstmals Schwache richtete sich im Alter auf.
Erstaunlich ihre Zähigkeit. Niemand hätte vermutet, dass sie Tante Leonie überlebt, dachte Anna und sagte: Ich hab denselben Weg wie du.
Geh Kind, geh, sagte Tante Magda und wehrte mit einer weiten Geste des Arms das Anerbieten Annas, sie zu begleiten, von sich.
Anna glaubte, dass die Tante weniger fürchtete, Anna durch ihren langsamen Gang zu behindern als selbst behindert zu werden. So winkte ihr Anna noch einmal zu und ging rasch über den Platz zwischen Kirchsaal und Witwenhof, die Herthelsdorfer Allee entlang bis zu jenem Haus, das bis zum Kriegsende die Mädchenanstalt gewesen war. Als Kind hatte sie sich über dieses Gebäude gewundert. In der Woche war das Gatter weit geöffnet, und sie ging über den Hof in das Klassenzimmer. Am Sonntag betrat sie dasselbe Gebäude, um den Kindergottesdienst zu besuchen. Dann benutzte sie den Eingang auf der Straße, ging eine Treppe hinauf in einen großen Saal. So hatte das Gebäude zwei Gesichter gehabt. Eines für den Alltag, eines für den Sonntag. Mehrmals versuchte sie in den Unterrichtspausen von innen her zur Sonntagsseite vorzudringen. Es gelang ihr nicht, als hätte man Glaswände ins Haus eingebaut.
Anna konnte der Lust, ihren alten Schulhof wiederzusehen, nicht widerstehen. Sie ging hinein, und ihre Erinnerung bestätigte sich. Seitlich eine Gruppe hoher Tannen. An den Hof schloss sich ein Garten im Gottshuter Stil an. Seitenwege, ein Mittelweg zu einem Blumenrondell und an der Mauer eine weiße Gartenlaube. Froh vor allem war Anna über den Blick weit hinunter ins Tal gewesen, über Acker- und Weideland. Sie nahm ihn mit, wenn sie in das Klassenzimmer zurück musste, in dem sie sich eingesperrt fühlte, dumm und verschüchtert von den vielen Gesichtern und besseren Leistungen anderer Schüler.
Das ist kein öffentliches Gelände, hörte sie laut jemanden neben sich sagen. Schon die Rufe zuvor hatten wahrscheinlich Anna gegolten.
Anna sah eine kleine ältere Frau an, die sich drohend neben ihr postierte. Ihr Gesicht kam Anna bekannt vor. Sie hätte sogar einen Namen nennen können.
Was suchen Sie hier, fragte die Frau.
Nichts, sagte Anna, zuckte mit den Schultern und verließ unter den wachsamen Augen der Frau den Hof, der seit Jahren kein Schulhof mehr war. Das Gebäude wurde wieder von den Brüdern genutzt, war nun der Schwesternhof.
Über den Eingang von der Straße her gelangte sie in das Haus. Rechts lag ein kleiner Saal, weiß gestrichen wie alle brüderischen Innenräume. An einer langen Tafel hatten sich offensichtlich Direktionsangestellte vom Davidshof zusammengefunden. Alleinstehende Männer und Frauen, die nicht zu Hause kochen wollten. Sie schwatzten und lachten halblaut, während sie auf die bedienende Schwester warteten. Anna grüßte kaum merklich und setzte sich an einen der kleinen Tische. Sie sah hinüber zu einer Familie. Die beiden Kinder saßen im vorgeschriebenen Abstand von der Tischkante, hielten sich sehr gerade, aßen schweigend, mit Appetit, aber nicht hastig. Wahrscheinlich auswärtige Geschwister, dachte Anna. Auch Annas Familie war bei ihrem ersten Gottshut-Ferienaufenthalt jeden Mittag in den Schwesternhof essen gegangen.
Anna mochte das stille Einvernehmen zwischen den Gästen, die Geschäftigkeit der bedienenden Schwester, die gerade das Schiebefenster hochschob und in den Saal schaute. Sie stellte die Teller auf die Durchreiche, erschien wenig später selbst und lief, eine weiße Schürze über ihrem Sommerkleid, zwischen Durchreiche und Tafel hin und her, bedeutete Anna, sie möge sich noch gedulden, räumte Geschirr beiseite, deckte neu ein. Weitere Gäste kamen. Aus der Küche hörte man das Herumschieben von Töpfen, Klappern von Deckeln und Geschirr und das Zischen, als das Hackfleisch in die Pfanne gegeben wurde. So hatten die Gäste noch teil an den letzten Vorbereitungen für die Mahlzeit.
Eine Woche lang würde sich Anna in derselben Tischgesellschaft befinden, die sie ohne sichtbare Neugier aufnahm, und auch ihr späteres Verschwinden würde sie kaum registrieren.
Anna hatte die Villen nach dem Schwesternhof nie beachtet, die letzten auf der kurzen Straße, ehe die Allee zum Dörfchen Herthelsdorf begann. Aufmerksam wurde sie erst, als die Mutter sie eines Tages erwähnte. Die Missionshäuser, sagte sie und erklärte, dass Missionare sie erbaut hatten, um in Gottshut ihren Lebensabend beschließen zu können. Eine der Villen allerdings hatte immer Annas Interesse erregt. Die der Belgern-Sternebecks. Auch bei ihrem Nachmittagsspaziergang in das unterhalb des Schwesternhofes gelegene Tal blieb sie vor dem kastenförmigen Bau stehen. Die Fassade war recht prachtvoll mit ihren mehrfarbigen Ziegeln, einer Ornamentkante über den Bogenfenstern, Absätzen, Säulchen, dem geschwungenen Gitterwerk am Balkon. Als Kind hatte Anna die Villa nicht leiden mögen, weil sie so anders war als die Gottshuter Häuser sonst. Ihre Bewohner hatten es Anna angetan. Judith von Belgern-Sternebeck, die in Annas Klasse ging und so eine schöne Schrift hatte. Bei dem Ferienaufenthalt in Gottshut hatten die von Belgerns Annas Familie eingeladen, und so lernte Anna auch Judiths jüngere Schwester Susanna kennen. Während Annas Schwestern in dem von Belgernschen Garten mit Judith und Susanna spielten, hatte Anna das Schwesternpaar beobachtet. Sie wunderte sich, wie groß und schwer sie waren, wie langsam sie sich bewegten, zusätzlich behindert durch eine altmodische und zu warme Kleidung und die Last der zu Kronen aufgesteckten, sehr dicken, dunkelblonden Zöpfe. Bleich waren sie, dickhäutig und der Blick ihrer beinahe ausdruckslosen wasserfarbenen schrägstehenden Augen fesselte Anna. Sie, die mit ihrer Familie abgeschlossen innerhalb eines Dorfes auf einem großen Pfarrgrundstück lebte, hatte schnell die Ähnlichkeit ihrer Situation mit der des Schwesternpaares erkannt. Auch diese Mädchen verbrachten die meiste Zeit im Garten, einem urwaldmäßigen, paradiesischen Gefängnis, das mit seinem Strauchwerk undurchdringliche Tiefen bot. Seine Tannen und die Blutbuche gaben dem Garten eine große Höhe. In ihm verbarg sich das Schwesternpaar vor den spöttischen Augen der Gottshuter. Denn selbst für Gottshut war die Weltfremdheit der Mädchen außergewöhnlich. Eine alte Hausdame, die die von Belgerns bei ihrer Flucht aus dem Baltikum mitgebracht hatten, führte das Regiment. Tante Leonie nannte sie nie anders als den Zerberus. Anna hatte den Zerberus kennengelernt und war gut mit ihm ausgekommen bei späteren Besuchen. Doch was wusste sie schon von stiller Tyrannei. Ohnehin waren die von Belgerns von sehr sanfter Natur und verführten dazu, über sie zu regieren. Doch hatten sie trotz ihrer Arglosigkeit Würde. Es war nicht von Belang, dass Bruder von Belgern, statt wie seine Vorfahren eigene Ländereien zu verwalten, eine untergeordnete Arbeit im Davidshof verrichtete, dass die Familie nur noch als Mieter in dem Haus wohnte, das einmal 'ihr Besitz war, dass sie nun auch den Garten abgegeben hatten.
Anna hatte die Eltern von Belgern nie anders als heiter gesehen. Er: selbstvergessen, als sei er ständig mit erfreulichen Gedanken beschäftigt, und die Anstrengung, die hinter dieser Gelassenheit steckte, ahnte wohl niemand. Sie: lebhaft wie viele Gottshuterinnen. Beide von zierlicher Statur, sodass das elefantenhafte Wachstum der Töchter um so mehr erstaunte. Sie waren aus einer alten Familie. Doch als sie Anna einmal ihren Stammbaum zeigten, da schien ihr, sie taten es nur, um auf den Schnittpunkt hinzuweisen, wo sich seine und ihre Linie trafen. Ihre Verwandtschaft sollte, so verstand Anna, den Beweis für ihr tiefes Füreinander-bestimmt-sein liefern.
Auf sie trifft das Wort Demut zu, dachte Anna. Demut? Wie mir die alten Begriffe noch geläufig sind. Es tut nichts, dass ich nicht an Gott glaube, ich lebe noch mit Begriffen, Werten aus der Welt, aus der ich gekommen bin. Meine ewige Inkonsequenz. Ich kann keine Brücken abbrechen. Wenn sie hinter mir von selbst morsch werden, zusammenfallen, ist es was anderes.
Sie sind bescheiden, korrigierte sich Anna. Hintergrundpersonen. Sie machen nichts von sich her, obwohl sie es könnten. Sie sind durch Natur und Erziehung als Gottshuter begabt, wie die Gründer sie einmal wollten: jeder des anderen Bruder, des anderen Schwester, jeder versieht Dienst in der Gemeinschaft nach seinen Gaben, seinen Fähigkeiten entsprechend. Sie wären imstande, mit aller Hingabe Arbeiter im Weinberg des Herrn zu sein, sogar dem Rigorismus der Bruder- und Schwesternschaft gewachsen, der jemanden wie mich abschreckt.
Anna glaubte, dass Bruder von Belgern aus dem Haus käme. Der Blick seiner hellen Augen wie durch einen Schleier. Er war so leicht, dass Anna ihn kaum spürte. Unnatürlich schmal, auf ein ebenmäßiges Profil zugearbeitet das Gesicht. Die Haltung kontrolliert wie die eines Militärs. Es schien, er sei in all den Jahren um keinen Tag älter geworden. Seine Familie hatte ihn vielleicht anders im Gedächtnis. Es gab ihn nicht mehr, den stillen Baron.
Anna ging durch eine Gasse am Grundstück entlang hinab ins Tal.