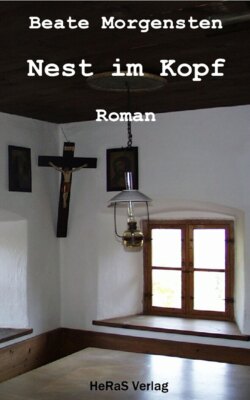Читать книгу Nest im Kopf - Beate Morgenstern - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеIn der Nacht stand Anna in einem großen, sehr dunklen Zimmer. Schwere Vorhänge hingen seitlich zusammengebunden über den Fenstern. Draußen war es finsterer noch als drinnen. Nur vom Kopfende eines riesigen, auf einem hölzernen Podest befindlichen Himmelbetts kam schwaches Licht. Anna ahnte, sie war im Sterbezimmer der alten Dame Buddenbrook. Aber in dem Bett würde wohl Tante Leonie liegen. Langsam ging sie auf das Podest zu. Der Lichtschein wurde stärker. Schon sah Anna das zerwühlte Lager.
Nein, nicht du! schrie Anna. Du nicht.
O doch, mein Kind, sagte die Mutter ruhig. Wusstest du es nicht? Ich habe diese Krankheit.
Tante Leonie hat diese Krankheit, schrie Anna und krallte sich an der Bettdecke fest.
Die Mutter rührte sich nicht. Ihr Gesicht war abwesend. Ihr schien es nichts zu bedeuten, nicht mit Anna geredet zu haben, nicht das Wichtige erfahren zu haben, das Anna ihr sagen musste. Im Glauben an die Unsterblichkeit der Mutter hatte Anna es versäumt, der Mutter das Wichtige zu sagen. Nun würde die Mutter ohne dieses Wissen von ihr gehen. Für sie hatte dieses Geständnis ohnehin keinen Wert mehr. Doch ungesagt würde es auf Anna zurückfallen und eine Last sein, die mit den Jahren so schwer würde, dass sie daran zugrunde ginge.
Anna wälzte sich in ihrem Bett und wachte auf. Es ist noch nicht zu spät, wiederholte sie mehrere Male und zwang sich, nicht aufzustehen und die Mutter in ihrem Schlaf zu stören. Sie könnte am Morgen mit der Mutter reden. Gewiss würde sie das tun.
Ich habe schon an deiner Tür gehorcht, sagte die Mutter.
Anna strich sich über die Stirn. Bin wohl noch mal eingeschlafen.
Du siehst schon viel frischer aus. Die Mutter nickte befriedigt.
Die viele Luft, sagte Anna. Nun hast du wohl schon gefrühstückt?
Nur ein Schnittchen. So spät ist es ja nun auch wieder nicht. Übrigens hab ich ihn heute Morgen gefunden. Mit klarem Verstand geht's eben doch besser.
Den Lebenslauf? Siehst du, ich wusste, er muss da sein.
Ich wusste es ja auch.
Und wo ist er?
Hier. Griffbereit! Die Mutter nahm ein großes Heft aus dem Regal und hielt es, den kleinen Sieg über ihre Unordnung auskostend, triumphierend vor das Gesicht.
Anna schaute kurz in das Heft. Die Großmutter hatte den Lebenslauf noch in gotischer Schrift abgefasst. Ach schade, sagte sie. Kann ich nicht gut lesen.
Es gibt noch Schreibmaschinendurchschläge. Aber wo unsrer abgeblieben ist ...
Eigentlich könntest du mir vorlesen. Dann haben wir beide was davon.
Aber jetzt nicht. Ich hab keine Zeit.
Am Abend natürlich. Früher hast du uns auch vorgelesen, fällt mir ein.
Hattest du das vergessen? Ich hab euch viel vorgelesen.
Besser war Großmutter, dachte Anna. Deshalb hab ich's vergessen. Und Mutter hat uns nur die in vielen Pfarrhäusern gängige Unterhaltungsliteratur vorgelesen. Damit gab sich Großmutter nicht ab. Vorlesen konnte Großmutter. Das war ihre Leidenschaft. Sie hat uns Kindern vorgelesen, ihren Enkeln drüben, später anderen Kindern. Damit konnte sie sich nützlich machen, was sie so brauchte. Wie dramatisch sie die Auftritte von Personen der dörflichen Welt Fritz Reuters gestaltete. Weder sie noch wir waren des Plattdeutschen mächtig. Aber das machte überhaupt nichts. Wenn sie von Onkel Bräsig sprach, krächzte sie wie eine Krähe. Was für eine Krankheit die Podagra war, die Onkel Bräsig quälte, wir verlangten keine Aufklärung. Es genügte uns zu wissen, wie stark ihn die Schmerzen plagten. Großmutter las uns Dickens vor und selbstverständlich Onkel Toms Hütte.
Noch vom Schlaf benommen, versuchte sich Anna zu erinnern, wie die Stimme der Großmutter beim Vorlesen geklungen hatte. Anders als sonst: metallen, näselnd oder etwas schnarrend und tief wie ein sehr altes Volksinstrument.
Mutter hat eine helle Stimme, dachte Anna. Ich glaube, sie war recht stolz auf ihren Sopran.
Während des Frühstücks im Garten schwand Annas Benommenheit, und sie überlegte, weshalb sie in der Nacht eine so panische Angst gehabt hatte, die Mutter könne sterben. Worin das Wichtige bestand, das sie der Mutter zu sagen hatte, war ihr schon klar: sie mochte die Mutter, sie hing an ihr, hatte sich immer nach ihrer Zuneigung gesehnt und als Kind darunter gelitten, dass sie anders war, als die Mutter es wollte, ihre täglichen Beschuldigungen, Anna denke nur an sich, zu ernst genommen, sich von ihr zurückgesetzt, ja ungeliebt gefühlt. Dass der Vater Anna bevorzugte, hatte sie nicht trösten können. Sie hatte Groll gegen die Mutter empfunden, auch als Erwachsene. Doch da war dieser Groll eigentlich schon unwesentlich geworden. Denn als sich Anna im Alter von nicht ganz vierzehn Jahren tatsächlich tief in Schuld glaubte, war es die Mutter gewesen, die sie annahm, während der Vater Anna von sich stieß. Da hatte die Mutter für alle Zeit bestanden. Ein Wort, eine Geste der Mutter, und Anna war ihr nach einer Kränkung wieder gut. Vielleicht sind die weniger geliebten Kinder die dankbareren, dachte Anna. Sie haben immer einen Mangel wettzumachen.
Wenn mal was sein sollte, begann Anna ihre Ansprache an die Mutter. Ich meine, könnte ja mal was sein. Ganz plötzlich. Man weiß ja nie. Also, ich wüsste schon gern Bescheid. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte so viel zu tun, und ihr wollt mich nicht belästigen … An mir soll's nicht liegen. Ich komme auch mal schnell runter.
Was soll denn bloß sein? Ich versteh dich nicht.
Eine ... Krankheit. Anna musste sich geradezu zwingen, dieses Wort auszusprechen und redete dann schnell weiter. Einer könnte ja mal krank werden. Und dann schreibt ihr mir nicht, weil ihr's vergesst und die anderen in der Nähe sind oder weil ihr denkt, es ist nichts. Und dann kann ja doch mal was sein.
Natürlich benachrichtigen wir dich, sagte die Mutter zerstreut. Hör mal, wie schön der Vogel singt. Sie deutete ins Geäst.
Eine Amsel. Haben wir auch in der Stadt viel. Anna war unzufrieden mit sich, weil sie nicht gesagt hatte, was sie sagen wollte.
Wie schön die Amsel singt, wiederholte die Mutter andächtig. Hast du schon mal eine Nachtigall gehört?
Eine Nachtigall? Ja. Sogar mitten in der Stadt. Ich habe mal in der Nacht auf eine S-Bahn gewartet. Da hörte ich Nachtigallen oder Sprosser.
Was ist der Unterschied? erkundigte sich die Mutter.
Im Lied der Sprosser soll was fehlen. Man sagt, die Sprosser sind die Nachtigallen des Nordens.
Dann sind es womöglich Sprosser gewesen, die wir in der Eilenriede gehört haben. Die Mutter war enttäuscht.
Eilenriede. Dieses Wort hatte für Anna und ihre Geschwister einen besonderen Klang bekommen. Von dem hannoverschen Stadtpark hatte die Mutter oft erzählt. Die Spaziergänge mit ihrem Vater durch die Eilenriede gehörten zu den Lieblingserinnerungen der Mutter, und indem sich Anna in ihrer Vorstellung einen eigenen Stadtpark geschaffen hatte, glaubte sie, die Erinnerung der Mutter zu teilen.
Gemeinsam mit den Gottshutern hatte Anna die Vorliebe für den Gottesacker. Die Gottshuter gingen in jeder Stimmung hinauf, in feierlicher nach dem Gottesdienst, in der heiter gehobenen eines Sonntagnachmittags, wenn sie jung und verliebt waren, oder sie bogen in einfacher Spaziergehlaune von der Wiese oder vom Feld ab und schlüpften durch die Hecken.
Anna hatte sich aus der Kindheit den Sinn für das Feierliche erhalten, machte gern aus gewöhnlichen Abläufen Zeremonien. So gestaltete sie auch ihre erste Begegnung mit dem Gottesacker, indem sie langsam die Allee hinaufging, die sie den Prozessionsweg nannte. Früher, so hatte der Vater Anna erklärt, säumten Buchenhecken den Weg vom Kirchsaal bis hinauf zum Gottesacker. Die Hecken fingen die Blicke der Gläubigen ein und lenkten sie zurück auf sich selbst, wenn sie nach einer Versammlung im Gotteshaus ihre ins obere Reich berufenen Geschwister in weißen Särgen der Freude hinauf zum Hutberg geleiteten. Die Buche als Baum des Lebens sollte sinnfällig die untere mit der oberen Gemeinde verbinden. Doch auch jetzt war die Verbindung noch eng genug, selbst wenn die Blicke durch die Lindenallee hindurch in die Landschaft schweiften.
Am Ende der Allee leuchtete Anna auf einem Torbogen in goldener Schrift auf schwarzem Grund der alte Ostergruß entgegen:
CHRISTUS IST AUFERSTANDEN VON DEN TOTEN.
Sogleich fielen Anna die Worte ein, mit denen der Prediger die im Morgengrauen versammelte schweigende Ostergemeinde begrüßte: Der Herr ist auferstanden.
Als eine befreiende Botschaft wurde von der Gemeinde die alte und doch alljährlich neue Nachricht aufgenommen. Erlöst von den langen Wochen Leiden der Passionszeit und der seit Karfreitag eingetretenen Stille, antwortete sie: Er ist wahrhaftig auferstanden. Den ganzen Tag galt dieses Grußwort in den Familien der Gemeinde, die Nachricht, die der eine sagte, der andere bestätigte, sodass es schließlich jedem zur Gewissheit werden musste: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? sagte Anna leise vor sich hin und erinnerte sich, wie sie als Kind an der Hand des Vaters am Ostermorgen hinaufgegangen war zum Gottesacker, im Zug der Gemeinde. Denn den Aufgang der Sonne feierte der Bruderbund an diesem Tag auf dem Gottesacker. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Der Jubel der Bläser überzeugte die Gläubigen vollends von dem Sieg, an dem sie teilhatten. Um diesen Sieg zu verkünden, wurden die Bläser nicht müde. Sie zogen nach der Osterliturgie vom Gottesacker hinunter in den Ort und weckten die noch Schlafenden mit ihren Chorälen.
Anna ging durch den Torbogen hindurch. Mit seinen Lindenalleen und Rasenfeldern, in die Reihen gleich großer flacher Sandsteinplatten eingelassen waren, glich der Gottesacker einem Park, durch den man in fröhlicher Ruhe hindurchwandern konnte. Nichts erregte besondere Aufmerksamkeit. Man brauchte auch nicht die Wege einzuhalten, sondern konnte über die Rasenfelder laufen auf der Suche nach einem bestimmten Grab oder aus Neugier. Dann las man immer die gleichen Vor- und Nachnamen. Selbst die über die fünf Erdteile verstreuten Geburtsorte kehrten häufig wieder, sodass sie ihre Besonderheit verloren. Bald wurde auch einem Fremden die Ordnung innerhalb des Gottesackers klar. Ehe- und Familienbande waren wieder aufgehoben. Nur noch eine Liebe zählte, die zu Gott. In der Reihenfolge, in der der HERR die SEINEN zu sich berufen hatte, lagen sie nebeneinander, die Brüder auf der einen, die Schwestern auf der anderen Seite. Sie waren nun Saatkörner auf dem Acker Gottes, in der Zeit in die Erde gelegt, um in der Ewigkeit aufzugehen.
Buchenhecken zwischen dem unteren neuen und dem oberen alten Gottesacker. Sonst das gleiche Bild. Alleen, Rasenfelder. Auf dem oberen Teil markierten Holzstäbchen mit einer Nummer besondere Gräber für fremde Besucher. Da war das des Zimmermanns und Führers der ersten mährischen Auswanderergruppe, der auch die ersten Hütten gebaut hatte, da das erste Korn auf dem Acker Gottes, das Grab einer unverheirateten Frau. Dort kennzeichnete ein Schild das Grab des Kaufmanns und Fabrikanten, der den Gottshutern eine Existenz sicherte. Die Schilder waren spärlich verteilt. Eines befand sich am Grab des ersten Missionars, zwei weitere an Gräbern von Tibetmissionaren. Einer von ihnen war erst nach fünfzigjähriger Abwesenheit nach Gottshut zurückgekehrt, der andere hatte sich als Sprachforscher und Bibelübersetzer hervorgetan. Fremde Schriftzeichen waren in den Grabstein eingemeißelt. Die ersten Getauften folgten ihren neuen Führern in die alte Welt. Es lagen ein achtjähriger Negersklave aus der Karibik und ein siebzehnjähriger Indianer hier begraben und das erste getaufte Eskimo-Ehepaar.
Gehet hin in alle Welt und verkündet allen Völkern und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So lautete der Auftrag des Herrn der Christen. Die einfachen Gottshuter - Leineweber, Töpfer, Zimmerleute, Schneider - nahmen ihn sehr ernst, zogen in die Welt, um die frohe Botschaft vom Lamm Gottes zu verkünden. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie auf Schiffen, als Arbeiter auf Plantagen. Wurde ihr Leben gefordert, gaben sie es freudig dahin. Sie starben in den Fluten des Meeres oder am Fieber.
Annas Vater missionierte, von einem der beiden Brüder Annas sagte man, er sei ein Evangelist. Anna hatte in ihrer Familie Unduldsamkeit kennengelernt, die Folge fanatischen Eifers. Sie hatte eine Erklärung für das Verhalten der Familie finden müssen, an die sie so viel band. Deshalb hatte sich Anna lange mit dem Missionsgedanken auseinandergesetzt. So fremd er ihr war, so schien ihr der Eifer, die Welt zu erretten, zu missionieren, die Heilslehre in alle Erdteile zu tragen, zum christlichen Erlösungsglauben zugehörig.
Die Gottshuter waren sanfte Missionare gewesen. Sie wollten durch vorgelebtes Leben Zeugnis geben, Erstlinge herausrufen. Das andere war des Heilands Sache. Sie tauften oft über Jahre nicht und nur zögernd, eine allgemeine Christianisierung hatten sie nicht im Sinn und standen damit oft genug den Kolonialkirchen im Weg. Ihre Brüder suchten sie sich unter den Verachteten, den Sklaven. Dennoch, der angeblichen Toleranz der großen wie kleinen Kirchen glaubte Anna nicht oder nur deshalb, weil sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem Rückzug befanden, lediglich auf Bewahrung aus waren. Zu schnell konnten wieder Kreuze errichtet werden. Und dann nicht nur für Märtyrer, sondern auch für Ketzer. Im Namen Gottes. Stellvertretend für einen zu handeln, im Namen eines anderen, konnte zu Anmaßung und Missbrauch von Macht führen, gerade wenn sich die angerufene höchste Instanz außerhalb menschlicher Vernunft und Kontrolle befand und den Dienern dieser Macht allein der Glaube als Rechtfertigung dienen musste. Die frohe Botschaft verhieß Liebe zu den geringsten Brüdern. Doch auch weniger milde Worte standen in der Schrift und damit denen zu Gebote, die sie von Amts wegen oder aus freier Berufung heraus auslegten und sich eine Führungsrolle zuwiesen. Anna war von tiefer Skepsis gegenüber jeder Religion erfüllt, versagte aber denen nicht ihre Achtung, die im Glauben an einen gerechten Gott von anderen wenig, von sich selbst aber alles verlangten.
Zwischen den Bäumen der Alleen sah Anna einzelne ältere Gottshuter, die sich bald im Spiel zwischen Licht und Schatten der Bäume verloren. Hier waren die Toten lebendiger als die Lebenden. Die Toten flüchteten nicht. Sie warteten geduldig darauf, dass man ihre Namen läse. Wo Witterung und Pflanzenwuchs die Namen ausgelöscht hatten, waren sie als Namenlose anwesend und redeten mit in dem vielstimmigen Chor, der das Zwiegespräch mit den Irdischen forderte, die diesen Ort aufsuchten.
Am Ende des Gottesackers, mitten auf einer der Alleen, lagen auf Steinsockeln sieben Grabplatten. Ursprünglich hatten sie sich auf ebener Erde befunden, waren aber bei einer Erweiterung des Gottesackers auf den Weg geraten und auf Steinsockel gelegt worden. Der Graf, weltlicher Schutzherr und Mitbegründer des Gottshuter Bruderbundes, sein Jugendfreund, mit dem er schon während seines Hallenser Aufenthaltes im Pädagogium des Pietisten August Hermann Francke einen besonderen Bund zur Bekehrung der Heiden geschlossen hatte, und Mitglieder beider Familien waren hier in außerordentlicher, dennoch für damalige Zeiten bescheidener Weise beigesetzt. Jedem der Gräber war eine Inschrift beigegeben. Auf dem des Grafen las Anna: Er war gesetzt, Frucht zu bringen, und eine Frucht, die da bleibet. Zu seiner Linken ruhte seine erste Frau Erdmuthe Mechthild. Eine Fürstin Gottes unter uns, besagte die Inschrift. Zur rechten Seite des Grafen seine zweite Frau Anna, eine Bürgerliche, die ihren Ehemann nur um zwölf Tage überlebte. Ihr Dienst im Haus des Herrn bleibt ein Segen, wurde über sie gesagt. Anna gefiel, dass sie nach ihr und nicht nach der Fürstin Gottes benannt war. Über Generationen hin hatten sich die Vornamen der beiden Frauen im Bruderbund behauptet. Immer noch erhielten Neugeborene diese Namen, die Anna schon so alt schienen wie die Berge um Gottshut.
Anna warf noch einen letzten Blick auf die Ovale der Inschriften und das sie umgebende Blattwerk. Von dem Jugendfreund des Grafen bezeugten die Brüder: Er half die Gemeinde von Anfang an bauen, sah sie blühen und grünen, freute sich und legte sich schlafen mit Lob und Dank. Sollte dieser Mann, seines liebsten Bruders treues Herz, wie er sich in einem Brief an seinen Freund bezeichnete, ruhig schlafen. Das weitere Schicksal des Bruderbundes brauchte ihn nicht zu bekümmern. Auch Anna bekümmerte es nicht. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit, endete ein Lied, das sie in ihrer Kindheit oft gesungen hatte. Auf diesem befriedeten Stück Land konnte sie sogar diese Liebe wünschen und Hoffnung schöpfen, dass es den Menschen gelang, Frieden mit sich selbst und der Erde zu schließen. In diesem Augenblick leugnete sie nicht, dass der Gottesglauben ihr in der Kindheit nicht nur Angst vor dem Tod, vor ewiger Strafe eingeflößt hatte, sondern auch Zuversicht in die Zukunft mitgegeben hatte.
Langsam lief sie die Sandwege hinunter zum Ausgang. Der Eingangsspruch am Torbogen hatte mit Auferstehung und ewigem Leben getröstet. Der Weg über den Acker Gottes bereitete die Menschen auf das vor, was der Wahrheit wohl näherkam: ER IST DER ERSTLING GEWORDEN UNTER DENEN DIE DA SCHLAFEN. Mit diesem Spruch auf dem Inneren des Torbogens entließ der Park der Seligen die Besucher in die Welt.
Anna sitzt in Gottshut hinter dem Haus auf der Steintreppe.
Die dunklen rohen Hölzer der Galerie sind von der Sonne warm und duften. Anna streckt die Beine aus. Noch eine Weile, dann werden die Steinstufen so heiß sein, dass sie sich ihre Fußsohlen verbrennt. Sie überlegt, zum wievielten Mal schon, warum sich die Steinstufen so erhitzen, aber sie selbst, die in derselben Sonne sitzt, niemals einen so heißen Körper bekommt. Sie sieht zum Bahndamm hinüber, und die Sonne macht ihren Kopf leer. Da ist nichts mehr drin außer dem Duft des Holzes und dem Himmel. Dann erinnert sie sich an die Großmutter oben in der Wohnküche. Sonst ist niemand da. Als sie an die Großmutter denkt, kommt ihr eine dunkelblaue Glasschüssel in den Sinn, mit dicker, weißlich blauer Milch darin. Molkenrinnsale. Eine Zuckerschicht über der sauren Milch sinkt langsam ein. Jeden Tag macht die Großmutter ihre saure Milch und teilt sie abends aus der blauen Glasschüssel aus. Das Glas ist so herrlich dunkelblau. Darüber vergisst Anna beinahe, dass das Weiße dicke Milch ist. Sie schaut durch das blaue Glas und denkt an Winter im Missions-Eskimo-Land. Jetzt hilft der Gedanke an eine blaue Schüssel mit saurer Milch nicht mehr. Es wird zu heiß in der Sonne. Sie fasst an die eiserne Haltestange. Einmal möchte sie erleben, dass die sich so erhitzt wie eine Ofentür. Sie springt die Stufen hinunter und geht unter die Galerie, die Annas Haus mit dem Nachbarhaus verbindet. Dort im Schatten kann sie spielen und weiter warmes Holz riechen, weil auch die Galerie aus Holz gemacht ist. In der Erde sind kleine Kuhlen vom Murmelspiel. Sie hockt sich nieder, holt ihr Säckchen Murmeln aus der Tasche und lässt eine nach der anderen in die Kuhle laufen. Glasmurmeln sind dabei und auch eine schönste. Jedes Kind hat Glasmurmeln und eine schönste. Abends kommen die Mädchen aus dem Kindergarten, und sie werden zusammenspielen. Die Friseurtochter, deren Freundin und Anna. Dann ist der ganze Hof voller Kinder. Mit ihren eigenen Schwestern, die auch aus dem Kindergarten kommen, hat Anna lieber wenig zu tun. Sie ist froh, wenn sie verschwinden kann, während die Schwestern, die Mutter und die Großmutter durch die Wohnung wirbeln. Am Anfang haben auch die Hofkinder Anna geärgert und sie wegen ihrer Sprache aufgezogen. Anna sagte immer gelt, gelt. Die Hofkinder lachten und sagten: Geld, Geld, dafür kannst du dir was kaufen. Sie kannten nicht das Schwabenland.
Zu Mittag ruft die Großmutter aus dem Küchenfenster: Anna, Anna. Das ist nicht das Annaha-Gerufe von der dicken Frau aus Rosenstetten, das schöne Gesinge. Dafür ist aber die Großmutter Annas eigene Großmutter, und da kann das Rufen wie böse klingen. Es ist ja nicht böse gemeint. Anders als so streng bringt die Großmutter kein Rufen zustande.
In der Wohnküche riecht es komisch. Süß und als wäre man zu schnell gelaufen und schmecke Blut im Mund. Das ist Stadtgas, hat die Großmutter erklärt.
Anna wäscht sich die Hände und deckt den Tisch: Flache-Teller-und-Gabeln heißt das Kommando der Großmutter. Die Großmutter gießt dünnen Eierkuchenteig in die Pfanne. Dabei tütert sie. Sie tütert immer, wenn sie aufgeregt ist. Sie stößt mit der Zunge gegen die Zähne und macht in einem fort: Th-th-th-th. Th-th-th-th. Man bekommt selbst Angst, dass der Großmutter ein Fehler passiert, die Eierkuchen zu schwarz werden oder beim Umdrehen zerreißen.
Außer dem Tütern hat Annas Großmutter noch andere Gewohnheiten. Die Eltern lachen ein bisschen, aber das nimmt die Großmutter nicht übel. Beispielsweise macht die Großmutter in ihrer Kammer früh am Morgen Gymnastik am offenen Fenster. Wahrscheinlich in ihrer Hemdhose, die hinten einen Schlitz hat fürs Klo. Großmutters Hemdhosen hängen immer neben den kleinen Hemdhosen der Kinder auf der Leine. Dann trägt sie auch Leibchen wie kleine Mädchen um die Brust herum. Die Großmutter isst auch Heilerde innerlich. Richtige Erde, gesiebt und gereinigt. Die isst sie morgens, mittags, abends. Außerdem trinkt sie Molke die Menge, isst Quark und viel Schnittlauch. Alles ist sehr gesund und Reform. Vor allem aber ist die Großmutter leicht aufgeregt zu machen. Wenn sie am Tisch mit den Eltern redet, fegt sie Krümel vom Wachstuch, obwohl da schon längst keine mehr liegen. Manchmal scharrt sie sogar mit den Füßen auf dem Boden. Sie regt sich beim Reden, beim Arbeiten, sogar beim Singen und Beten so auf, dass man schon selber aufgeregt wird. Was besonders gut ist an Großmutter: Sie hat gar nicht gemerkt, dass Anna eine Zeit lang von zu Hause fort war, und behandelt sie genauso wie früher. Die anderen haben sich verändert. Bei Mechthild geht's noch. Am meisten hat Anna enttäuscht, dass das dicke Baby nun Erdmuthe ist. Wenn sie schon das dicke Baby war, müsste sie doch wissen, wie lieb Anna sie damals gehabt hat. Jetzt aber will sie gar nichts mehr von ihr wissen. Die Großmutter kommt mit der Pfanne an, schüttet den Eierkuchen auf Annas Teller und stellt das Gas kleiner, das beim Brennen fast wie Wasser rauscht. Sie beten: Komm Herr Jesus, sei unser Gast. Das ist das Gebet für alle Tage. Der Herr Jesus kennt es schon. Er kommt schnell, er labt sich an dem Duft des Eierkuchens, den er Anna beschert hat, mehr braucht er nicht.
Die Eltern machen mit Anna und den Schwestern einen Kretzschmar-Ausflug. Der Vater bringt süßes, dunkles Malzbier aus der Kretzschmarschenke. Er stellt die schweren Gläser auf den Klapptisch im Gartenlokal. Die Beine ruhen sich aus, und der Mund schluckt das süße, teure Malzbier. Er schluckt so viele Schlucke, bis der Magen ganz voll davon ist. Keiner sagt: Aufhören! Zuviel! Die Eltern sind sehr gut zu den Kindern.
Am liebsten lässt sich Anna in die Molkerei schicken. Nirgends ist es sauberer in Gottshut als in dem weiß gekachelten Raum, und alles ist abwaschbar! Die Kacheln, die Schürzen der Frauen, die Schüsseln, die Glasscheiben. Es riecht frisch und säuerlich. Die weiße Magermilch und die etwas gelblichere Vollmilch wird aus silbernen Blechkannen mit silbernen Messkellen geschöpft. In großen Schüsseln liegt locker der Quark. Er wird von zwei Frauen in weißen Gummischürzen in kleine Behälter geschaufelt, die ihnen die Leute geben und auf der großen Waage abgemessen. Hinter der Glasscheibe, die zwischen den Leuten und den Verkäuferinnen ist, sind auf der Marmorplatte Butter und Käse aufgebaut. Nie wird es Anna langweilig beim Warten in der Molkerei. Sie schnuppert und guckt.
Schon ein paar Mal ist Anna auf der Straße angesprochen worden. Bist du eine kleine Herrlich? fragen die älteren Schwestern. Anna schwillt vor Stolz und sagt: Ja. Die Schwestern nicken zufrieden und sagen: Das sieht man. Anna ahnt nicht, woran man das sehen kann. Aber sie findet es sehr gut, dass man sie erkennt und nun nicht mehr zwei, sondern drei kleine Herrlichs durch die Gegend laufen und jeder Anna den Namen Herrlich an der Nasenspitze ansieht. Dadurch ist sie nämlich eine richtige Gottshuterin. Erst wissen es die Erwachsenen und nachher auch alle Kinder.
Die Mutter sagt, die Kinder werden schön lachen, wenn du in die Schule kommst und noch wie ein Baby am Daumen lutschst. Das musst du dir schon abgewöhnen. Sie klebt Anna Heftpflaster um ihren Lieblingsdaumen, damit er 'nicht so gut schmeckt und Anna keine Lust zum Nuckeln hat. Immer, wenn sie sich das Pflaster abreißen will, stellt sie sich vor, dass sie bald in die Schule kommt. Da soll niemand über sie lachen. Anna arbeitet schwer mit sich. So eine schwere Aufgabe hat sie noch nie gehabt. Tatsächlich schafft sie es in zwei Wochen, den Daumen nicht mehr in den Mund zu stecken außer ausnahmsweise mal im Bett.
Die Mutter sagt, das Schütteln abends im Bett ist auch sehr albern. Wie sieht denn das aus. Anna versucht, den Kopf vor dem Einschlafen stillzuhalten. Vielleicht eine halbe Stunde. Sie probiert es mehrere Tage. So schnell gibt sie nicht auf. Aber wenn sie den Kopf stillhält, kann sie nicht einschlafen. Da ist ihr das Einschlafen schließlich doch lieber. Und wer sieht sie schon. Gerade die Schwestern und der liebe Gott. Schade, sie hätte sich gern bewiesen, dass sie ganz und gar über ihren Körper bestimmen kann und alles mit ihm schafft, was sie ernstlich will. Nun ist sie doch keine so große Bestimmerin, wie sie nach dem Abgewöhnen des Daumenlutschens glaubte. Anna bekommt eine erste unklare Vorstellung von dem Begriff sich bezwingen, sich beherrschen, Herr über sich sein.
Abends schläft Anna zweimal ein. Einmal mit den Schwestern im Schlafzimmer. Einmal in der Nacht im Wohnzimmer auf dem Klappbett. Der Vater nimmt sie aus dem Ehebett und trägt sie, so groß, wie sie ist, rüber ins Wohnzimmer, wenn die Erwachsenen ins Bett gehen wollen. Manchmal wacht Anna gar nicht richtig auf. Sie legt ihre Arme um den Hals des Vaters und träumt von den Erwachsenen und dem Licht im Wohnzimmer. Der Traum endet mit einer Enttäuschung. Der Vater nimmt Annas Hände von seinem Hals und legt sie im kalten, harten Klappbett ab. Da friert sie und ist böse.
An ihren vierten Geburtstag kann sich Anna erinnern, weil sie da ihre ersten beiden Bücher geschenkt bekam. Grimms Märchen. Die Eltern sagten ihr ein paar Mal: Das sind nun deine ersten beiden Bücher, und sie sollte sich wer weiß wie über ihre ersten beiden Bücher freuen. Aber sie ärgerte sich nur über die sehr kleine, vertrackte Schrift und darüber, dass sie keine Bilder hatten. Sollten die rosa Bändchen verschimmeln. Auch jetzt hatte sie überhaupt keine Lust auf sie. Die Mutter kann zehnmal auf das Bücherbord zeigen. Die kleine Schrift wird sie nie lesen lernen. Sie will es gar nicht. Und auf die Schule freut sie sich auch nicht. Sie will im Herbst hauptsächlich in den Kindergarten. Vormittags geht sie in die Schule, aber nachmittags, denkt Anna, geht sie dann endlich wieder in den Kindergarten.
An dem Tag, an dem Anna in die Schule kommt, ist der Vater schon wieder abgereist. Die Mutter geht mit Anna über den Kirchplatz. Das Wetter und Anna haben schlechte Laune. Der Himmel ist zu, nur grau, und der Wind bläst den Staub vom Erdboden in die Luft und in die Augen. Das soll nun ein Festtag sein. Nur Sonntage sind Festtage. Und Geburtstag vielleicht. Aber nie ein gewöhnlicher Werktag. In der Schule bekommt Anna eine lila Zuckertüte. Groß ist sie nicht. Andere haben größere. Und später wird sie jede Zuckertüte der Geschwister an dieser Zuckertüte messen und immer wieder finden, dass sie eine sehr, sehr kleine Zuckertüte bekommen hat. Doch jetzt freut sie sich einigermaßen und verliebt sich in den jungen Schulleiter. Auf dem Heimweg kramt sie in der Tüte herum. Unten ist sie mit Zeitungspapier ausgestopft. Was glaubst du denn, sagt die Mutter. Wir konnten doch nicht die ganze Zuckertüte füllen. Das ist klar. Anna war eben mal wieder dumm. Zu Hause erwartet Anna ein ganz anderer Reichtum: Sie hat Post bekommen. Viele Karten von den Familien in Gottshut. Sogar Onkel Renzoni, der gegenüber auf dem Flur wohnt, hat über die Post an sie geschrieben. Zählen kann Anna noch nicht. Doch sie ist überzeugt, dass jede Familie aus dem Bruderbund ihr geschrieben hat. Alle Leute denken heute an sie. So eine wichtige Person ist sie. Lange wird Anna die Karten zusammen mit den Sanella- und Knorr-Bildern aufheben. Dann gibt es auch ein Festessen, das die Großmutter gekocht hat, und einen Extragast für Anna: Tante Leonie Fendel. So beliebt hat sich Anna noch nie gefühlt wie an ihrem ersten Schultag.
Am ersten Unterrichtstag wandern Anna und Paulchen nach der Schule in den Kindergarten zur Tante mit den Silberfäden in den Haaren. Was wollt ihr denn hier? sagt die Tante und tut ganz fremd. Anna und Paulchen erklären ihr, dass sie am Nachmittag noch Zeit haben für den Kindergarten. Nein, nein, was ihr euch denkt, sagt die Tante. Jetzt geht ihr in die Schule. Der Kindergarten ist nicht mehr für euch. Sie hat ganz schwarze Augen, keine Sonnenstrahlen mehr darin. Die sind für Schulkinder auch abgeschafft. Anna begreift nicht, warum die Tante so böse ist.
In der Schule quält sich Anna. Sie fühlt sich in dem dunklen Unterrichtsraum zwischen zu vielen und fremden Kindern eingesperrt. Eine Dreiviertelstunde hintereinander sitzen alle still und hören auf ein Kommando. Annas Griffel brechen durch, weil sie zu fest auf die Schiefertafel aufdrückt. Die umgekehrten Zuckertüten, die ein A sein sollen, werden zu Himpelchen- und Pimpelchen-Zwergenmützen. Immer hatte Anna eine gute Meinung über ihren Kopf gehabt. Nun sind die Kinder des Bruderbundes besser als sie. Sogar die Friseurtochter.
Zu Hause plagt sich Anna weiter auf der Schiefertafel. Die Großmutter teilt Kopfnüsse aus und wischt die Tafel ab. Nachher sieht sie von dem vielen Griffelstaub ganz verschmiert aus, und die Buchstaben und Zahlen sind immer noch Krakel. Die Großmutter könnte sagen: Deine drei Onkel waren auch schlechte Schüler, und später haben sie studiert. Und ich habe deinen drei Onkeln und deiner Mutter auch Kopfnüsse gegeben, weil sie die Schiefertafel verschmierten. Aber sie sagt es nicht. Sie denkt, Trost verweichlicht, und Härte bildet den Charakter.
Wenn Anna mit Paulchen zusammen ist, vergisst sie die Schule. Jeden Nachmittag treffen sie sich. Sie sind unzertrennlich wie in ihrer Kindergartenzeit. Bei Sonnenschein stromern sie mit den anderen beiden Freunden aus dem Kindergarten durch Gottshut. Regnet es, bleiben sie beide in Paulchens Wohnung. Tagsüber hat Paulchen die Wohnung ganz für sich allein, weil Schwester Weinreich in der Erwerbshilfe arbeitet. Schwester Weinreich. Tante Fendel und Annas Mutter sind Freundinnen von der Erwerbshilfe. Am liebsten zeichnet Paulchen mit seinen Wachsbuntstiften. Er zeichnet immer Dampfer. Erst das Schiff mit seinen Deckaufbauten, dann den großen Schornstein, von dem Strippen abgehen. An die Strippen werden bunte Fähnchen gehängt. Die Kajüten bekommen Fenster. Der Teil, der ins Meer hineingeht, runde Kreise. Bullaugen. Das Meer glänzt von dem vielen blauen Wachs. Selbstverständlich fahren die Schiffe nur bei Sonnenschein. Anna denkt an ihren Vater, der früher Matrose war. Woran Paulchen denkt, weiß sie nicht. Sie reden hauptsächlich über technische Einzelheiten und Verbesserungen an ihren Schiffen.
Die Erwerbshilfefrauen machen auf geschmückten Leiterwagen einen Herbstausflug. Sie sind sehr vergnügt. Anna, Mechthild und Erdmuthe sehen am Straßenrand zu, wie die Frauen in die Wagen einsteigen. Die Frauen singen: Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus, Städele hinaus. Anna sieht das Städele. Rosenstetten. Fachwerkhäuser, enge Straßen. Über das Kopfsteinpflaster rumpeln Fuhrwerke. Spitzige Schatten laufen von der Sonnenseite der Straße die Wände der gegenüberliegenden Fachwerkhäuser hinauf. Anna versteht nicht, warum die Frauen so gern aus dem Städele hinaus wollen. Sie kann Abschied nicht mehr aushalten.
Der Bruderbund hat sich Gedanken über die Kinder der Erwerbshilfe-Mütter gemacht. Die frühere Lehrerin, Schwester Leonie Fendel, erhält die Erlaubnis, nachmittags im Haslinger-Saal die Kinder bei den Schularbeiten zu beaufsichtigen. Anna geht jetzt nachmittags in den Haslinger-Saal auf dem Hof neben dem Krankenhaus, der sonst als Sitzungssaal dient. Da sitzt sie nun mit einem Häufchen anderer Kinder und übt. Es ist ihr peinlich, dass Tante Fendel, die später erst Tante Leonie heißt, Annas Begriffsstutzigkeit mitbekommt. Doch dann wächst Vertrauen zu der Tante, da diese ihre Meinung über Anna nicht verändert. Tante Leonie Fendel gibt ihr das Gefühl, sie ist ein Kind, das erst anfängt. Das eine Kind hat einen leichten Anfang, das andere einen schweren. Deswegen ist das eine nicht klüger als das andere. Anna ist nachmittags wieder mit den anderen Kindern des Bruderbundes zusammen wie im Kindergarten. Nur sind sie jetzt mit ernsteren Dingen beschäftigt. Dass Anna langsam aufholt, merkt sie selbst nicht.
Die Flickschneiderin ist bei Anna zu Hause. Sie thront in der Wohnstube inmitten von Kleidern, Stoffresten und zugeschnittenen Teilen, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, rattert mit der Nähmaschine, der eine Fuß wippt auf dem Trittbrett auf und nieder, die Hände halten den Stoff, die rechte Hand stoppt das silberne Rad oben, wenn die Naht zu Ende ist. Sie redet mit einer weichen, dunklen Stimme. Die Worte rollen und gurgeln, als hätte sie eine Kuller im Mund. Und einen schönen Leberfleck hat die Flickschneiderin. Er sitzt dick und fett neben ihrer Nase und erweckt Annas unbedingtes Zutrauen zu der fülligen, mehr schwarz- als grauhaarigen Schneiderin aus dem Nachbarort. Solange die Flickschneiderin im Hause ist, ist sie es, die regiert. Kein hartes Wort darf fallen. Dann wird sie nunu-oaber-oaber sagen, loassen Se doch das Kind, gutte Frau. Anna holt sich den Kasten mit dem Leuchtschmuck aus dem Schlafzimmer, setzt sich auf den Boden, zieht sich eine Decke über den Kopf, und die Anstecknadeln beginnen zu glühen in der Dunkelheit. Anna zeigt den Schmuck der Flickschneiderin. Die lächelt und sagt: Noch vonnem Kriege, nunu. Anna wundert sich, dass nach so vielen Jahren das Glas immer noch die Kraft hat, Licht zu sprühen. Niemand erklärt ihr die Bedeutung des Leuchtschmucks in der Zeit der Verdunkelung während der Bombennächte. Dann hätte sie vermutlich später bei dem Märchen von Aladins Wunderlampe nicht an den Kriegsschmuck denken mögen. Nie wieder Krieg steht auf vielen Häuser- und Ruinenwänden. Und darin stimmen die Eltern mit dem Staat überein, in dem sie ihre Kinder großziehen.
Es gibt einen reichen und einen armen Bäcker in Gottshut. Beide wohnen auf derselben Straße und sind eigentlich Nachbarn, obwohl es zum armen Bäcker viel weiter ist als zum reichen. Der Reiche wohnt in einem neuen Haus vor der Treppe, die in den Himmel führt. Der Arme lange nach der Treppe. Zum Reichen geht man die Stufen hinauf, zum armen die Stufen hinunter. Einmal in der Woche wird Anna zum Bäcker geschickt, um Semmeln für den Sonntag zu holen. Sonst kaufen sie nur Kastenbrot im Konsum. Sie geht immer zu dem armen Bäcker ganz am Ende des Kirchplatzes. Das will die Mutter so, Anna will es auch so. Nur Schwesternküsse aus Eischaum und Zucker kaufen sie beim reichen Bäcker. Der junge arme Bäcker hat eine Kriegskrankheit. Splitter wandern in seinem Körper herum. Manchmal piken sie sich bis zur Haut durch. Dann kann man sie rausziehen. Aber einer kann auch mal zum Herzen wandern. Dann ist es aus mit dem Bäcker. Er muss sterben. Anna denkt viel an ihn. Jede Nacht quälen ihn die Schmerzen, erzählt man sich. Während Anna ruhig einschläft, kann ein Splitter auf das Herz zuwandern. So ungerecht geht es in der Welt zu. Anna macht sich auch Gedanken um die Treppe, die auf dem mit Sand und Erde zugewehten und mit Grasbüscheln bewucherten Grundstück am Kirchplatz stehen geblieben ist. Einmal war dort ein großes Gebäude, der Pilgerhof. Wahrscheinlich ist es über den Menschen zusammengestürzt, und man hat die Trümmer abgetragen. Nur die Treppe blieb übrig. Nun spazieren die Seelen der toten Bewohner von dieser Treppe hinauf in den Himmel und wieder herunter wie die Engel auf der Himmelsleiter, von der Jakob träumte.
Einmal hat Anna die Mutter ganz für sich allein: als ihr die Wucherungen in einem Dresdener Krankenhaus entfernt werden. Es wuchert in Annas Hals. Sie darf mit der Mutter eine lange Fahrt machen. Erst als sie den Krankenhausgeruch riecht, wird ihr bange. Sie kennt den Geruch, weiß aber nicht woher. Äther, sagt die Mutter. Sie grübelt und wird Tage oder Jahre danach eine Erinnerung haben, die in ihr drittes Lebensjahr zurückreicht: Sie sitzt in einem großen Saal mit vielen Kindern. Alle sind in Eisenbetten. Neben ihrem Bett ist das von Mechthild. Sie bewacht ihre Schwester. Die Eltern werden ihr die Umstände ihres ersten Krankenhausaufenthaltes erklären. Dann ist sie beruhigt über die Kenntnis des Krankenhausgeruchs. Auf einem schwarzen Wachstuchsofa liegt ein Kind und wimmert. Ihm sind schon die Wucherungen rausgenommen worden. Die Mutter redet leise mit Anna. Sie redet schön. Anna nimmt sich fest vor, dass sie es der Mutter nicht schwer machen wird. Im Behandlungsraum ist sie furchtsam und neugierig. Der Arzt mit dem kleinen Spiegel am Kopf gibt ihr eine gebogene rote Schale. Die soll sie unter ihrem Kinn festhalten. Der Arzt greift mit einem Gummihandschuh in ihren Hals. Anna wundert sich, dass sie mit dieser großen Hand im Hals nicht erstickt. Er holt Fleischklumpen aus ihrem Hals und legt sie in die Schale, sodass Anna das Fleisch genau anschauen muss. Die Igelitschürze vom Arzt ist blutbespritzt wie eine Fleischerschürze. Dann liegt Anna auf dem schwarzen Wachstuchsofa wie der Junge, der jetzt nicht mehr da ist. Sie wollte nicht weinen. Aber der Hals brennt, als hätte man Salz auf das rohe Fleisch gestreut. Nach einer Stunde gehen die Mutter und Anna. Anna ist jetzt ihr ganz kleines Kind. Sie fahren bis in die Kreisstadt. Dort gehen sie in einen dunklen Laden. Anna darf sich ein Spielzeug aussuchen. Sie möchte ein Äffchen. Die nächsten Tage muss sie fasten. Erst trinkt sie nur Saft, nachher kriegt sie Pudding.
Adventszeit. Der Vater ist da. Er übt mit Anna einen Liedvers für die Christvesper ein.
Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesus du mein Leben, ich komme ...
Ich komme, bring und schenke dir ... sagt der Vater.
Ich komme bring und schenke dir ... was du mir hast gegeben.
Nimm hin
Nimm hin es ist mein Geist und ...
Mein Geist und Sinn
Mein Geist und Sinn
Herz, Seel und
Herz Seel und Mut nimm alles hin
Und?
Und lass dirs wohl gefallen.
Anna schnurrt den Rest herunter. So ganz versteht sie nicht, was sie da lernt. Herz-Seel-Geist-und-Mut, war nicht alles dasselbe? Sicher nicht ganz. Anna gefallen die schönen, schwierigen Worte. Sie hat eine Vorliebe für schöne, schwierige Worte und schöne, schwierige Töne und freut sich, dass der Vater ihr den Liedvers zutraut. Für ihn ist Anna der kleine drollige Kamerad, den er in seiner späteren Amtszeit so nötig brauchen wird. Zeitig pflanzt er in Anna seine Liebe zu dem Dichter Paul Gerhardt und dem über alles geschätzten Johann Sebastian Bach ein.
Im Religionsunterricht wird eine kleine Bescherung aus Spenden der Gemeinde ausgerichtet. Die strenge alte Religionslehrerin ruft jedes Kind einzeln auf. Die Kinder dürfen ihre Tüten gleich auspacken. Anna findet in ihrer ein großes Lebkuchenherz vom reichen Bäcker und einen Apfel. Dann fühlt sie etwas Langes, Gestricktes. Sie vermutet einen Schal und wickelt es auseinander. Da könnte sie fast heulen. Es sind lange Wollstrümpfe. Schon jetzt fangen ihr die Beine an zu jucken. Den ganzen Winter wird sie sich halb totkratzen. Lieber hätten sich die Schwestern mit dem Stricken und der guten Wolle nicht so anstrengen und ihr ein Paar billige Baumwollstrümpfe kaufen sollen, die herumschlabbern, wenn sie nur einen halben Tag am Strumpfgummi des Leibchens angeknöpft sind. Viel Gutes konnte aus einer Religionsunterricht-Bescherung sowieso nicht herauskommen. Aber eine richtige Strafe hat Anna nicht erwartet. Anna mag den Religionsunterricht noch weniger als die Schule. Nur aus einem Grund kann sie die Religionslehrerin leiden: weil sie ein Mädchen angenommen hat, das vielleicht von Zigeunern abstammt, so fein und dunkelhäutig sieht sie aus und sagt kaum mal etwas. Leider ist sie nicht in Annas Klasse gekommen. Sonst hätte Anna das Mädchen jeden Tag ansehen können. Später hört Anna, das Mädchen sei ein Russenkind. Davon hätte es viele in Gottshut gegeben. Flüchtlingsfrauen hätten sie den Gottshuterinnen überlassen, sie wurden in ihren Familien aufgenommen und großgezogen.
In der Kinderchristvesper wandern Saaldiener in dunklen Anzügen und Saaldienerinnen mit weißen Hauben und gehäkelten Umhängen durch die Reihen, während leise die Orgel spielt, fragen die Kinder Liedverse ab, geben ihnen aus einem Kerzenbündel lange, mit grünen Papierröckchen geschmückte Kerzen und zünden sie an. Erst sagt Mechthild ihr Sprüchlein, dann Anna ihr Ich-steh-an-deiner-Krippe-hier. Sie bleibt stecken. Doch der Bruder und der Vater lächeln, und der Vater hilft weiter. Bischof Borchert sitzt auf einem weißen Lehnstuhl vor einem mit grünem, festem Stoff verkleideten Pulttisch und liest etwas vor. Anna muss den Bischof statt Gott lieben, den sie nicht sehen kann und der die Menschen so liebte, dass er seinen einzigen Sohn als Christkind den Menschen zum Geschenk machte. Der Saal ist beinahe wie im Himmel, alles weiß. Vorhänge, Wände, Bänke leuchten im Kerzenlicht. Und hoch oben singt jubelnd der Engelein Chor.
Taumelig vor Glück geht Anna mit dem Vater und Mechthild nach Hause. Für die Mädchen sitzen auf dem Gabentisch alte Gliederpuppen mit Porzellanköpfchen. Die größere mit der schwarzen Lockenperücke ist Annas. Sie nennt sie nach der Tochter der Religionslehrerin: Amrie. Im Laufe der Jahre und Mode wechselt Amrie ihre Perücken und sogar ihren Kopf aus. Doch ihre Seele hat sie mit ihrem Namen bekommen und behält sie solange, wie Anna beim Aussprechen ihres Namens nicht nur Puppe denkt, sondern zigeunerhafte Tochter der Religionslehrerin.
Die Brüderwiese ist am Nachmittag Treffpunkt der Kinder. Die tollkühnen Größeren wagen mit ihren Skiern eine Abfahrt vom äußersten Rand der Wiese, die Senke hinunter, und bremsen kurz vor der Schlucht des Ebersbachs ihre Fahrt ab. Die ganz kleinen Kinder fahren vom Wald aus seitlich in die Mulde hinein. Die meisten Schlittenbesitzer nehmen den steilen gegenüberliegenden Buckel und stemmen sich im Tal mit aller Kraft gegen den Schnee und lenken den Schlitten auf den Weg, um nicht im Ebersbach zu landen, der mörderisch ist. Kinder haben sich schon Knochen gebrochen, sagt man. Wenn man sich das vorstellt, racks, knacks, die Knochen mittendurch. Erst schlägt der Kopf gegen die oben an der Schlucht wachsenden Bäume, dann trudelt das Kind mit umherfliegenden weichen Armen und Beinen das Gebüsch hinunter und schlägt dann auf dem Felsen im Eiswasser auf. Halb tot oder ganz tot. Anna graust es vor dem im Sommer so friedlich stinkenden Ebersbach, der nun zur Mördergrube geworden ist. Sie hat einen guten Familienschlitten und saust von oben hinunter ins Tal. Aber sie vergisst nicht, rechtzeitig ihr linkes Bein in den Schnee zu setzen, um die Kurve zu kriegen. Ein- oder zweimal am Nachmittag nimmt sie Mechthild auf ihrem Schlitten mit, hält die kleine Person ordentlich fest und riskiert nichts. Ansonsten hat Mechthild ihren eigenen Schlitten. Einen solchen gibt es auf der ganzen Brüderwiese nicht noch mal. Kurz, mit eingedrehten Schneckenkufen und runder Rückenlehne, ganz und gar aus Eisen, nur der Sitz aus Holz. Anna meinte erst, dass er nicht führe, läge an Mechthild, und probierte ihn selbst aus. Doch er ist so gemacht, dass niemand damit ordentlich fahren kann. Nur Mechthild hält es mit ihm aus, rutscht ein Stück, kippt um, rappelt sich auf, rutscht wieder ein Stück. Keine Gefahr, dass sie einmal im Ebersbach landet.
Frühjahr. Anna kreiselt mit Paulchen auf den Gehwegplatten vor seinem Haus. Anna bindet die Peitschenschnur um die Kerben des hölzernen, bunt bemalten Kreisels, wirft den Kreisel von sich, holt gleichzeitig mit der Peitsche aus und schlägt ihn, bis er zu wackeln aufhört, sich immer schneller dreht und schließlich tanzt, ganz ruhig, kaum dass er sich von der Stelle bewegt. Ab und zu bekommt der Kreisel eins mit der Peitsche über, rutscht kurz zur Seite und tanzt weiter. Irgendwann verpasst Anna den richtigen Augenblick, der Kreisel wackelt und fällt um. Paulchens Kreisel steht fast still auf seiner Spitze, rutscht zur Seite, richtet sich wieder auf.
Paulchen bringt Anna das Pfeifen bei. Wo sie geht und steht, übt Anna, spitzt die Lippen und bläst Luft durch. Mal pfeift es, mal nicht. Mehr und mehr pfeift es. Die Großmutter sagt: Mädchen, die pfeifen, ·und Hühnern, die krähen, den soll man beizeiten den Hals umdrehen. Anna findet den Vergleich komisch, weil doch jeder Lippen zum Pfeifen hat, nicht nur Jungen. Sie wird ein krähendes Huhn bleiben, woraus man ihr vorläufig keine Vorwürfe macht außer dem, sie sei zu wild. Aber die Mutter erzählt gern selbst, sie sei ein wildes Mädchen gewesen, und so fruchten schon deshalb die Ermahnungen nichts.
Im Morgengrauen des Ostertages sind viele Brüder und Schwestern auf den Straßen von Gottshut unterwegs. Gesprochen wird nicht. Stumm nickt man sich zu. Auch als sie dicht gedrängt in den frischen Mauern des neuen, noch nicht überdachten Betsaals stehen, der Himmel über ihnen wie in einer Ruine, fällt kein Wort. Wenn ein Einzelner nicht redet, fällt das nicht auf. Aber bei so vielen ist das Schweigen etwas Gewaltiges, Großes. Beklommen sieht Anna zum Vater auf. Dr Prediger singt mit dünner Stimme. Anna erschrickt, als die Gemeinde seinen Gruß erwidert. Nachher ordnet sich die Gemeinde zu einem Zug. Die Bläser führen ihn an. Als sie auf dem Gottesacker sind, geht die Sonne hinter dem Hutberg auf. Der Vater und Anna machen noch einen Umweg, ehe sie zur Familie zurückkehren. So wie auf diesem Spaziergang, vom Vater ausgezeichnet, hat sich Anna noch nie gefühlt. Während die Mutter, die Großmutter und die Schwestern sicher schon auf die Hauptstraße hinunterschauen, wann sie denn endlich kommen, gehen der Vater und Anna durch den Ort bis zur Brüderwiese. Dort pflücken sie Himmelschlüsselchen. Anna denkt, sie seien extra wegen Ostern gewachsen, um das Tor zum Himmel aufzuschließen, in das seit dem ersten Ostern jeder hinein kann, der es ernstlich möchte. Märchenschön sind die unzähligen gelben Blüten auf der Brüderwiese. Man kann ihnen ruhig ein bisschen glauben, dass sie wirkliche Himmelschlüsselchen sind.
Frühmorgens ist Anna sehr ausgeschlafen und kann es manchmal kaum erwarten, bis sie endlich über die lange, langweilige Hauptstraße und den Kirchplatz weg ist und in der Herthelsdorfer Allee, ihrer Lieblingsstraße. Sie freut sich auf die Kinder. In der Pause stehen die Schüler von der Ersten bis zur Achten in Grüppchen herum. Anna ist meist mit Paulchen und seinen beiden Freunden zusammen oder mit der Friseurtochter. Sie schaut sich die Augen aus nach einem Jungen aus der Dritten. Wenn sie erst mal in der Dritten ist. Aber dann ist der in der Fünften. Und wenn sie in der Fünften ist, dann besucht er die Siebente. Nie kann sie ihn einholen. Schon bis zur Dritten kann sie kaum denken. Und doch, eines Tages muss er Anna mal ansehen. Sie setzt großes Vertrauen in ihr Wachsen. Auch interessiert sie die Mitklassenbeste: Judith von Belgern-Sternebeck. Mit Judith, die die schönsten Buchstaben in der Klasse malt, redet kaum jemand. Nur ihre dicken langen Zöpfe bestaunen alle. Sie selbst freut sich nicht. Sie sagt, die Haarnadeln täten ihr weh, und die Zöpfe seien so schwer auf ihrem Kopf. Von den Kopfschmerzen hat sie wahrscheinlich die bleiche Gesichtsfarbe und ihr langsames Herumgehen. Judith. Judith von Belgern-Sternebeck. Anna findet, der Name ist ein Schmuck für die ganze Klasse und sagt den Namen gern her, möglichst in der vollen Länge und nicht nur Judith von Belgern. Judith allein sagt sie ebenfalls gern. Wer heißt schon Judith. Niemand sonst könnte solch einen Namen aus dem Alten Testament tragen als Judith von Belgern-Sternebeck. Hat Anna keine Lust auf Kinder, beschäftigt sie sich mit der Natur. Da gibt es genug, weil die Schule am Tal liegt und kein Haus mehr rechts oder links an die Seite angebaut ist. Dann trifft sie noch jemanden gern in der Schule: den jungen Schulleiter. Obwohl er sie nie unterrichtete, wird er einer der wenigen Lehrer aus ihrer Grundschulzeit sein, von dem sie auch noch als Erwachsene den Namen weiß.